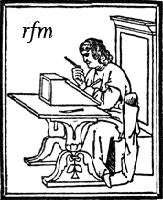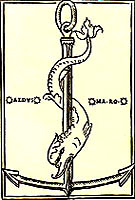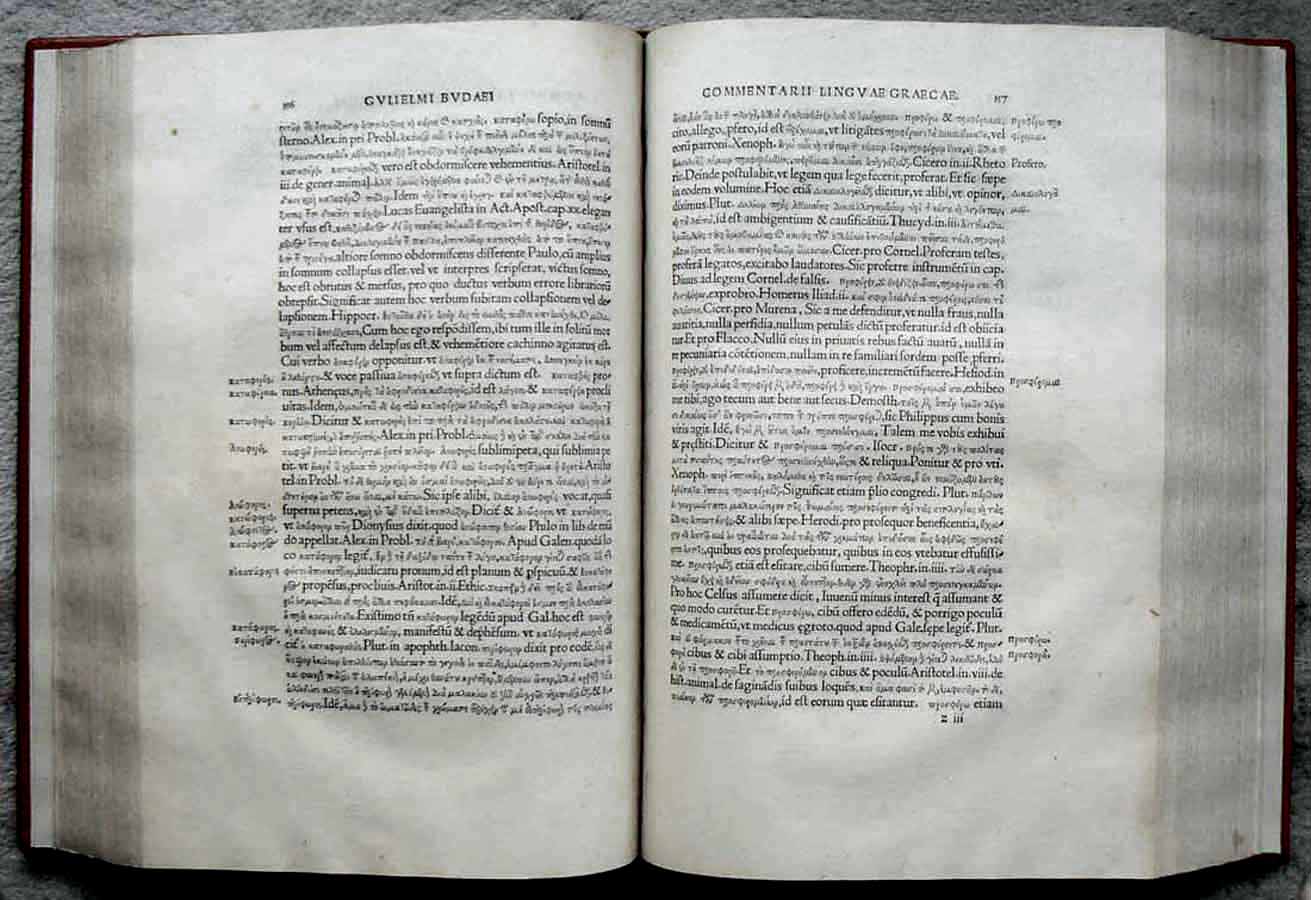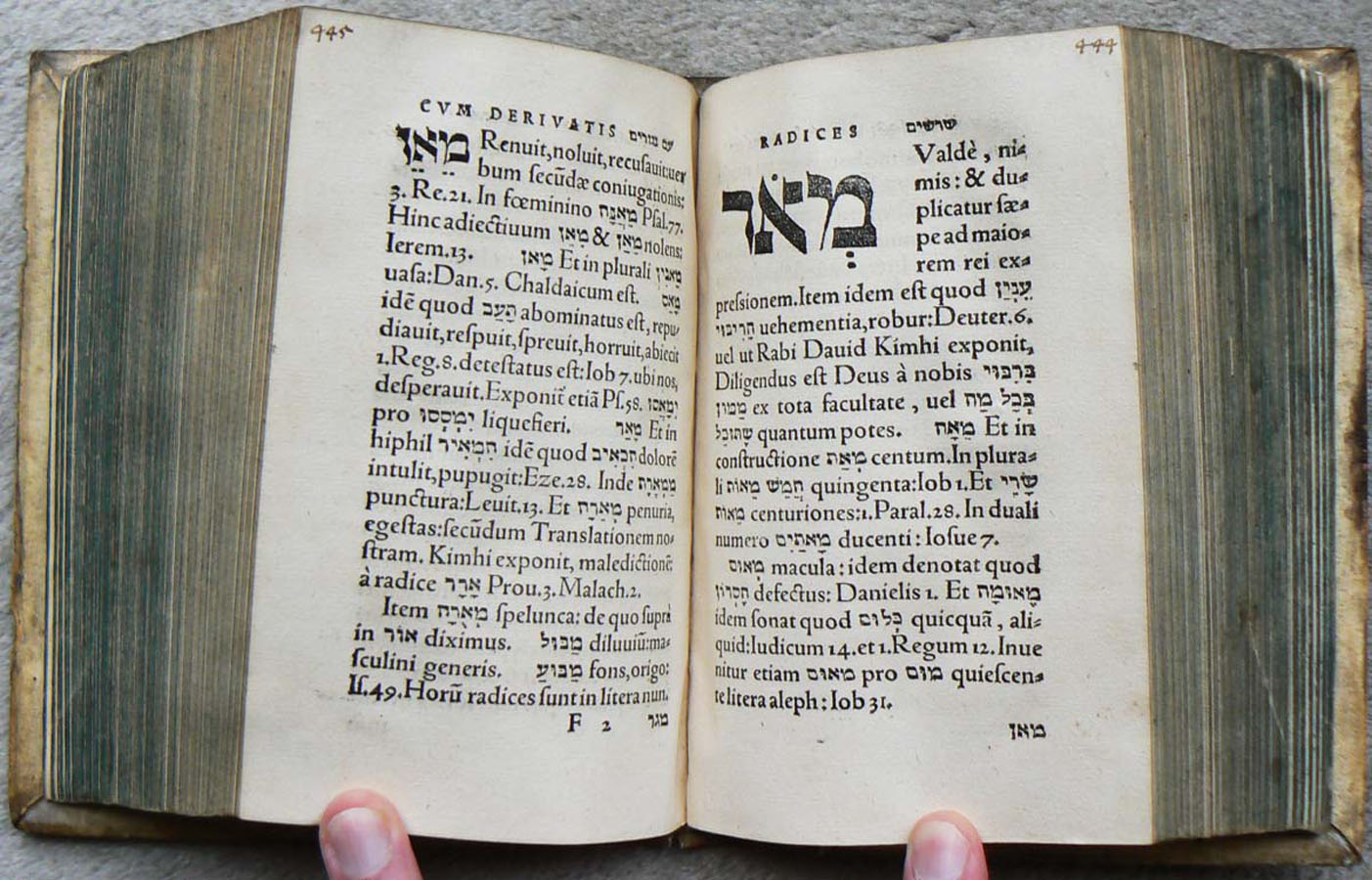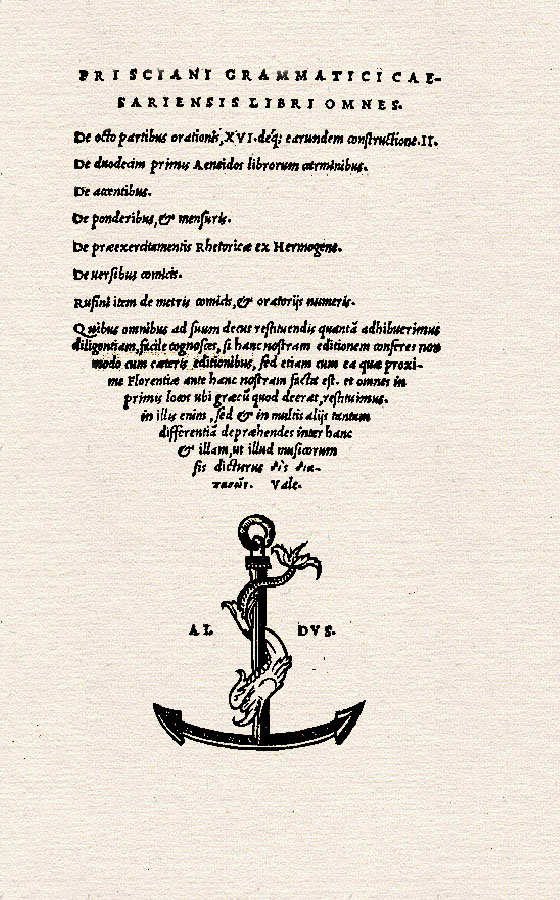Johann Christoph Adelung: Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache
Adelung Lehrgebäude
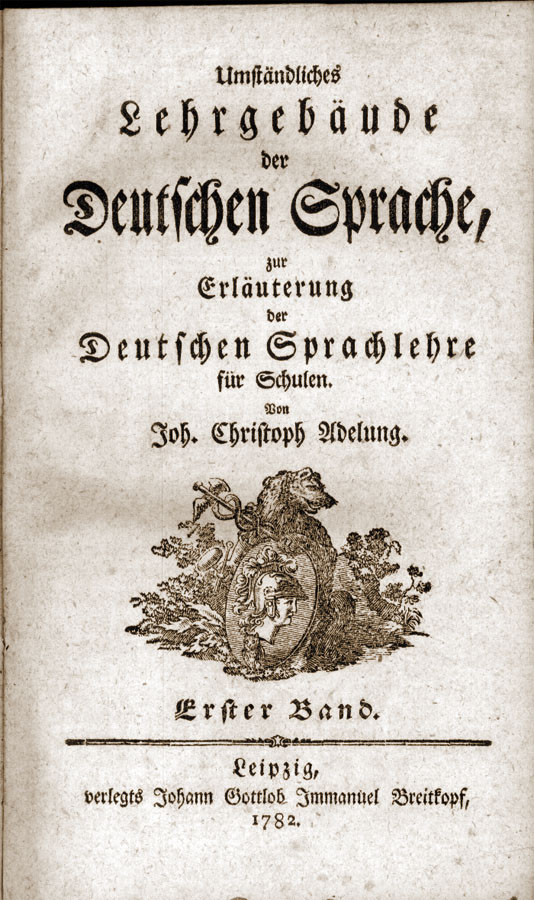
Lexikograph und Grammatiker
Johann Christoph Adelung:
Umständliches Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen. Erster Band. Und: Zweyter Band.
Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf, 1782.
Octavo. 201 × 120 mm. LX, [8], 884, [2], [2 weiße] Seiten. — [8], 798, [32], [2 weiße] Seiten. Mit Holzschnittsignets und -zierstücken.
Schlichte, mit ockerfarbenem Papier bezogene Pappbände der Zeit, Rotschnitt. Band I mit goldgeprägtem Rückenschildchen.
Erste Ausgabe. Zu Adelung cf. ADB I,83, s. u. – Adelung (1732-1806) bewirkte mit seinen zahlreichen Veröffentlichungen eine Vereinheitlichung der deutschen Orthographie und trug bei, die deutsche Sprache zu standardisieren; niemand vor den Grimms tat mehr für die Erforschung des Deutschen. Sein Wörterbuch gibt Zeugnis ab von seiner tiefen Kenntnis der verschiedenen Dialekte, was auch im dritten Kapitel des „Umständlichen Lehrgebäudes“ zu tragen kommt: Nach einer Betrachtung über die Sprache überhaupt wendet sich Adelung hier der deutschen zu und beschreibt deren Perioden sowie die Mundarten; der umfangreiche Rest des Werkes ist eine präzise Darstellung von Lautlehre, Grammatik und Orthographie, veranschaulicht jeweils durch eine Vielzahl von Beispielen.
Rückenschildchen von II fehlt, Einbände etwas fleckig und leicht bestoßen. Innen papierbedingt minimal gebräunt, wenige Seiten mit schwachen Fleckchen. Insgesamt schönes und auch breitrandiges Exemplar.
Ebert 102 – Bibliographien – elektronisches Faksimile, Band 1 – elektronisches Faksimile, Band 2.
„ADELUNG, m. vir nobilis, ahd. adalunc, und gangbarer mannsname, der wolklingende eigenname eines mannes, der voraus durch sein wörterbuch ein hohes verdienst um unsere sprache sich errungen hat.“
— Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, I,178.
Sprache überhaupt ⮵
§. 1.
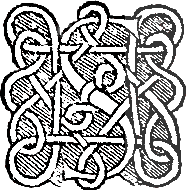 prechen heißt zwar zuweilen im weitesten Verstande, einen Ton von sich geben, in welchem man ansprechen noch von den Orgelpfeiffen braucht; allein im engsten und gewöhnlichsten Verstande ist es, seine Vorstellungen durch vernehmliche Lauté ausdrücken.
prechen heißt zwar zuweilen im weitesten Verstande, einen Ton von sich geben, in welchem man ansprechen noch von den Orgelpfeiffen braucht; allein im engsten und gewöhnlichsten Verstande ist es, seine Vorstellungen durch vernehmliche Lauté ausdrücken.
Vorstellungen entstehen aus Empfindungen, und diese sind entweder innere oder äußere. Menschen und Thiere haben das Vermögen, ihre innern Empfindungen durch jeder Art eigene und verständliche Laute auszudrucken. Diese Laute sind bey jeder Art Thiere, so wie bey dem Menschen, der Zahl nach sehr geringe, weil der innern Empfindungen nur wenige sind. Ein ach! ah! oh! ey! fi! uh! und wenige andere, siehe da das ganze Wörterbuch der menschlichen innern Empfindungen. Welch eine arme Sprache! Sie machen daher keine Sprache in engerer Bedeutung aus, und aus ihnen kann nie eine Sprache in menschlichem Verstande entstehen. Das Vermögen, äußere Empfindungen durch vernehmliche Töne auszudrucken, ist dem Menschen allein eigen, weil dazu Reflexion oder Besonnenheit gehöret; ein Vermögen, welches ihn von den Thieren unterscheidet. Man sehe Herrn Herders vortreffliche Preisschrift über den Ursprung der Sprache. Aber auch der bloße vernehmliche oder hörbare Ausdruck der äussern Empfindungen ist noch nicht Sprache im engsten Verstande, ob er gleich der Grund derselben ist; ist so wenig Sprache, als bloße einfache Empfindungen Vorstellungen und Begriffe sind. Sprache im engsten Verstande ist sowohl vernehmlicher Ausdruck der Begriffe, als auch der ganze Inbegriff solcher vernehmlichen Laute, wodurch Menschen ihre Vorstellungen ausdrücken.
Ich sage vernehmlicher, d. i. hörbarer, Ausdruck; denn es gibt noch eine andere, obgleich außerst unvollkommene Art, andern seine Vorstellungen merklich zu machen, z. B. durch Geberden. Doch das heißt deuten und nicht sprechen. Schreiben stehet dem Sprechen, aus diesem Gesichtspunkte nicht entgegen, sondern ist bloß ein Hülfsmittel, vernehmliche Töne dem Gesichte vorzumahlen, und sie dadurch dem Verstande hörbar zu machen.
§. 2.
Da es mehrere Arten gibt, seine Vorstellungen und Begriffe durch vernehmliche Laute auszudrucken, so gibt es auch mehrere und verschiedene Sprachen, und dieser ihre Verschiedenheit ist in der Natur eben so sehr gegründet, als die Verschiedenheit der Vorstellungsarten, Sitten, Cultur u. s. f. und eine allgemeine Sprache ist, wenn sie keine Grille des Stubengelehrten bleiben, sondern zu allen Zeiten und unter allen Himmelsstrichen brauchbar seyn soll, ein Unding. Nation, Volk, sind zwar vieldeutige Ausdrücke; allein dem gewöhnlichsten Sprachgebrauche nach bezeichnen sie eine Menge Menschen, welche bey einer gemeinschaftlichen Abstammung einerley Vorstellungen durch einerley Laute, und auf einerley Art ausdruckt, und dieser Begriff ist einer der bestimmtesten. Ein großes aus mehrern Stämmen, das ist, kleinern verwandten Völkern, bestehendes Volk, nennt man lieber eine Völkerschaft. Den gemeinschaftlichen Ursprung muß man hier nicht zu genau nehmen, indem alle Völker von den ältesten Zeiten an, sehr häufig mit einander vermischt worden. Die Sprache ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmahl eines Volkes. Es kann seine Sitten, seine Gebräuche, selbst seine Religion ändern, und es bleibt noch immer eben dasselbe Volk; aber man gebe ihm eine andere Sprache, so verhält sich alles ganz anders. Wer kennet noch die ehemahligen Wenden in Ober- und Niedersachsen, seitdem ihnen die Deutsche Sprache aufgedrungen worden? Sind sie nicht dadurch den Deutschen einverleibet und mit ihnen auf das unzertrennlichste zu einem Volke verbunden worden? Wer kennt noch in dem heutigen Böhmen die Überreste der alten Bojer, die, von den Slaven überwunden, ihre Sprache annahmen und dadurch alle Unterscheidungsmerkmahle bis auf die geringste Spur verlohren? Eine gemeinschaftliche Sprache setzt daher nicht allemahl einen gemeinschaftlichen Ursprung voraus, weil ein Volk dem andern seine Sprache aufdringen kann. In dieser Rücksicht auf ein gewisses bestimmtes Volk ist die Sprache derjenige Inbegriff vernehmlicher Laute, durch welche sich ein Volk seine Vorstellungen mitzutheilen pflegt. Eine solche Sprache heißt alsdann die Muttersprache eines jeden, der von diesem Volke ist.
§. 3.
Die Erfahrung lehret uns, daß Völker entstehen, verändert werden, und untergehen. Eben das gilt auch von ihren Sprachen. Sprachen, welche noch jetzt von ganzen Völkern gesprochen werden, heissen lebendige, diejenigen aber, welche nicht mehr von ganzen Völkern gesprochen werden, todte Sprachen. Es ist eine angenehme Beschäftigung, die seit dem Anfange der Geschichte bekannt gewordenen Völker und Völkerschaften mit ihren Sprachen, so weit man sie kennet, vor sich vorüber gehen zu lassen. Wie viele davon sind nicht todt, so völlig todt, daß auch nicht die geringste Spur mehr von ihnen übrig ist! Nicht so diejenigen Völker, denen wir unsere Cultur und Wissenschaften zu danken haben, und deren Sprachen wir noch unter dem Nahmen der gelehrten Sprachen kennen und studieren. Diese Völker sind, was den verbesserten Religions-Unterricht betrifft, die ehemahligen Hebräer oder Juden, in Rücksicht der weltlichen Gelehrsamkeit aber, die Griechen und Römer.
§. 4.
Sprache und Erkenntniß oder Cultur stehen in dem genauesten Verhältnisse mit einander; ein Satz, der schon aus dem Begriffe der Sprache erweislich ist. Sie ist ein vernehmlicher Ausdruck der Vorstellungen; ein Volk kann also keine andern Vorstellungen ausdrucken, als es wirklich hat, und kann sie nicht anders ausdrucken, als wie es sie hat. Ein rohes, wildes oder halb wildes Volk lebt ganz sinnlich, hat daher nur wenig Begriffe, seine Sprache erstreckt sich selten weit über die Gränzen der sinnlichen Gegenstände und Veränderungen, die es um sich hat, und sein Ausdruck derselben ist eben so hart und ungeschlacht, als seine Empfindungswerkzeuge und Sprach-Organen. Schon diese Betrachtung sollte uns abhalten, in den Ausdrücken so mancher Völker von geringer Cultur, nicht die feinen Begriffe und abstracten Vorstellungsarten zu suchen, welche so viele darin zu finden glauben; ein Fehler, welcher so oft bey den Ableitungen der Wörter und ihrer Bedeutungen begangen wird. Die Ursprünge der Wörter fallen allemahl in die rohesten Zeiten jedes Volkes, wo es keine andern als ganz sinnliche Vorstellungen hatte und haben konnte, wo folglich die sinnlichste Erklärung allemahl die wahrscheinlichste ist.
Sobald ein Volk die engen Gränzen des rohen Bedürfnisses überschreitet, sobald es anfängt, sich über das Sinnliche zu erheben, sobald es sich verfeinert, und Geschmack an Sitten, Künsten und Wissenschaften bekommt, sobald erweitert und verfeinert sich auch dessen Sprache, weil es neue Begriffe bekommt und die alten berichtigt. Zugleich verfeinert sich das äussere der Sprache, so wie Sitten und Lebensart biegsamer werden; die rauhen Töne werden mit gleich bedeutenden sanftern vertauscht, die Sprache wird durch Vervielfältigung der Partikeln runder, voller und biegsamer, sie wird immer regelmäßiger, je mehr sie geschrieben, und nicht mehr bloß dem Munde des großen Haufens überlassen wird. Alles dieses geschiehet sehr langsam, und nach und nach von dem Volke und dessen erweiterten Begriffen selbst, nicht von Sprachlehrern, welche an der Ausbildung der Sprache immer den geringsten Antheil haben.
Der höchste mögliche Wohlstand ist zugleich der erste Schritt zum Verfalle, weil jedes endliche Ding entweder zunimmt oder abnimmt. Eben das gilt von der Sprache. Äußerer Wohlstand gebieret den Lurus; auf die männliche Feinheit der Sitten, folgt weibische Verzärtelung, die Gründlichkeit weicht dem Schimmer und kindischen Putze, und die Neigung zum erkannten Wahren und Guten der Liebe zur Neuheit und zu Veränderungen, und die Sprache wird nunmehr so schlüpfrig, weich und üppig, als das Volk, welches sie spricht.
Hieraus erhellet zugleich, in wie fern sich eine Sprache fixiren lasse. Eine todte Sprache ist schon an sich fixirt genug; allein die lebendige Sprache eines ganzen Volkes fixiren wollen, heißt der immer fortschreitenden Natur Gränzen sehen wollen. Nur die Schriftsprache läßt sich fixiren, wenn der schreibende Theil einer Nation weise genug ist, den Verfall ihres Wohlstandes zu empfinden, und patriotisch genug, wenigstens ein Überbleibsel ihres ehemahligen Glanzes zu retten. Dieß ist der Fall in Italien, wo sich der bessere Theil nach den Schriftstellern des 15ten und 16ten Jahrhunderts bildet, in welchen Reichthum, Geschmack, Künste und Wissenschaften in Italien eine Höhe erreicht hatten, zu welcher sie nachmahls nie wieder gelangt sind.
§. 5.
Die Sprache eines Volkes muß also zu verschiedenen Zeiten nothwendig sehr verschieden seyn. Allein es gibt auch noch Gründe, warum sie unter den verschiedenen Theilen eines und eben desselben Volkes zu einerley Zeit verschieden seyn kann und muß. Diese Verschiedenheiten machen das aus, was man Dialecte oder Mundarten einer Sprache nennt.
Wie wichtig die Kenntniß und Beurtheilung der Sprachen in der Geschichte ist, die Abstammung und Verwandtschaft der Völker zu bestimmen und zu beurtheilen, ist nunmehr bekannt genug. Allein noch hat niemand Regeln gegeben, wornach das Verhältniß der Sprachen gegen einander beurtheilet werden müsse, oder woraus man bestimmen könnte, was Mundart, was verwandte und was verschiedene Sprache ist. Ich werde in dem Abschnitte von der Bildung der Wörter einen Versuch machen, diese Regeln zu entwerfen, so weit solches in einer Sprachlehre geschehen kann.
Der erste und vornehmste Grund der verschiedenen Mundarten ist denn doch wohl in der verschiedenen Abstammung zu suchen; indem jedes nur irgend beträchtliche Volk ursprünglich aus mehrern verwandten Stämmen bestehet, die sich im Ganzen eben so von einander unterscheiden, als jeder einzelne Mensch von dem andern verschieden ist. Mehr oder weniger Gemeinschaft unter den Stämmen, verschiedene Grade der Cultur, Clima und Boden, und andere zufällige Umstände mehr, unterhalten diese Verschiedenheit, vermehren oder vermindern sie, und können endlich aus dem, was anfänglich nur Mundart war, eine eigene sehr verschiedene Sprache machen, wenn nämlich die Trennung frühe genug und vor der völligen Ausbildung der Sprache geschiehet; und auf diese Art sind die meisten Sprachen in der Welt entstanden.
§. 6.
Man hat sich von je her sehr viele unnöthige Mühe gegeben, ausfindig zu machen, welches die erste Sprache in der Welt gewesen; weil man geglaubt, alle übrigen Sprachen müßten sich alsdann sehr leicht aus dieser ersten herleiten lassen. Allein, wenn auch diese erste Sprache ausfindig gemacht werden könnte, so ist um deßwillen die Folge noch nicht gegründet. Bey der sehr frühe geschehenen Verbreitung und Vertheilung der Familien und Stämme mußte die kaum gebildete, folglich noch sehr arme und unvollkommene Sprache sich nothwendig sehr bald in unzählige Mundarten verwandeln. Und da jede Familie oder jeder Stamm fortfuhr, die empfangenen Anfangsgründe der Sprache nach Maßgebung seines Bedürfnisses, seiner Lebensart, und seines Clima auszubilden, so mußten die Mundarten in einem beträchtlichen Zeitraume nothwendig zu eigenen Sprachen werden, welche von ihrer Ursprache endlich nichts mehr, als die ersten Wurzelwörter, aufzuweisen hatten. Die Hebräische Sprache ist freylich die älteste, von welcher wir die beträchtlichsten Überbleibsel haben; allein sie ist um deßwillen nicht die ursprüngliche. Der Abstand von ihr bis zum Ursprunge des menschlichen Geschlechts ist zu weit, und mit zu großen Veränderungen durchwebt.
Moses schrieb, da das menschliche Geschlecht, der gewöhnlichen Zeitrechnung zu Folge, schon bey nahe dritthalbtausend Jahre gesprochen, und sehr wichtige Veränderungen erlitten hatte. Es ist nicht einmahl glaublich, daß die Hebräische Sprache, so wie wir sie jetzt kennen, ganz die ist, wie sie Moses und seine nächsten Nachfolger schrieben. Von ihm bis auf den Esdras sind wenigstens tausend Jahre, und in dieser Zeit ging das jüdische Volk durch alle Grade der Cultur, von der einfältigen nomadischen Lebensart an, bis zur blühendsten Monarchie, und von da wieder bis zur niedrigsten Stufe des Verfalles. Wie sehr mußte sich nicht in diesem langen Zeitraume die Sprache des Volks ändern? Unser Deutsch, wie verschieden ist es von dem Deutsch des Rero und seiner Zeitverwandten! Und doch ist die Sprache, als Sprache betrachtet, in allen biblischen Büchern einerley.
§. 7.
Europa ist, wenigstens seinem allergrößten Theile nach, sehr frühe von dem nordöstlichen Asien aus bevölkert worden, und hier muß man daher auch die Anfangsgründe seiner Sprachen suchen. Sehr lange pflegte man die ältesten Europäischen Völker und ihre Sprachen unter zwey Haupt-Classen, der Scythischen und Celtischen, zusammen zu fassen; gerade als wenn es ehedem nur zwey Hauptsprachen in Europa gegeben, zu welcher sich alle übrigen höchstens als Mundarten verhalten hätten. Allein, da in einem Zeitraume von fast zweytausend Jahren vor der großen Völkerwanderung, so viele und so verschiedene Völkerschaften aus Asien nach Europa gewandert, und unter diesen Völkern in Europa selbst so viele und so große Veränderungen vorgegangen sind, so erhellet schon hieraus, wie viel es gewagt ist, alle diese Völker und ihre Sprachen auf zwey Haupt-Classen zu bringen. Es sind daher die Nahmen Scythisch und Celtisch in diesem Verstande in den neuesten Zeiten mit Recht verworfen worden. Cäsar fand schon zu seiner Zeit in dem heutigen Frankreich wenigstens drey Völker von verschiedener Herkunft und Sprache; Ariovist, ein Deutscher, mußte das Gallische ordentlich erlernen, (Cäs. de bello Gall. B. 1. Kap. 47.) und die neuern Untersuchungen derjenigen Provinzial-Sprachen in England, Frankreich u. s. f. welche bisher für Überbleibsel des alten Gallischen gehalten worden, beweisen es, daß diese Sprachen von der Deutschen eben so sehr verschieden sind, als sie es größtentheils unter sich sind.
§. 8.
Die heutige Deutsche, Isländische, Schwedische und Dänische Sprache, welche unter sich verwandte Sprachen sind, sind die vornehmsten und ältesten Überbleibsel der alten Europäischen Sprachen, wohin man noch die Schottisch-Irländische und die Volkssprachen mancher einzeler Provinzen in England, Spanien, Frankreich u. s. f. rechnen kann, die aber von der erstern in ihrem Bau und wesentlichen Unterscheidungsstücken mehr oder weniger abweichen.
Die alte Lateinische Sprache, welche selbst nichts weniger als eine ursprüngliche Sprache, sondern eine Vermischung der alten Ligurischen mit der Sprache der Pelasger, Hellenen, Trojaner und Hetrurer ist, ward zugleich mit der Römischen Herrschaft dem ganzen westlichen Europa aufgedrungen, und durch ihre Vermischung mit den alten Landessprachen entstanden die heutige Italienische, Französische, Spanische und Portugisische, deren jede sich wiederum in viele verschiedene Mundarten theilet. In Britannien ward die alte Volkssprache durch die Angelsächsische, einem Abkömmlinge des heutigen Niederdeutschen, verdrängt, und diese bildete sich nach dem Einfalle der Normannen, durch Vermischung mit der Französischen, in die heutige Englische um. Nur die Deutsche Sprache hat sich mit ihren nördlichen Schwestern in ihrer alten Reinigkeit zu erhalten gewußt, und sich mehr durch ihre innern Schätze bereichert und ausgebildet, als von andern erbettelt. Aber dafür hat sie von ihren leichtsinnigern Nachbaren auch mehr als einmahl den Vorwurf einer barbarischen Sprache hören müssen.
— Einleitung. I. Sprache überhaupt. pp. 3-13.
Biographie
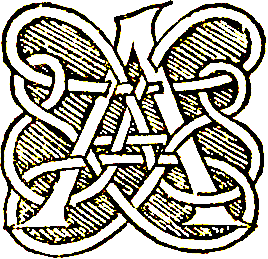 delung: Johann Christoph A., Lexikograph und Grammatiker, Predigersohn aus Spantekow (Pommern), geb. 8. Aug. 1732, besuchte die Gymnasien zu Anklam und Klosterbergen und die Universität Halle, war 1759–61 Professor am evangelischen Gymnasium zu Erfurt, privatisirte seit 1763 zu Leipzig, bis er 1787 zum Oberbibliothekar in Dresden ernannt wurde, † 10. Sept. 1806. Schon 1757 begann er eine litterarische Thätigkeit der vielseitigsten Art, die er mehr als 20 Jahre lang fortsetzte und die sich stellenweise bis zu bedenklicher Höhe steigerte. Jeder Gegenstand war ihm recht, für den er sich günstigen Markt versprechen durfte. Eine Reihe von Publicationen folgen der Zeitgeschichte von 1740 bis zum baierischen Erbfolgekriege auf dem Fuße nach und richten die Ereignisse gleich fürs große Publicum her; trockene Thatsachenhäufung, durch den seichtesten Pragmatismus verbunden; Sammelwerke der Staatsacten, politische Briefe etc. traten ergänzend hinzu. Seine Uebersetzerthätigkeit war massenhaft und erstreckte sich auf alle Gebiete des menschlichen Wissens, auf Diplomatik so gut wie auf Metallurgie, auf die Werke des Philosophen von Sanssouci so gut wie auf englische und französische Geschichtsbücher. Als Journalist war er nicht minder universell: er schrieb mehrere Jahre hindurch die Leipziger politische Zeitung und das damit verbundene Allerlei; er gab mineralogische Belustigungen, ja ein militärisches Taschenbuch heraus; er ist der Begründer des Weiße’schen Kinderfreunds, und noch 1785–86 dirigirte er die Leipziger Gelehrte Zeitung. Selbst litterarische Handlangerdienste, wie das allgemeine Verzeichniß neuer Bücher zusammenzustellen, verschmähte er nicht. Er bearbeitete eine Geschichte der Philosophie (und Mathematik) für Liebhaber, und unter dem picanten Titel einer Geschichte der menschlichen Narrheit hat er Männer und Frauen verunglimpft, welche zu den edelsten Erscheinungen der Menschheit gehören: es sollte dem geschmackvollen und aufgeklärten Weltmanne der 80er Jahre schmeicheln, auf jene „Schwärmer“ vornehm herabblicken zu können. A. besaß den Instinct für das Zeitgemäße und einen ordnenden Verstand, der leicht und sicher wie eine Maschine wirkte und sich nirgends gehindert sah, weder durch Tiefsinn, noch durch die Phantasie. Er besaß eine ausgebreitete Bücherkenntniß und ein entschiedenes Talent zu generalisiren und zu simplificiren. Als eigentlicher Gelehrter kann er nur in mittelalterlicher Latinität (Zusätze zu seinem Compendium des Ducange, Glossarium manuale, 1772–84), in Gelehrtengeschichte (Fortsetzung des Jöcher 1784–87) und auf dem Gebiete der Sprache gelten. Ueberall aber ist er mehr Sammler und Ordner, als Forscher. Lehrbücher abzufassen war er höchst geeignet. Seine „Unterweisung in den vornehmsten Künsten und Wissenschaften“ (1771) war für die niederen Schulen bestimmt und erlebte mehrere Auflagen; daraus entwickelte sich sein „Kurzer Begriff menschlicher Fertigkeiten“ (1778–81) für Realschulen, und dieser lief in eine „Geschichte der Cultur“ aus, welche etwas erweitert 1782 auch selbständig erschien. Diesen Titel, den Namen also der Culturgeschichte, scheint er eingeführt zu haben anstatt des bis dahin üblichen „Geschichte der Menschheit“. Die Form solcher Betrachtungen war durch Voltaire, die Methode hauptsächlich durch Montesquieu, in Deutschland durch Winckelmann in Schwung gekommen: A. faßt nur zusammen und formulirt. Aber er verlangt, die Culturgeschichte solle den Grund nicht blos der Universalgeschichte, sondern auch der Gelehrten- und Religionsgeschichte ausmachen, und das Buch gibt ihm seine eigenthümliche Stellung innerhalb der deutschen Aufklärung. Weit mehr thut dies freilich noch sein „Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart“ 1774 bis 86. Daran schlossen sich grammatische Werke „Deutsche Sprachlehre für Schulen, zunächst für die preußischen“, 1781 (Auszug daraus, 1781), „Umständliches Lehrgebäude“ (1782) und eine „Stylistik“ (1785–86); das „Magazin für die deutsche Sprache“ (1783–84) ging als rechtfertigende und erläuternde Zeitschrift nebenher. Mit diesen Leistungen erhob sich A. endlich über sein bisheriges Litteratenthum, ja er vertiefte sich in seiner Weise von dem festen Halt aus, den er nun ergriffen: der Plan einer Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur wurde gefaßt, das Studium der altdeutschen Dichter lebhafter betrieben („Chronol. Verzeichniß der schwäb. Dichter“ 1784, „Püterich von Reicherzhausen“ 1788) und alle Sprachen der Erde in den Kreis seiner gelehrten Thätigkeit gezogen. Da bestimmten ihn in Dresden, wer weiß welche Rücksichten, sich auf sächsische Geschichte zu werfen und riesenhafte Materialien für ein Unternehmen aufzuhäufen, von welchem dann doch nur einzelne Bruchstücke zu Tage kamen. Daneben erhielt nur die zweite Auflage des Wörterbuchs (1793–1801) wesentliche Bereicherung und Verbesserung, und in seinem Todesjahre erschienen die ersten Anfänge jener Sprach- und Litteraturgeschichte als „Aelteste Geschichte der Deutschen“, jener allgemeinen Sprachkunde als „Mithridates“ Bd. 1, die asiatischen Sprachen umfassend. Mit Benutzung des hinterlassenen Stoffes und unter Betheiligung Wilhelm v. Humboldt’s und Friedrich Adelung’s ließ Vater die europäischen, afrikanischen und amerikanischen Sprachen folgen. Wie wenig auch für eine wissenschaftliche Zergliederung gethan war, das Werk hat Segen gestiftet, wäre es auch nur durch den Gebrauch, den Humboldt davon machen konnte, und ist noch durch kein ähnliches ersetzt. – Adelung’s sprachliche Arbeiten haben eine theoretische und eine praktische Seite. In jener Hinsicht strebt er die höchsten Forderungen der damaligen Wissenschaft zu erfüllen; in dieser bemüht er sich um das Richtige, um die richtige Sprache, um den richtigen Stil. Er will dabei nicht Gesetzgeber sein, aber er läßt sich das Gesetz von der hochdeutschen, d. h. für ihn von der obersächsischen Mundart dictiren. Er versichert zwar 1781 einmal, er sei weder der Geburt noch der Verbindung nach ein Kursachse, sondern ein freier Weltbürger, und blos die deutlich erkannte Wahrheit leite ihn. Aber in der That war es die Beschränktheit seines moralischen und ästhetischen Standpunkts, welche ihn leitete. Gellert stand ihm höher als Klopstock und Goethe. Gellert war ganz eigentlich sein Classiker. Die Sprache, den Stil, den Geschmack des Gellertschen Zeitalters wollte er schützen gegen die Neuerer, wie Voltaire die Sprache des Siècle de Louis XIV. gegen Rousseau und seinesgleichen. Adelung’s Theorie der Cultur, sowie die Analogie auswärtiger Schriftsprachen schienen ihm Recht zu geben. In Griechenland, im alten wie im neuen Italien, in Frankreich, in der altdeutschen Zeit, überall habe sich die Mundart der cultivirtesten Provinz zur Schriftsprache erhoben. Was aber ist Cultur? Auf den ursprünglichen sinnlichen Menschen wirkt nur die dunkle Empfindung des Bedürfnisses. Dies entsteht durch Volksmenge im beschränkten Raum, durch engeres sociales Leben. Cultur und Bevölkerung wachsen mit einander vom kleinsten denkbaren Anfang an in geometrischer Progression. Die wachsende Bevölkerung verlangt immer intensivere Wirthschaft, nach der Reihe entstehen Jäger- und Hirtenleben, Ackerbau, Handel, Gewerbe: Wohlstand, Bequemlichkeit und Ueberfluß erzeugen erst die Poesie, dann die bildende Kunst, endlich die Wissenschaft. Der Staat wird blühend, aber nun reißt auch Luxus ein und mit ihm kommt Verderben der Sitten, Ueppigkeit, Krankheiten, kurz der Verfall. In Deutschland war die Zeit der schwäbischen Dichter eine solche Blütheperiode, und von der Reformation ab stellen sich die Bedingungen der Cultur in Obersachsen ein, der obersächsische Dialekt wird Schriftsprache, Gellert und seine Genossen bezeichnen einen neuen Höhepunkt, jetzt aber werden Symptome des Verfalls bereits sichtbar. A. wünscht ihn aufzuhalten, auch er ist gegen Rousseau, gegen die Physiognomik, gegen die Nachbildung antiker Metren, gegen die Ueberschätzung des bloßen Genies, ebenso aber gegen allzu große Aufklärung des Volkes und in aller Zahmheit auch ein wenig gegen den Staat Friedrichs des Großen. Er ist für positive Religion, aber nicht für das officielle sächsische Lutherthum. Er ist ein gemäßigter Conservativer in Politik, Religion, Litteratur und Sprache. Adelung’s Wörterbuch hat durchaus die Aufgabe, welche sich alle Wörterbücher aller europäischen Nationen früher stellten: es soll eine Codification sein. Die Sprache der guten Schriftsteller soll sich bequem überschauen lassen; nichts veraltetes, nichts provinzielles soll darin vorkommen, außer höchstens mit beigefügter Warnung. Bei jedem Wort erfahren wir Aussprache, Orthographie, Flexion, Construction und Gebrauch, namentlich die Stilart, der es entspricht. Bestimmte Angabe des Begriffes und der verschiedenen Bedeutungen sorgt für die Verbreitung klarer und deutlicher Begriffe, dieses wichtigste Requisit der Aufklärung. Ein mäßiger verständiger Purismus wacht über der Reinheit des nationalen Idioms. Die Etymologie sucht, anknüpfend an Wachter, Frisch, hauptsächlich aber an Fulda, unter Herbeiziehung der übrigen germanischen Sprachen das wissenschaftliche Interesse am Wort zu befriedigen. Es war ein den Zeitgenossen geläufiges Compliment, A. habe als einzelner Mann geleistet, was sonst nur ganzen Akademien gelungen sei. Oder erinnerte man sich an Samuel Johnson’s ähnliche Verdienste um das Englische, so glaubte man dem Landsmanne in wesentlichen Punkten den Preis ertheilen zu dürfen. Die etymologischen Versuche leiten zu Adelung’s Grammatik über: sie ist ganz durchsetzt von der Ansicht über den Ursprung und die Entwickelung der Sprache, welche er mit leichter Modification aus Herder entnahm und mit seiner Culturtheorie in Einklang brachte. Sprache und Erkenntniß sind gleichen Schritt gegangen, vom Dunklen zum Klaren. In der sinnlichen Epoche der Menschheit ist die Sprache entstanden, aus dem sinnlichen Zustand der Seele muß man die Erklärung für ihre ursprünglichsten Erscheinungen suchen. A. führt alle deutschen Wörter unmittelbar auf den Anfang zurück, auf jene Nachahmung natürlicher Schälle, jene Abbilder der tönenden Natur, welche er neben den Empfindungslauten für die Grundlage aller Sprachen hält. Er glaubt das Fundament der Etymologie als Wissenschaft gelegt zu haben. Die Consonanten, deren Bedeutung er charakterisirt, sind der wesentlichste Theil jedes Wortes, die Vocale, welche von u bis i eine Art natürlicher Tonleiter bilden, drücken nur Höhe und Tiefe aus. Die ältesten Redetheile sind Interjection und Adverbium, die älteste Epoche kennt nur unverbundene einsilbige Wurzelwörter. Aus dunkler Empfindung der Arten der Begriffe, der Kategorien des Dinges, des Handelns etc. entsteht Flexion und Ableitung. In der Lehre von den Redetheilen hatte ihm Meiner (Philos. Sprachlehre, 1781) vorgearbeitet, ebenso in der trefflichen Satzlehre. A. will die deutsche Sprache rein aus sich, unabhängig von der lateinischen Grammatik darstellen, aber es begegnet ihm infolge dessen, daß er z. B. das flexionslose Adjectiv als Adverbium ansieht. Er erhebt die Forderung historischer Sprachbetrachtung, aber ohne zu ahnen, was darin liegt. Die Anerkennung der Grammatik als einer selbständigen, von philosophischem Geiste getragenen Wissenschaft war das große Ziel, das ihm vorschwebte. Ebenso consequent stellt er ferner die Lehre vom Stil als ein wissenschaftliches Ganzes auf. Auch hier geht er überall auf die „ersten Gründe“ zurück, und psychologische Gesichtspunkte werden geschickt verwerthet, die Redefiguren z. B. eingetheilt nach den verschiedenen Seelenkräften auf die sie wirken. Vor allem aber sucht er auch hier für seine geliebten Obersachsen zu wirken und die Neuerer herabzudrücken, deren Vorzug nur in der größeren Lebhaftigkeit des Stils bestehe. Das Sächsische war entschieden seine Achillesferse. Die Begünstigung der Obersachsen brachte ihn auch mit denjenigen in Zwiespalt, welche sonst in einer Linie mit ihm standen oder seine Verdienste laut anerkannten, mit den Berlinern und mit Wieland. Später (1804) griff ihn Voß auf das heftigste an. Kein geringerer aber als Jacob Grimm hat dies eine Ungerechtigkeit genannt und die treue und fruchtbare Arbeit des Mannes in Schutz genommen. Doch war es gerade Jacob Grimm, der wie Lavoisier alle seine Vorgänger so sehr verdunkelte, daß sie nur mehr als schattenhafte Namen fortleben. Pflicht der Geschichte ist es, A. nicht an seinem großen Nachfolger, sondern an seinen eigenen Vorgängern zu messen. Und dann blüht auch für ihn ein bescheidener, aber unverwelklicher Lorber. An consequenter lichtvoller Durchbildung seiner Ansichten aus einem großen anthropologischen Zusammenhange heraus ist ihm noch niemand gleich gekommen; und Gesetze für die Praxis zu finden, haben wir allzu sehr verlernt. Es war nur in der Ordnung, daß Adelung’s Lehre die Schulen von ganz Deutschland eine Zeit lang beherrschte.
delung: Johann Christoph A., Lexikograph und Grammatiker, Predigersohn aus Spantekow (Pommern), geb. 8. Aug. 1732, besuchte die Gymnasien zu Anklam und Klosterbergen und die Universität Halle, war 1759–61 Professor am evangelischen Gymnasium zu Erfurt, privatisirte seit 1763 zu Leipzig, bis er 1787 zum Oberbibliothekar in Dresden ernannt wurde, † 10. Sept. 1806. Schon 1757 begann er eine litterarische Thätigkeit der vielseitigsten Art, die er mehr als 20 Jahre lang fortsetzte und die sich stellenweise bis zu bedenklicher Höhe steigerte. Jeder Gegenstand war ihm recht, für den er sich günstigen Markt versprechen durfte. Eine Reihe von Publicationen folgen der Zeitgeschichte von 1740 bis zum baierischen Erbfolgekriege auf dem Fuße nach und richten die Ereignisse gleich fürs große Publicum her; trockene Thatsachenhäufung, durch den seichtesten Pragmatismus verbunden; Sammelwerke der Staatsacten, politische Briefe etc. traten ergänzend hinzu. Seine Uebersetzerthätigkeit war massenhaft und erstreckte sich auf alle Gebiete des menschlichen Wissens, auf Diplomatik so gut wie auf Metallurgie, auf die Werke des Philosophen von Sanssouci so gut wie auf englische und französische Geschichtsbücher. Als Journalist war er nicht minder universell: er schrieb mehrere Jahre hindurch die Leipziger politische Zeitung und das damit verbundene Allerlei; er gab mineralogische Belustigungen, ja ein militärisches Taschenbuch heraus; er ist der Begründer des Weiße’schen Kinderfreunds, und noch 1785–86 dirigirte er die Leipziger Gelehrte Zeitung. Selbst litterarische Handlangerdienste, wie das allgemeine Verzeichniß neuer Bücher zusammenzustellen, verschmähte er nicht. Er bearbeitete eine Geschichte der Philosophie (und Mathematik) für Liebhaber, und unter dem picanten Titel einer Geschichte der menschlichen Narrheit hat er Männer und Frauen verunglimpft, welche zu den edelsten Erscheinungen der Menschheit gehören: es sollte dem geschmackvollen und aufgeklärten Weltmanne der 80er Jahre schmeicheln, auf jene „Schwärmer“ vornehm herabblicken zu können. A. besaß den Instinct für das Zeitgemäße und einen ordnenden Verstand, der leicht und sicher wie eine Maschine wirkte und sich nirgends gehindert sah, weder durch Tiefsinn, noch durch die Phantasie. Er besaß eine ausgebreitete Bücherkenntniß und ein entschiedenes Talent zu generalisiren und zu simplificiren. Als eigentlicher Gelehrter kann er nur in mittelalterlicher Latinität (Zusätze zu seinem Compendium des Ducange, Glossarium manuale, 1772–84), in Gelehrtengeschichte (Fortsetzung des Jöcher 1784–87) und auf dem Gebiete der Sprache gelten. Ueberall aber ist er mehr Sammler und Ordner, als Forscher. Lehrbücher abzufassen war er höchst geeignet. Seine „Unterweisung in den vornehmsten Künsten und Wissenschaften“ (1771) war für die niederen Schulen bestimmt und erlebte mehrere Auflagen; daraus entwickelte sich sein „Kurzer Begriff menschlicher Fertigkeiten“ (1778–81) für Realschulen, und dieser lief in eine „Geschichte der Cultur“ aus, welche etwas erweitert 1782 auch selbständig erschien. Diesen Titel, den Namen also der Culturgeschichte, scheint er eingeführt zu haben anstatt des bis dahin üblichen „Geschichte der Menschheit“. Die Form solcher Betrachtungen war durch Voltaire, die Methode hauptsächlich durch Montesquieu, in Deutschland durch Winckelmann in Schwung gekommen: A. faßt nur zusammen und formulirt. Aber er verlangt, die Culturgeschichte solle den Grund nicht blos der Universalgeschichte, sondern auch der Gelehrten- und Religionsgeschichte ausmachen, und das Buch gibt ihm seine eigenthümliche Stellung innerhalb der deutschen Aufklärung. Weit mehr thut dies freilich noch sein „Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart“ 1774 bis 86. Daran schlossen sich grammatische Werke „Deutsche Sprachlehre für Schulen, zunächst für die preußischen“, 1781 (Auszug daraus, 1781), „Umständliches Lehrgebäude“ (1782) und eine „Stylistik“ (1785–86); das „Magazin für die deutsche Sprache“ (1783–84) ging als rechtfertigende und erläuternde Zeitschrift nebenher. Mit diesen Leistungen erhob sich A. endlich über sein bisheriges Litteratenthum, ja er vertiefte sich in seiner Weise von dem festen Halt aus, den er nun ergriffen: der Plan einer Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur wurde gefaßt, das Studium der altdeutschen Dichter lebhafter betrieben („Chronol. Verzeichniß der schwäb. Dichter“ 1784, „Püterich von Reicherzhausen“ 1788) und alle Sprachen der Erde in den Kreis seiner gelehrten Thätigkeit gezogen. Da bestimmten ihn in Dresden, wer weiß welche Rücksichten, sich auf sächsische Geschichte zu werfen und riesenhafte Materialien für ein Unternehmen aufzuhäufen, von welchem dann doch nur einzelne Bruchstücke zu Tage kamen. Daneben erhielt nur die zweite Auflage des Wörterbuchs (1793–1801) wesentliche Bereicherung und Verbesserung, und in seinem Todesjahre erschienen die ersten Anfänge jener Sprach- und Litteraturgeschichte als „Aelteste Geschichte der Deutschen“, jener allgemeinen Sprachkunde als „Mithridates“ Bd. 1, die asiatischen Sprachen umfassend. Mit Benutzung des hinterlassenen Stoffes und unter Betheiligung Wilhelm v. Humboldt’s und Friedrich Adelung’s ließ Vater die europäischen, afrikanischen und amerikanischen Sprachen folgen. Wie wenig auch für eine wissenschaftliche Zergliederung gethan war, das Werk hat Segen gestiftet, wäre es auch nur durch den Gebrauch, den Humboldt davon machen konnte, und ist noch durch kein ähnliches ersetzt. – Adelung’s sprachliche Arbeiten haben eine theoretische und eine praktische Seite. In jener Hinsicht strebt er die höchsten Forderungen der damaligen Wissenschaft zu erfüllen; in dieser bemüht er sich um das Richtige, um die richtige Sprache, um den richtigen Stil. Er will dabei nicht Gesetzgeber sein, aber er läßt sich das Gesetz von der hochdeutschen, d. h. für ihn von der obersächsischen Mundart dictiren. Er versichert zwar 1781 einmal, er sei weder der Geburt noch der Verbindung nach ein Kursachse, sondern ein freier Weltbürger, und blos die deutlich erkannte Wahrheit leite ihn. Aber in der That war es die Beschränktheit seines moralischen und ästhetischen Standpunkts, welche ihn leitete. Gellert stand ihm höher als Klopstock und Goethe. Gellert war ganz eigentlich sein Classiker. Die Sprache, den Stil, den Geschmack des Gellertschen Zeitalters wollte er schützen gegen die Neuerer, wie Voltaire die Sprache des Siècle de Louis XIV. gegen Rousseau und seinesgleichen. Adelung’s Theorie der Cultur, sowie die Analogie auswärtiger Schriftsprachen schienen ihm Recht zu geben. In Griechenland, im alten wie im neuen Italien, in Frankreich, in der altdeutschen Zeit, überall habe sich die Mundart der cultivirtesten Provinz zur Schriftsprache erhoben. Was aber ist Cultur? Auf den ursprünglichen sinnlichen Menschen wirkt nur die dunkle Empfindung des Bedürfnisses. Dies entsteht durch Volksmenge im beschränkten Raum, durch engeres sociales Leben. Cultur und Bevölkerung wachsen mit einander vom kleinsten denkbaren Anfang an in geometrischer Progression. Die wachsende Bevölkerung verlangt immer intensivere Wirthschaft, nach der Reihe entstehen Jäger- und Hirtenleben, Ackerbau, Handel, Gewerbe: Wohlstand, Bequemlichkeit und Ueberfluß erzeugen erst die Poesie, dann die bildende Kunst, endlich die Wissenschaft. Der Staat wird blühend, aber nun reißt auch Luxus ein und mit ihm kommt Verderben der Sitten, Ueppigkeit, Krankheiten, kurz der Verfall. In Deutschland war die Zeit der schwäbischen Dichter eine solche Blütheperiode, und von der Reformation ab stellen sich die Bedingungen der Cultur in Obersachsen ein, der obersächsische Dialekt wird Schriftsprache, Gellert und seine Genossen bezeichnen einen neuen Höhepunkt, jetzt aber werden Symptome des Verfalls bereits sichtbar. A. wünscht ihn aufzuhalten, auch er ist gegen Rousseau, gegen die Physiognomik, gegen die Nachbildung antiker Metren, gegen die Ueberschätzung des bloßen Genies, ebenso aber gegen allzu große Aufklärung des Volkes und in aller Zahmheit auch ein wenig gegen den Staat Friedrichs des Großen. Er ist für positive Religion, aber nicht für das officielle sächsische Lutherthum. Er ist ein gemäßigter Conservativer in Politik, Religion, Litteratur und Sprache. Adelung’s Wörterbuch hat durchaus die Aufgabe, welche sich alle Wörterbücher aller europäischen Nationen früher stellten: es soll eine Codification sein. Die Sprache der guten Schriftsteller soll sich bequem überschauen lassen; nichts veraltetes, nichts provinzielles soll darin vorkommen, außer höchstens mit beigefügter Warnung. Bei jedem Wort erfahren wir Aussprache, Orthographie, Flexion, Construction und Gebrauch, namentlich die Stilart, der es entspricht. Bestimmte Angabe des Begriffes und der verschiedenen Bedeutungen sorgt für die Verbreitung klarer und deutlicher Begriffe, dieses wichtigste Requisit der Aufklärung. Ein mäßiger verständiger Purismus wacht über der Reinheit des nationalen Idioms. Die Etymologie sucht, anknüpfend an Wachter, Frisch, hauptsächlich aber an Fulda, unter Herbeiziehung der übrigen germanischen Sprachen das wissenschaftliche Interesse am Wort zu befriedigen. Es war ein den Zeitgenossen geläufiges Compliment, A. habe als einzelner Mann geleistet, was sonst nur ganzen Akademien gelungen sei. Oder erinnerte man sich an Samuel Johnson’s ähnliche Verdienste um das Englische, so glaubte man dem Landsmanne in wesentlichen Punkten den Preis ertheilen zu dürfen. Die etymologischen Versuche leiten zu Adelung’s Grammatik über: sie ist ganz durchsetzt von der Ansicht über den Ursprung und die Entwickelung der Sprache, welche er mit leichter Modification aus Herder entnahm und mit seiner Culturtheorie in Einklang brachte. Sprache und Erkenntniß sind gleichen Schritt gegangen, vom Dunklen zum Klaren. In der sinnlichen Epoche der Menschheit ist die Sprache entstanden, aus dem sinnlichen Zustand der Seele muß man die Erklärung für ihre ursprünglichsten Erscheinungen suchen. A. führt alle deutschen Wörter unmittelbar auf den Anfang zurück, auf jene Nachahmung natürlicher Schälle, jene Abbilder der tönenden Natur, welche er neben den Empfindungslauten für die Grundlage aller Sprachen hält. Er glaubt das Fundament der Etymologie als Wissenschaft gelegt zu haben. Die Consonanten, deren Bedeutung er charakterisirt, sind der wesentlichste Theil jedes Wortes, die Vocale, welche von u bis i eine Art natürlicher Tonleiter bilden, drücken nur Höhe und Tiefe aus. Die ältesten Redetheile sind Interjection und Adverbium, die älteste Epoche kennt nur unverbundene einsilbige Wurzelwörter. Aus dunkler Empfindung der Arten der Begriffe, der Kategorien des Dinges, des Handelns etc. entsteht Flexion und Ableitung. In der Lehre von den Redetheilen hatte ihm Meiner (Philos. Sprachlehre, 1781) vorgearbeitet, ebenso in der trefflichen Satzlehre. A. will die deutsche Sprache rein aus sich, unabhängig von der lateinischen Grammatik darstellen, aber es begegnet ihm infolge dessen, daß er z. B. das flexionslose Adjectiv als Adverbium ansieht. Er erhebt die Forderung historischer Sprachbetrachtung, aber ohne zu ahnen, was darin liegt. Die Anerkennung der Grammatik als einer selbständigen, von philosophischem Geiste getragenen Wissenschaft war das große Ziel, das ihm vorschwebte. Ebenso consequent stellt er ferner die Lehre vom Stil als ein wissenschaftliches Ganzes auf. Auch hier geht er überall auf die „ersten Gründe“ zurück, und psychologische Gesichtspunkte werden geschickt verwerthet, die Redefiguren z. B. eingetheilt nach den verschiedenen Seelenkräften auf die sie wirken. Vor allem aber sucht er auch hier für seine geliebten Obersachsen zu wirken und die Neuerer herabzudrücken, deren Vorzug nur in der größeren Lebhaftigkeit des Stils bestehe. Das Sächsische war entschieden seine Achillesferse. Die Begünstigung der Obersachsen brachte ihn auch mit denjenigen in Zwiespalt, welche sonst in einer Linie mit ihm standen oder seine Verdienste laut anerkannten, mit den Berlinern und mit Wieland. Später (1804) griff ihn Voß auf das heftigste an. Kein geringerer aber als Jacob Grimm hat dies eine Ungerechtigkeit genannt und die treue und fruchtbare Arbeit des Mannes in Schutz genommen. Doch war es gerade Jacob Grimm, der wie Lavoisier alle seine Vorgänger so sehr verdunkelte, daß sie nur mehr als schattenhafte Namen fortleben. Pflicht der Geschichte ist es, A. nicht an seinem großen Nachfolger, sondern an seinen eigenen Vorgängern zu messen. Und dann blüht auch für ihn ein bescheidener, aber unverwelklicher Lorber. An consequenter lichtvoller Durchbildung seiner Ansichten aus einem großen anthropologischen Zusammenhange heraus ist ihm noch niemand gleich gekommen; und Gesetze für die Praxis zu finden, haben wir allzu sehr verlernt. Es war nur in der Ordnung, daß Adelung’s Lehre die Schulen von ganz Deutschland eine Zeit lang beherrschte.
— Wilhelm Scherer in: Allgemeine Deutsche Biographie, Band 1, pp. 80–84.

Hugo von Hofmannsthal:
Wert und Ehre deutscher Sprache. In Zeugnissen herausgegeben.
München: Verlag der Bremer Presse, 1927.
Octavo. 279, [15], [2 weiße] Seiten. Titel und Initialen von Anna Simons.
Original-Leinwand mit Rückenvergoldung, brauner Kopfschnitt.
Von Hofmannsthal herausgegebene Sammlung aus Schriften deutscher Philosophen und Dichter: Justus Georg von Schottel, Leibniz, Justus Möser, Wieland, Herder, Goethe, Jean Paul, Wilhelm von Humboldt, Fichte, Adam Müller, Ernst Moritz Arndt und Jacob Grimm. Gedruckt bei Meisenbach Riffarth & Co., München, auf Zanders Alfa Papier. Den Titel, siehe oben, und die Initialen hat Anna´Simons gezeichnet.
Erste Ausgabe. Lehnacker 81 - Jacoby 93 - Houghton Lib. 762 - Weber XI,15.1 - Schauer II,71 - Wilpert/Gühring2 116.
Hugo von Hofmannsthal: Vorrede des Herausgebers
 enkt man über das Geschick und die Beschaffenheit unserer Sprache nach, so tritt dies entgegen: wir haben eine sehr hohe dichterische Sprache und sehr liebliche und ausdrucksstarke Volksdialekte, von denen die Sprache des Umgangs in allen deutschen Landschaften verschiedentlich angefärbt ist. Woran es uns mangelt, das ist die mittlere Sprache, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, in der sich die Geselligkeit der Volksglieder untereinander auswirkt. Unsere Nachbarn, Nord und Süd, Ost und West, haben sie; wir allein sind ihrer entbehrend. In dieser mittleren Sprache aber faßt sich allezeit das Gesicht einer Nation zusammen; — noch einer nicht mehr gegenwärtigen Nation: die Miene der Römer erkennen wir in den Sprachen, die von der mittleren Römersprache abgeleitet sind. Die deutsche Nation aber hat für den Blick der andern kein Gesicht; davon kommt viel Mißtrauen, Unruhe, Nichtverstehen, geringe Würdigung, ja sogar Haß und Verachtung; aber das muß getragen werden, da es zum Schicksal gehört.
enkt man über das Geschick und die Beschaffenheit unserer Sprache nach, so tritt dies entgegen: wir haben eine sehr hohe dichterische Sprache und sehr liebliche und ausdrucksstarke Volksdialekte, von denen die Sprache des Umgangs in allen deutschen Landschaften verschiedentlich angefärbt ist. Woran es uns mangelt, das ist die mittlere Sprache, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, in der sich die Geselligkeit der Volksglieder untereinander auswirkt. Unsere Nachbarn, Nord und Süd, Ost und West, haben sie; wir allein sind ihrer entbehrend. In dieser mittleren Sprache aber faßt sich allezeit das Gesicht einer Nation zusammen; — noch einer nicht mehr gegenwärtigen Nation: die Miene der Römer erkennen wir in den Sprachen, die von der mittleren Römersprache abgeleitet sind. Die deutsche Nation aber hat für den Blick der andern kein Gesicht; davon kommt viel Mißtrauen, Unruhe, Nichtverstehen, geringe Würdigung, ja sogar Haß und Verachtung; aber das muß getragen werden, da es zum Schicksal gehört.
Die mittleren Sprachen der anderen besitzen eine glatte Fügung in der das einzelne Wort nicht zu wuchtig noch zu grell hervortritt. An den Hörer soll gar nicht das Wort herandringen mit seiner magischen Eigenkraft, sondern die Verbindungen, das in jedem Wort Mitverstandene, das mimische Element der Rede. Nicht sowohl der Einzelne, der zu ihm redet, soll ihm zunächst fühlbar werden, als das gesellige Element, worin sich beide, der Redende und der Angeredete zusammen wissen; von dem Einzelnen, der ihm gegenübersteht, nicht so sehr dessen Sich-Unterscheiden, nicht der individuelle Anspruch, der ja leicht zu Ablehnung herausfordert, sondern die Verflochtenheit gemäß der ein jeder zu den Gruppierungen innerhalb der Gesamtheit, den Einrichtungen, den Unternehmungen in gewissen typischen Verhältnissen steht. Nicht so sehr das was er für sich ist, soll in seiner Sprache sich ausprägen, als das was er vorstellt. In seinem Sprechen repräsentiert sich der Einzelne, in der ganzen Sprache repräsentiert sich die Gesamtheit. Es herrscht in einer solchen Umgangsrede zwischen den Worten ein Etwas, daß sie untereinander gleichsam Familie bilden, wobei sie alle gleichmäßig verzichten, ihr Tiefstes auszusagen. Ihre Anklänge und Wechselbezüge kommen mehr zur Geltung als ihr Urlaut.
Unsere gegenwärtige deutsche Verkehrssprache hingegen ist ein Conglomerat von Individualsprachen. In einer Individualsprache ringen die Worte um ihr höchstes Eigenleben, das sie nie völlig erlangen können, sie wollen sozusagen in ihr statisches Gleichgewicht zurück, und schwanken in sich selber. Nur das Individuum mit seiner Magie vermag sie fallweise zu bändigen. Dies aber ist unübertragbar. Darum kann man deutsch nicht korrekt schreiben. Man kann nur individuell schreiben, oder man schreibt schon schlecht. An Stelle einer geselligen Sprache haben wir, da doch etwas da sein muß, eine Gebrauchssprache hervorgebracht, in der die Dialekte — wenn auch nicht alle gleichmäßig — zusammentraten; es ist wie ein See, dessen Wasser schal schmecken würde, brächten ihm nicht die immer zuströmenden Quellen etwas von ihrer Schmackhaftigkeit. Aber wie alles aus dem Ursprünglichen Abgezogene — wo nicht ein gewaltiger geistiger Schwung immer wieder dreinfährt — hat diese Verkehrssprache viele Laster. Sie will mehr und weniger als sie kann; es stecken zu viele philosophische ausgebildete Begriffe in ihr, die nur durch eine unablässige Aufmerksamkeit treffend scharf erhalten werden könnten, so aber bald der Verwahrlosung anheimfallen, bald der Pedanterie oder der Affektation Nahrung geben. Bald macht sich eine Eigenbrötelei geltend, die auch niemals frei ist von Affektation, bald die Überlust am Annehmen fremder Naturen. Die Sprache ist voller zerriebener Eitelkeiten, falscher Titanismen, voller Schwächen, die sich für Stärken ausgeben möchten. Man mag hundert Bücher, Abhandlungen, Zeitungsblätter in die Hand nehmen, und wird in ihrer Sprache das Volk nicht finden, nicht seine Zufriedenheit mit sich selbst, das Behagliche, noch sein Tiefes, Starkes — noch das Einfache, welches das Höchste wäre; noch aber auch wird man aus dieser Bücher- und Zeitungssprache die Anschauung einer großen Nation gewinnen, ja nicht die Ahnung von ihrer Haltung, ihrer eigentlichen und eigenartigen Präsenz.
Wo aber ist dann die Nation zu finden! Einzig in den hohen Sprachdenkmälern und in den Volksdialekten. Die einen und die anderen stehen in Wechselbezug. In den Dialekten deutet der Naturlaut schattenhaft auf hohe Sprachgeburten, in den hohen Denkmälern blickt das Naturhafte hindurch — in beiden zusammen ist die Nation; aber wie unsicher und zerrissen ist dieser Zustand, wie bedarf er des Schlüssels der Vertrautheit, um einem solchen Volk ins Innere zu dringen!
Die poetische Sprache der Deutschen vermag in eine sehr erhabene Region aufzusteigen. Dort wo sie zuhöchst schwebt, in Goethes vorzüglichsten lyrischen Stücken, in Hölderlins letzten Elegien und Hymnen, dort wird sie kaum von einer der neueren Nationen erreicht — vielleicht daß selbst Miltons Flügelschlag dahinter zurückbleibt. Hier wird jenes «Griechische» der deutschen Sprache wirksam, jenes Äußerste an freier Schönheit. Die «glatte» und die «rauhe» Fügung vermögen in dieser Region kaum mehr unterschieden zu werden, alles was dem Bereich der poetischen Rhetorik angehört, bleibt weit zurück; das Gehauchte, dem Volkslied verwandte, verbindet sich mit der höchsten Kühnheit, Erhabenheit und Wucht des Ausdrucks, die Spannung zwischen dem Sprachlaut, in dem «die Unmittelbarkeit des Creatürlichen sich enthüllt» und dem von höchster Besonnenheit gesetzten Sprachbild ist aufgehoben; wer in diese Region verstehend aufzusteigen vermag, weiß wie die deutsche Sprache ihre Schwingen führt — auch in Prosa kann ein solches Höchstes zuweilen erreicht werden, es ist gleichfalls den Meistern vorbehalten: das Ende der «Wanderjahre» ist in einer solchen Prosa verfaßt, bei Novalis hie und da für Augenblicke erscheint diese letzte Meisterschaft, in Hölderlins Briefen der spätesten Zeit: da ist wirklich das Zauberische erreicht, die Gewalt der Worte und Wortverbindungen übersteigt alles, was ohne solche Beispiele geahnt werden könnte; die Sprache wirkt hier völlig als geisterhaftes Wunder wie bei Rembrandt manchmal die Farbe, in Beethovens späten Werken der Ton.
Weit darunter ist die Region, in der wir leben. Unsere höchsten Dichter allein, möchte man sagen, gebrauchen unsere Sprache sprachgemäß — ob auch die Schriftsteller, bleibt schon fraglich. Die Zeitung, die öffentliche Rede, die Fassung der Gesetze und Anordnungen, all das ist in seiner Sprache schon verwahrlost; die wahre, zur zweiten Natur gewordene Aufmerksamkeit fehlt, es fehlt das Gefühl für das Richtige und Mögliche, es ist ein ewiges «das Kind mit dem Bad ausgießen». Die Rückwirkung dessen auf die Nation ist gefährlich, ja verderblich; aber es spricht ja daraus auch schon der Zustand der Nation selber, jenes fieberhaft Unruhige und zugleich Gefesselte, Dumpf-Ängstliche.
Es ist eine sehr harte, finstere und gefährliche Zeit über uns gekommen. Sie ist wohl über ganz Europa gekommen, aber keines der anderen Völker hat so viele Fugen in seiner Rüstung, durch die das Gefährliche eindringt und sich bis ans Herz heranbohren kann. Wo das wahre Leben der Nationen immer wieder im Zueinanderstreben aller ihrer Glieder liegt, haben wir, schon entzwei-geteilt durch die Religion, zuerst noch, zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts, alles Überkommene, sittlich-geistig Gebundene jäh auseinandertreten sehen mit dem Neuen, Individual-Geistigen, Verantwortungslosen auseinandertreten dann allmählich die Geisteswissenschaften mit den Naturwissenschaften, auseinandertreten die Sprache, die alles vereinigen müßte, und jenes mathematisch übersprachliche Streben, von dem die Wissenschaften schicksalhaft ergriffen wurden, und dem nur Einzelne zu folgen vermögen; nun reißen neue Glaubensbegriffe, mit religiosem Eifer in die Massen geworfen‚ die Klassen der Gesellschaft auseinander — aber wie in einem Wirbelsturm überschäumende Querwellen die Wellen noch durchkreuzen, so jagt jetzt quer durch alles Denken hin, zerstäubend was sich ihm entgegenstellt, ein neuer Begriff von der alleinigen Giltigkeit der Gegenwart. Es ist der Zustand furchtbarer sinnlicher Gebundenheit, in welchen das neunzehnte Jahrhundert uns hineingeführt, woraus nun dieses Götzenbild «Gegenwart» hervorsteigt. Nur den ans Sinnliche völlig Hingegebenen, der sich aller Machtmittel des Geistes entäußert hat, bannt das Scheinbild des Augenblicks, der keine Vergangenheit und keine Zukunft hat. Allem höheren Denken immer lag das Wunder in der Gemeinschaft des Gegenwärtigen mit dem Vergangenen, im Fortleben der Toten in uns, dem einzig wir danken, daß die wechselnden Zeiten wahrhaft inhaltvoll sind und nicht «als ewiger Gleichklang sinnlos wiederholter Takte erscheinen». Dem Denkenden ist, nach Kierkegaards Wort, das Gegenwärtige das Ewige — oder besser: das Ewige ist das Gegenwärtige und dieses ist das Inhaltvolle. «Der Augenblick bezeichnet das Gegenwärtige als ein solches, das keine Vergangenheit hat und keine Zukunft. Darin liegt ja eben die Unvollkommenheit des sinnlichen Lebens. Das Ewige bezeichnet auch das Gegenwärtige, das kein Vergangenes und kein Zukünftiges hat und dies ist des Ewigen Vollkommenheit.» Nur mit dieser wahren Gegenwart hat die Sprache zu tun. Der Augenblick ist ihr nichts. Aber das Dahingegangene zu vergegenwärtigen, das ist ihre wahre Aufgabe. Das was nicht mehr ist, das was noch nicht ist, das was sein könnte; aber vor allem das was niemals war, das schlechthin Unmögliche und darum über Alles Wirkliche, dies auszusprechen, ist ihre Sache. Sie ist das uns gegebene Werkzeug, aus dem Schein zu der Wirklichkeit zu gelangen, und indem er spricht, bekennt der Mensch sich als das Wesen, das nicht zu vergessen vermag. Die Sprache ist ein großes Totenreich, unauslotbar tief; darum empfangen wir aus ihr das höchste Leben. Es ist unser zeitloses Schicksal in ihr, und die Übergewalt der Volksgemeinschaft über alles Einzelne.
Unmittelbar schreiten wir durch sie in das Volk hinein; das fühlen wir. Wie wir das erfassen können: die Seele eines Volkes, danach fahnden wir, und Zweifel versehrt uns wieder ob einem solchen Begriff jemals die Anschauung abzuringen sei. Hier aber in der Sprache, spricht uns ein Wirkliches an, durchdringt uns bis ins Mark: die Urkraft, daran wir Teil haben.
Unsere Gedanken über die wichtigsten Gegenstände unseres Lebens bedürfen immer aufs neue der Klärung. Nichts aber ist so hoch, daß ihm nicht Pflege not täte. Das, von dem selbst die höchste bejahende Kraft ausgeht, muß immer aufs neue bejaht werden und dies ist der Sinn eines jeden gegenwärtigen Geschlechtes: daß es das Leben des Hohen nicht unterbreche. — In diesem Buch sind die Gedanken von zwölf deutschen Männern über die deutsche Sprache zusammengestellt. Warum ihrer nicht mehr sind, sondern aus den letztverflossenen drei Jahrhunderten diese gewählt wurden — vertraue man, daß es nach reiflichem Nachdenken und genauer Prüfung geschehen ist. Auch Schiller, Hamann, Schopenhauer und viele andere haben schöne und tiefe Gedanken über das Geheimnis der Sprache an den Tag gegeben. Diese Zwölf aber erschienen als die wahren Gewährsmänner über diesen hohen Gegenstand und vermöge ihrer Kraft als gegenwärtig.
🞯 🞯 🞯 🞯 🞯
An wen aber wenden sich diese Sammlungen! Wer wird mit diesen Vor- und Nachreden angesprochen! Ein Zweifel überfällt uns zuweilen, der nicht die Kalten und Widerstrebenden, nein, der uns selber und unsere Zustimmenden in Zweifel zieht, ob sie es wirklich sind, und wir mit ihnen, so wenige Sichtbare, so Verstreute, auf denen in solcher Zeit das in seinen Grundfesten wankende ungeheure Gebäude ruhen könne! Denn wir sind uns der Bedrohung des Ganzen bewußt. Einen letzten Glauben, es bestehe unversehrt wenngleich verborgen die Mitte der Nation und werde dies in Empfang nehmen, wollen wir nicht aufgeben.
— Wert und Ehre deutscher Sprache. In Zeugnissen herausgegeben. München: Verlag der Bremer Presse, 1927. pp. 6-11.
Jean Paul: Kraft der Worte
Nicht aus Gemeinem ist der Mensch gemacht (wie Schiller sagt), sondern aus Worten. Vom Worte werden die Völker länger als vom Gedanken regiert; das Wort wohnt auf der leichten Zunge fester als dessen Sinn im Gehirn; denn es bleibt, mit demselben Tone Köpfe zusammenrufend und aneinanderheftend und Zeiten durchziehend, in lebendiger Wirkung zurück, indes der ewig wechselhafte Gedanke ohne Zeichen umfliegt und sich sein Wort erst sucht. So gleicht das Wort — diese Gedankenschale — den Schaltieren, deren Gehäuse ohne die weichen Einwohner das bilden, was kein Tier und Riese zu bilden vermag — Inseln und Gebirge.
— Museum, II. Sedez-Aufsätze. In der oben genannten Anthologie auf pp. 139-140.
Wilhelm von Humboldt: Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung
 erden wir nun aber so zu den gebildeten Sprachen hingedrängt, so fragt es sich zuvörderst, ob jede Sprache der gleichen, oder nur irgend einer bedeutenden Cultur fähig ist? oder ob es Sprachformen giebt, die nothwendig erst hätten zertrümmert werden müssen, ehe die Nationen hätten die höheren Zwecke der Menschheit durch Rede erreichen können. Das letztere ist das Wahrscheinlichste. Die Sprache muß zwar, meiner vollsten Ueberzeugung nach, als unmittelbar in den Menschen gelegt, angesehen werden; denn als Werk seines Verstandes in der Klarheit des Bewußtseins ist sie durchaus unerklärbar. Es hilft nicht, zu ihrer Erfindung Jahrtausende und abermals Jahrtausende einzuräumen. Die Sprache ließe sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem menschlichen Verstande vorhanden wäre. Damit der Mensch nur ein einziges Wort wahrhaft, nicht als bloßen sinnlichen Anstoß, sondern als articulirten, einen Begriff bezeichnenden Laut verstehe, muß schon die Sprache ganz und im Zusammenhange in ihm liegen. Es giebt nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Theil eines Ganzen an. So natürlich die Annahme allmähliger Ausbildung der Sprachen ist, so konnte die Erfindung nur mit Einem Schlage geschehen. Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache; um aber die Sprache zu erfinden, müßte er schon Mensch sein. So wie man wähnt, daß dies allmählig und stufenweise, gleichsam umzechig, geschehen, durch einen Theil mehr erfundener Sprache der Mensch mehr Mensch werden, und durch diese Steigerung wieder mehr Sprache erfinden könne, verkennt man die Untrennbarkeit des menschlichen Bewußtseins und der menschlichen Sprache, und die Natur der Verstandeshandlung, welche zum Begreifen eines einzigen Wortes erfordert wird, aber hernach hinreicht, die ganze Sprache zu fassen. Darum aber darf man sich die Sprache nicht als etwas fertig Gegebenes denken, da sonst eben so wenig zu begreifen wäre, wie der Mensch die gegebene verstehen und sich ihrer bedienen könnte. Sie geht nothwendig aus ihm selbst hervor und gewiß auch nur nach und nach, aber so, daß ihr Organismus nicht zwar als eine todte Masse im Dunkel der Seele liegt, aber als Gesetz die Functionen der Denkkraft bedingt, und mithin das erste Wort schon die ganze Sprache antönt und voraussetzt. Wenn sich daher dasjenige, wovon es eigentlich nichts Gleiches im ganzen Gebiete des Denkbaren giebt, mit etwas anderem vergleichen läßt, so kann man an den Naturinstinkt der Thiere erinnern, und die Sprache einen intellectuellen der Vernunft nennen. So wenig sich der Instinkt der Thiere aus ihren geistigen Anlagen erklären läßt, eben so wenig kann man für die Erfindung der Sprachen Rechenschaft geben aus den Begriffen und dem Denkvermögen der rohen und wilden Nationen, welche ihre Schöpfer sind. Ich habe mir daher nie vorstellen können, daß ein sehr consequenter und in seiner Mannichfaltigkeit künstlicher Sprachbau große Gedankenübung voraussetzen, und eine verloren gegangene Bildung beweisen sollte. Aus dem rohesten Naturstande kann eine solche Sprache, die selbst Produkt der Natur, aber der Natur der menschlichen Vernunft ist, hervorgehen. Consequenz, Gleichförmigkeit, auch bei verwickeltem Bau, ist überall Gepräge der Erzeugnisse der Natur, und die Schwierigkeit, sie hervorzubringen, ist nicht die hauptsächlichste. Die wahre der Spracherfindung liegt nicht sowohl in der Aneinanderreihung und Unterordnung einer Menge sich auf einander beziehender Verhältnisse, als vielmehr in der unergründlichen Tiefe der einfachen Verstandeshandlung, die überhaupt zum Verstehen und Hervorbringen der Sprache auch in einem einzigen ihrer Elemente gehört. Ist dieß geschehn, so folgt alles Uebrige von selbst, und es kann nicht erlernt werden, muß ursprünglich im Menschen vorhanden sein. Der Instinkt des Menschen aber ist minder gebunden, und läßt dem Einflusse der Individualität Raum. Daher kann das Werk des Vernunftinstinkts zu größerer oder geringerer Vollkommenheit gedeihen, da das Erzeugniß des thierischen eine stätigere Gleichförmigkeit bewahrt, und es widerspricht nicht dem Begriffe der Sprache, daß einige in dem Zustande, in welchem sie uns erscheinen, der vollendeten Ausbildung wirklich unfähig wären. Die Erfahrung bei Uebersetzungen aus sehr verschiedenen Sprachen, und bei dem Gebrauche der rohesten und ungebildetsten zur Unterweisung in den geheimnißvollsten Lehren einer geoffenbarten Religion zeigt zwar, daß sich, wenn auch mit großen Verschiedenheiten des Gelingens, in jeder jede Ideenreihe ausdrücken läßt. Dieß aber ist bloß eine Folge der allgemeinen Verwandtschaft aller und der Biegsamkeit der Begriffe und ihrer Zeichen. Für die Sprachen selbst und ihren Einfluß auf die Nationen beweist nur was aus ihnen natürlich hervorgeht; nicht das wozu sie gezwängt werden können, sondern das, wozu sie einladen und begeistern.
erden wir nun aber so zu den gebildeten Sprachen hingedrängt, so fragt es sich zuvörderst, ob jede Sprache der gleichen, oder nur irgend einer bedeutenden Cultur fähig ist? oder ob es Sprachformen giebt, die nothwendig erst hätten zertrümmert werden müssen, ehe die Nationen hätten die höheren Zwecke der Menschheit durch Rede erreichen können. Das letztere ist das Wahrscheinlichste. Die Sprache muß zwar, meiner vollsten Ueberzeugung nach, als unmittelbar in den Menschen gelegt, angesehen werden; denn als Werk seines Verstandes in der Klarheit des Bewußtseins ist sie durchaus unerklärbar. Es hilft nicht, zu ihrer Erfindung Jahrtausende und abermals Jahrtausende einzuräumen. Die Sprache ließe sich nicht erfinden, wenn nicht ihr Typus schon in dem menschlichen Verstande vorhanden wäre. Damit der Mensch nur ein einziges Wort wahrhaft, nicht als bloßen sinnlichen Anstoß, sondern als articulirten, einen Begriff bezeichnenden Laut verstehe, muß schon die Sprache ganz und im Zusammenhange in ihm liegen. Es giebt nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Theil eines Ganzen an. So natürlich die Annahme allmähliger Ausbildung der Sprachen ist, so konnte die Erfindung nur mit Einem Schlage geschehen. Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache; um aber die Sprache zu erfinden, müßte er schon Mensch sein. So wie man wähnt, daß dies allmählig und stufenweise, gleichsam umzechig, geschehen, durch einen Theil mehr erfundener Sprache der Mensch mehr Mensch werden, und durch diese Steigerung wieder mehr Sprache erfinden könne, verkennt man die Untrennbarkeit des menschlichen Bewußtseins und der menschlichen Sprache, und die Natur der Verstandeshandlung, welche zum Begreifen eines einzigen Wortes erfordert wird, aber hernach hinreicht, die ganze Sprache zu fassen. Darum aber darf man sich die Sprache nicht als etwas fertig Gegebenes denken, da sonst eben so wenig zu begreifen wäre, wie der Mensch die gegebene verstehen und sich ihrer bedienen könnte. Sie geht nothwendig aus ihm selbst hervor und gewiß auch nur nach und nach, aber so, daß ihr Organismus nicht zwar als eine todte Masse im Dunkel der Seele liegt, aber als Gesetz die Functionen der Denkkraft bedingt, und mithin das erste Wort schon die ganze Sprache antönt und voraussetzt. Wenn sich daher dasjenige, wovon es eigentlich nichts Gleiches im ganzen Gebiete des Denkbaren giebt, mit etwas anderem vergleichen läßt, so kann man an den Naturinstinkt der Thiere erinnern, und die Sprache einen intellectuellen der Vernunft nennen. So wenig sich der Instinkt der Thiere aus ihren geistigen Anlagen erklären läßt, eben so wenig kann man für die Erfindung der Sprachen Rechenschaft geben aus den Begriffen und dem Denkvermögen der rohen und wilden Nationen, welche ihre Schöpfer sind. Ich habe mir daher nie vorstellen können, daß ein sehr consequenter und in seiner Mannichfaltigkeit künstlicher Sprachbau große Gedankenübung voraussetzen, und eine verloren gegangene Bildung beweisen sollte. Aus dem rohesten Naturstande kann eine solche Sprache, die selbst Produkt der Natur, aber der Natur der menschlichen Vernunft ist, hervorgehen. Consequenz, Gleichförmigkeit, auch bei verwickeltem Bau, ist überall Gepräge der Erzeugnisse der Natur, und die Schwierigkeit, sie hervorzubringen, ist nicht die hauptsächlichste. Die wahre der Spracherfindung liegt nicht sowohl in der Aneinanderreihung und Unterordnung einer Menge sich auf einander beziehender Verhältnisse, als vielmehr in der unergründlichen Tiefe der einfachen Verstandeshandlung, die überhaupt zum Verstehen und Hervorbringen der Sprache auch in einem einzigen ihrer Elemente gehört. Ist dieß geschehn, so folgt alles Uebrige von selbst, und es kann nicht erlernt werden, muß ursprünglich im Menschen vorhanden sein. Der Instinkt des Menschen aber ist minder gebunden, und läßt dem Einflusse der Individualität Raum. Daher kann das Werk des Vernunftinstinkts zu größerer oder geringerer Vollkommenheit gedeihen, da das Erzeugniß des thierischen eine stätigere Gleichförmigkeit bewahrt, und es widerspricht nicht dem Begriffe der Sprache, daß einige in dem Zustande, in welchem sie uns erscheinen, der vollendeten Ausbildung wirklich unfähig wären. Die Erfahrung bei Uebersetzungen aus sehr verschiedenen Sprachen, und bei dem Gebrauche der rohesten und ungebildetsten zur Unterweisung in den geheimnißvollsten Lehren einer geoffenbarten Religion zeigt zwar, daß sich, wenn auch mit großen Verschiedenheiten des Gelingens, in jeder jede Ideenreihe ausdrücken läßt. Dieß aber ist bloß eine Folge der allgemeinen Verwandtschaft aller und der Biegsamkeit der Begriffe und ihrer Zeichen. Für die Sprachen selbst und ihren Einfluß auf die Nationen beweist nur was aus ihnen natürlich hervorgeht; nicht das wozu sie gezwängt werden können, sondern das, wozu sie einladen und begeistern.
[14.] Den Gründen der Unvollkommenheit einiger Sprachen mag die historische Prüfung im Einzelnen nachforschen. Dagegen muß ich hier eine andere Frage anknüpfen: ob nämlich irgend eine Sprache zur vollendeten Bildung reif ist, ehe sie nicht mehrere Mittelzustände und gerade, solche durchgangen ist, durch welche die ursprüngliche Vorstellungsweise dergestalt gebrochen wird, daß die anfängliche Bedeutung der Elemente nicht mehr völlig klar ist? Die merkwürdige Beobachtung, daß eine charakteristische Eigenschaft der rohen Sprachen Consequenz, der gebildeten Anomalie in vielen Theilen ihres Baues ist, und auch aus der Natur der Sache geschöpfte Gründe machen dieß wahrscheinlich. Das durch die ganze Sprache herrschende Princip ist Artikulation; der wichtigste Vorzug jeder, feste und leichte Gliederung; diese aber setzt einfache und in sich untrennbare Elemente voraus. Das Wesen der Sprache besteht darin, die Materie der Erscheinungswelt in die Form der Gedanken zu gießen; ihr ganzes Streben ist formal, und da die Wörter die Stelle der Gegenstände vertreten, so muß auch ihnen, als Materie, eine Form entgegenstehen, welcher sie unterworfen werden. Nun aber häufen die ursprünglichen Sprachen gerade eine Menge von Bestimmungen in dieselbe Silbengruppe und sind sichtbar mangelhaft in der Herrschaft der Form. Ihr einfaches Geheimniß, welches den Weg anzeigt, auf welchem man sie, mit gänzlicher Vergessenheit unserer Grammatik, immer zuerst zu enträthseln versuchen muß, ist, das in sich Bedeutende unmittelbar an einander zu reihen. Die Form wird in Gedanken hiezu verstanden, oder durch ein in sich bedeutendes Wort, das man auch als solches nimmt, mithin als Stoff, gegeben. Auf der zweiten großen Stufe des Fortschreitens weicht die stoffartige Bedeutung dem formalen Gebrauch, und es entstehen daraus grammatische Beugungen und Wörter grammatischer, also formaler Bedeutung. Aber die Form wird nur da angedeutet, wo sie durch einen einzelnen, im Sinn der Rede liegenden Umstand, gleichsam materiell, nicht wo sie durch die Ideenverknüpfung formal gefordert wird. Der Plural wird wohl als Vielheit, aber der Singular nicht gerade als Einzelnes, sondern nur als der Begriff überhaupt gedacht, Verbum und Nomen fallen zusammen, wo nicht gerade Person oder Zeit auszudrücken ist; die Grammatik waltet noch nicht in der Sprache, sondern tritt nur im Fall des Bedürfnisses auf. Erst wenn kein Element mehr als formlos gedacht, und der Stoff als Stoff ganz in der Rede besiegt wird, ist die dritte Stufe erstiegen, welche aber insofern, daß auch in jedem Element die Form hörbar angedeutet wäre, kaum die gebildetsten Sprachen erreichen, obgleich darauf erst die Möglichkeit architektonischer Eurythmie im Periodenbau beruht. Auch ist mir keine bekannt, deren grammatische Formen nicht noch, selbst in ihrer höchsten Vollendung, unverkennbare Spuren der ursprünglichen Silben-Agglutination an sich trügen. So lange nun auf den früheren Stufen das Wort, als mit seiner Modification zusammengesetzt, nicht als in seiner Einfachheit modificirt erscheint, fehlt es an der leichten Trennbarkeit der Elemente, und wird der Geist durch die Schwerfälligkeit des Bedeutenden, mit der jedes Grundtheilchen auftritt, niedergedrückt, nicht durch Gefühl des Formalen wieder zu formalem Denken angeregt. Der dem Naturstande noch nahestehende Mensch verfolgt auch eine einmal angenommene Vorstellungsweise leicht zu weit, denkt jeden Gegenstand und jede Handlung mit allen ihren Nebenumständen, trägt dieß in die Sprache über und wird nachher wieder von ihr, da der lebendige Begriff doch in ihr zum Körper erstarrt, überwältigt. Dieß nun auf das wahre Maaß zurückzuführen und die Kraft des materiell Bedeutenden zu mindern, ist Kreuzung der Nationen und Sprachen durch einander ein höchst wirksames Mittel. Eine neue Vorstellungsweise gesellt sich zu der bisherigen; die sich vermischenden Stämme kennen gegenseitig nicht die einzelne Zusammensetzung der Wörter ihrer Mundarten, sondern nehmen sie bloß als Formeln im Ganzen auf, das Unbequemere und Schwerfälligere weicht, bei der Möglichkeit der Wahl, dem Leichteren und Fügsameren, und da Geist und Sprache nicht mehr so einseitig verwachsen sind, so übt jener eine freiere Gewalt über diese aus. Der ursprüngliche Organismus wird allerdings gestört, aber die neu hinzutretende Kraft ist wieder eine organische, und so wird das Gewebe ununterbrochen, nur nach größerem und mannichfaltigerem Plane fortgesetzt. Das anscheinend verwirrte und wilde Durcheinanderziehen der Völkerstämme der Urzeit bereitete also die Blüthe der Rede und des Gesanges in lange darauf folgenden Jahrhunderten vor. (...)
[23.] Es ist hier nur meine Absicht gewesen, das Feld der vergleichenden Sprachuntersuchungen im Ganzen zu überschlagen, ihr Ziel festzustellen und zu zeigen, daß, um es zu erreichen, der Ursprung und die Vollendung der Sprachen zusammengenommen werden muß. Nur auf diesem Wege können diese Forschungen dahin führen, die Sprachen immer weniger als willkührliche Zeichen anzusehen und auf eine, tiefer in das geistige Leben eingreifende Weise, in der Eigenthümlichkeit ihres Baues Hülfsmittel zur Erforschung und Erkennung der Wahrheit, und Bildung der Gesinnung und des Charakters aufzusuchen. Denn wenn in den zu höherer Ausbildung gediehenen Sprachen eigene Weltansichten liegen, so muß es ein Verhältniß dieser nicht nur zu einander, sondern auch zur Totalität aller denkbaren geben. Es ist alsdann mit den Sprachen wie mit den Charakteren der Menschen selbst, oder um einen einfacheren Gegenstand zur Vergleichung zu wählen, wie mit den Götteridealen der bildenden Kunst, in welchen sich Totalität aufsuchen und ein geschlossener Kreis bilden läßt, da jedes das allgemeine, als gleichzeitiger Inbegriff aller Erhabenheiten nicht individualisirbare Ideal von Einer bestimmten Seite darstellt. Daß dies je in irgend einer Gattung der Vorzüge rein vorhanden wäre, darf man allerdings nicht wähnen, und man würde der Wirklichkeit nur Gewalt anthun, wenn man Charakter- und Sprachverschiedenheiten historisch so darstellen wollte. Allein die Anlagen und nur nicht rein durchgeführten Richtungen sind vorhanden, und es läßt sich weder bei Menschen und Nationen, noch bei Sprachen eine Charakterbildung (die nicht Unterwerfung der Aeusserungen unter ein Gesetz, sondern Annäherung des Wesens an ein Ideal ist) denken, als wenn man sich auf einer Bahn begriffen ansieht, deren, durch die Vorstellung des Ideals gegebene Richtung bestimmte andere, erst alle Seiten desselben erschöpfende voraussetzt. Der Zustand der Nationen, auf welchem dies in ihren Sprachen Anwendung finden kann, ist der höchste und letzte, zu welchem Verschiedenheit der Völkerstämme führen kann; er setzt verhältnißmäßig große Menschenmassen voraus, weil die Sprachen diese erfordern, um sich zu ihrer Vollendung zu erheben. Ihm zum Grunde liegt der niedrigste, von dem wir ausgingen, der aus der unvermeidlichen Zerstückelung und Verzweigung des Menschengeschlechts entsteht und dem die Sprachen ihren Ursprung schuldig sind; dieser setzt viele und kleine Menschenmassen voraus, weil das Entstehen der Sprachen in diesen leichter ist, und viele sich mischen und zusammenfließen müssen, wenn reiche und bildsame hervorgehen sollen. In beiden vereinigt sich, was in der ganzen Oeconomie des Menschengeschlechts auf Erden gefunden wird, daß der Ursprung in Naturnothwendigkeit und physischem Bedürfniß liegt, aber in der fortschreitenden Entwicklung beide den höchsten geistigen Zwecken dienen.
— In: Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den Jahren 1820–1821. Berlin: Reimer, 1822. pp.. 247-251, 259-260. Ein Auszug in der oben genannten Anthologie auf pp. 147-150.
Friedrich Nietzsche: Vorlesungsaufzeichnungen
Dagegen richtig Jean Paul Vorschule der Aesthetik: «Wie im Schreiben Bilderschrift früher war, als Buchstabenschrift, so war im Sprechen die Metapher, insofern sie Verhältnisse u. nicht Gegenstände bezeichnet, das frühere Wort, welches sich erst allmählich zum eigentl. Ausdrucke entfärben mußte. Das Beseelen und Beleiben fiel noch in eins zusammen, weil noch Ich u. Welt verschmolz. Daher ist jede Sprache in Rücksicht geistiger Beziehungen ein Wörterbuch erblaßter Metaphern.» — Friedrich Nietzsche: Vorlesungsaufzeichnungen, bearbeitet und herausgegeben von F. Bornmann und M. Carpitella. KGW, Abteilung II, Band 4, Berlin/New York, 1995, p. 442 sq.
Jorge Luis Borges: Parábola del palacio
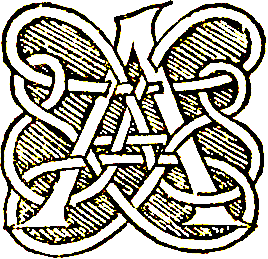 quel día, el Emperador Amarillo mostró su palacio al poeta. Fueron dejando atrás, en largo desfile, las primeras terrazas occidentales que, como gradas de un casi inabarcable anfiteatro, declinan hacia un paraíso o jardín cuyos espejos de metal y cuyos intrincados cercos de enebro prefiguraban ya el laberinto. Alegremente se perdieron en él, al principio como si condescendieran a un juego y después no sin inquietud, porque sus rectas avenidas adolecían de una curvatura muy suave pero continua y secretamente eran círculos. Hacia la medianoche, la observación de los planetas y el oportuno sacrificio de una tortuga les permitieron desligarse de esa región que parecía hechizada, pero no del sentimiento de estar perdidos, que los acompañó hasta el fin. Antecámaras y patios y bibliotecas recorrieron después y una sala hexagonal con una clepsidra, una mañana divisaron desde una torre un hombre de piedra, que luego se les perdió para siempre. Muchos resplandecientes ríos atravesaron en canoas de sándalo, o un solo río muchas veces. Pasaba el séquito imperial y la gente se prosternaba, pero un día arribaron a una isla en que alguno no lo hizo, por no haber visto nunca al Hijo del Cielo, y el verdugo tuvo que decapitarlo. Negras cabelleras y negras danzas y complicadas máscaras de oro vieron con indiferencia sus ojos; lo real se confundía con lo soñado o, mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño. Parecía imposible que la tierra fuera otra cosa que jardines, aguas, arquitecturas y formas de esplendor. Cada cien pasos una torre cortaba el aire; para los ojos el color era idéntico, pero la primera de todas era amarilla y la última escarlata, tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie.
quel día, el Emperador Amarillo mostró su palacio al poeta. Fueron dejando atrás, en largo desfile, las primeras terrazas occidentales que, como gradas de un casi inabarcable anfiteatro, declinan hacia un paraíso o jardín cuyos espejos de metal y cuyos intrincados cercos de enebro prefiguraban ya el laberinto. Alegremente se perdieron en él, al principio como si condescendieran a un juego y después no sin inquietud, porque sus rectas avenidas adolecían de una curvatura muy suave pero continua y secretamente eran círculos. Hacia la medianoche, la observación de los planetas y el oportuno sacrificio de una tortuga les permitieron desligarse de esa región que parecía hechizada, pero no del sentimiento de estar perdidos, que los acompañó hasta el fin. Antecámaras y patios y bibliotecas recorrieron después y una sala hexagonal con una clepsidra, una mañana divisaron desde una torre un hombre de piedra, que luego se les perdió para siempre. Muchos resplandecientes ríos atravesaron en canoas de sándalo, o un solo río muchas veces. Pasaba el séquito imperial y la gente se prosternaba, pero un día arribaron a una isla en que alguno no lo hizo, por no haber visto nunca al Hijo del Cielo, y el verdugo tuvo que decapitarlo. Negras cabelleras y negras danzas y complicadas máscaras de oro vieron con indiferencia sus ojos; lo real se confundía con lo soñado o, mejor dicho, lo real era una de las configuraciones del sueño. Parecía imposible que la tierra fuera otra cosa que jardines, aguas, arquitecturas y formas de esplendor. Cada cien pasos una torre cortaba el aire; para los ojos el color era idéntico, pero la primera de todas era amarilla y la última escarlata, tan delicadas eran las gradaciones y tan larga la serie.
Al pie de la penúltima torre fue que el poeta (que estaba como ajeno a los espectáculos que eran maravilla de todos) recitó la breve composición que hoy vinculamos indisolublemente a su nombre y que, según repiten los historiadores más elegantes, le deparó la inmortalidad y la muerte. El texto se ha perdido; hay quien entiende que constaba de un verso; otros, de una sola palabra. Lo cierto, lo increíble, es que en el poema estaba entero y minucioso el palacio enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces de los crepúsculos y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones que habitaron en él desde el interminable pasado. Todos callaron, pero el Emperador exclamó: “¡Me has arrebatado el palacio!” y la espada de hierro del verdugo segó la vida del poeta.
Otros refieren de otro modo la historia. En el mundo no puede haber dos cosas iguales; bastó (nos dicen) que el poeta pronunciara el poema para que desapareciera el palacio, como abolido y fulminado por la última sílaba. Tales leyendas, claro está, no pasan de ser ficciones literarias. El poeta era esclavo del Emperador y murió como tal; su composición cayó en el olvido porque merecía el olvido y sus descendientes buscan aún, y no encontrarán, la palabra del universo.
— El Hacedor. 1960.
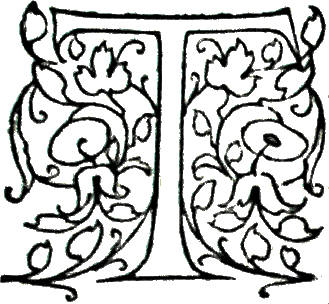 hat day, the Yellow Emperor showed the poet his palace. They left behind, in long succession, the first terraces on the west which descend, like the steps of an almost measureless amphitheater, to a paradise or garden whose metal mirrors and intricate juniper hedges already prefigured the labyrinth. They lost themselves in it, gaily at first, as if condescending to play a game, but afterwards not without misgiving, for its straight avenues were subject to a curvature, ever so slight, but continuous (and secretly those avenues were circles). Toward midnight observation of the planets and the opportune sacrifice of a turtle permitted them to extricate themselves from that seemingly bewitched region, but not from the sense of being lost, for this accompanied them to the end. Foyers and patios and libraries they traversed then, and a hexagonal room with a clepsydra, and one morning from a tower they descried a stone man, whom they then lost sight of forever. Many shining rivers did they cross in sandalwood canoes, or a single river many times. The imperial retinue would pass and people would prostrate themselves. But one day they put in on an island where someone did not do it, because he had never seen the Son of Heaven, and the executioner had to decapitate him. Black heads of hair and black dances and complicated golden masks did their eyes indifferently behold; the real and the dreamed became one, or rather reality was one of dream’s configurations. It seemed impossible that earth were anything but gardens, pools, architectures, and splendrous forms. Every hundred paces a tower cleft the air; to the eye their color was identical, yet the first of all was yellow, and the last, scarlet, so delicate were the gradations and so long the series.
hat day, the Yellow Emperor showed the poet his palace. They left behind, in long succession, the first terraces on the west which descend, like the steps of an almost measureless amphitheater, to a paradise or garden whose metal mirrors and intricate juniper hedges already prefigured the labyrinth. They lost themselves in it, gaily at first, as if condescending to play a game, but afterwards not without misgiving, for its straight avenues were subject to a curvature, ever so slight, but continuous (and secretly those avenues were circles). Toward midnight observation of the planets and the opportune sacrifice of a turtle permitted them to extricate themselves from that seemingly bewitched region, but not from the sense of being lost, for this accompanied them to the end. Foyers and patios and libraries they traversed then, and a hexagonal room with a clepsydra, and one morning from a tower they descried a stone man, whom they then lost sight of forever. Many shining rivers did they cross in sandalwood canoes, or a single river many times. The imperial retinue would pass and people would prostrate themselves. But one day they put in on an island where someone did not do it, because he had never seen the Son of Heaven, and the executioner had to decapitate him. Black heads of hair and black dances and complicated golden masks did their eyes indifferently behold; the real and the dreamed became one, or rather reality was one of dream’s configurations. It seemed impossible that earth were anything but gardens, pools, architectures, and splendrous forms. Every hundred paces a tower cleft the air; to the eye their color was identical, yet the first of all was yellow, and the last, scarlet, so delicate were the gradations and so long the series.
It was at the foot of the next-to-the-last tower that the poet — who was as if untouched by the wonders that amazed the rest — recited the brief composition we find today indissolubly linked to his name and which, as the more elegant historians have it, gave him immortality and death. The text has been lost. There are some who contend it consisted of a single line; others say it had but a single word. The truth, the incredible truth, is that in the poem stood the enormous palace, entire and minutely detailed, with every illustrious porcelain and every sketch on every porcelain and the shadows and the light of the twilights and every unhappy or joyous moment of the glorious dynasties of mortals, gods, and dragons who had dwelled in it from the interminable past. All fell silent, but the Emperor exclaimed, “You have robbed me of my palace!” And the executioner’s iron sword cut the poet down.
Others tell the story differently. There cannot be any two things alike in the world; the poet, they say, had only to utter his poem to make the palace disappear, as if abolished and blown to bits by the final syllable. Such legends, of course, amount to no more than literary fiction. The poet was a slave of the Emperor and as such he died. His composition sank into oblivion because it deserved oblivion and his descendants still seek, nor will they find, the word that contains the universe.
— Dreamtigers. Translated by Mildred Boyer.
Friedrich Hölderlin: An die Parzen
Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
Daß williger mein Herz, vom süßen
Spiele gesättiget, dann mir sterbe.
Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;
Doch ist mir einst das Heil’ge, das am
Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen,
Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel
Mich nicht hinab geleitet; Einmal
Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.
 Giovanni Antonio Bazzi (Sodoma): Le tre Parche, ca. 1525. Rom: Galleria Nazionale d'Arte Antica.
Giovanni Antonio Bazzi (Sodoma): Le tre Parche, ca. 1525. Rom: Galleria Nazionale d'Arte Antica.