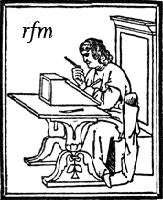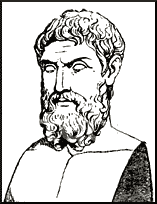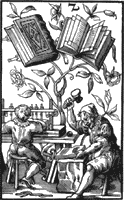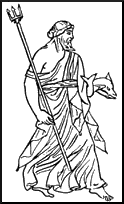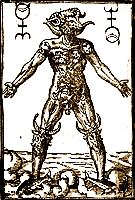Über die Preisfindung bei Büchern
Preisfindung bei Büchern
Montes scandimus, abyssorum voragines perscrutamur, spectes piscium, quos communis aer nequaquam salubriter continet, intuemur codicibus; fluviorum et fontium diversarum terrarum proprietates distinguimus; metallorum atque gemmarum genera et minerae cujusque materias de libris effodimus, herbarumque vires, arborum et plantarum addiscimus, prolemque totam pro libito cernimus Neptuni, Cereris et Plutonis.
— Richard de Bury: Philobiblon, XV. Auf englisch. In books we climb mountains and scan the deepest gulfs of the abyss; in books we behold the finny tribes that may not exist outside their native waters, distinguish the properties of streams and springs and of various lands; from books we dig out gems and metals and the materials of every kind of mineral, and learn the virtues of herbs and trees and plants, and survey at will the whole progeny of Neptune, Ceres, and Pluto. — Translated by E. C. Thomas.
Ὡς εἴ γε τὸ ϰεϰτῆσϑαι τὰ βιβλία ϰαὶ πεπαιδευμένον ἀπέφαινε τὸν ἔχοντα, πολλοῦ ἂν ὡς ἀληϑῶς τὸ ϰτῆμα ἦν ἄξιον ϰαὶ μόνων ὑμῶν τῶν πλουσίων, εἰ ὥσπεϱ ἐξ ἀγοϱᾶς ἦν πϱιάσϑαι τοὺς πένητας ἡμᾶς ὑπεϱβάλλοντας. Τίς δὲ τοῖς ἐμπόϱοις ϰαὶ τοῖς βιβλιοϰαπήλοις ἤϱισεν ἂν πεϱὶ παιδείας τοσαῦτα βιβλία ἔχουσι ϰαὶ πωλοῦσιν, ἀλλ’ εἴ γε διελέγχειν ἐϑέλεις, ὄψει μηδ’ ἐϰείνους πολύ σου τὰ εἰς παιδείαν ἀμείνους, ἀλλὰ βαϱβάϱους μὲν τὴν φωνὴν ὥσπεϱ σύ, ἀξυνέτους δὲ τῇ γνώσει, οἵους εἰϰὸς εἶναι τοὺς μηδὲν τῶν ϰαλῶν ϰαὶ αἰσχϱῶν ϰαϑεωϱαϰότας. Καίτοι σὺ μὲν δύο ἢ τϱία παϱ’ αὐτῶν ἐϰείνων πϱιάμενος ἔχεις, οἱ δὲ νύϰτωϱ ϰαὶ μεϑ’ ἡμέϱαν διὰ χειϱὸς ἔχουσιν αὐτά.
— Λουϰιανὸς ὁ Σαμοσατεύς · Πϱὸς τὸν ἀπαίδευτον ϰαὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον. Auf deutsch. Würde das Bücherhaben den Gelehrten ausmachen, so wäre ein solcher Besitz allerdings sehr hoch anzuschlagen; allein die Gelehrsamkeit wäre alsdann nur eine Sache für reiche Herren, die sie auf dem Markte einkaufen könnten, und uns arme Leute nur zu überbieten brauchten. Wer könnte es vollends den Buchhändlern und Trödlern in den Wissenschaften gleich thun, die ja so viele Bücher haben und feil bieten? Aber beobachte diese Leute näher, und du wirst finden, daß sie an wissenschaftlicher Bildung nicht viel vor dir voraushaben, daß sie eine eben so ungebildete Sprache reden, wie du, kurz, daß es Leute ohne Einsicht sind, die nie gelernt haben, das Schöne und Gute vom Schlechten zu unterscheiden, wiewohl sie alle die Bücher Tag und Nacht in den Händen haben, von welchen du Jedem von ihnen vielleicht nur zwei oder drei abgekauft hast. — Übersetzt von August Friedrich Pauly. Stuttgart: Metzler, 1830.
Ein Lobpreis des Buches
Preise antiquarischer Bücher sind – so will es das Offensichtliche – in den letzten Jahren, hierin anderem gleich, Opfer zunehmender Transparenz. Wo früher nur das Jahrbuch der Auktionspreise und die gesammelten Kataloge Aufschlüsse über den Preisstand und dessen Entwicklung boten, steht heute das weltweite Netz zur Verfügung.
Jedes Werk, die einmaligen und seltenen ausgenommen, läßt sich dort vielmals finden, je höher die ursprüngliche Auflage, desto größer die Menge des Angebotenen und desto breiter die Spanne geforderter Preise wie mehr oder weniger genau beschriebener Erhaltungszustände.
Wenn einst – denn Preise sind stets die jeweilige momentane Übereinkunft des Anbietenden und des Bietenden – zwischen den beiden Parteien ein modus gefunden wurde, verlagert sich der Prozeß des Übereinkommens bei den Plattformen auf die Vielzahl der Anbieter, deren Angebote gegeneinander ausgespielt werden, denn die Plattform hat kein Interesse an der persönlichen Vereinbarung zwischen Antiquar und Sammler, zwischen ‚invitatio ad offerendum’ und Angebot, da ihr dies die Provision entzöge, sondern in ihrem Blickwinkel gilt nur die Menge. Allein die Masse der bei ihr eingestellten Bücher ist ihr Erfolgsmaß. Anbieter und Käufer müssen beide selbst zurechtkommen, ihre wechselseitige Kontaktaufnahme sollte möglichst nur mittels des Warenkorbs der Plattform geschehen, eine der unangenehmsten Verarmungen des antiquarischen Handels im Zeitalter des Internetzes, denn sie hat das Verstummen des persönlichen Dialogs zwischen Antiquar und Sammler zur Folge, der in seinem idealen Ablauf beide bereicherte. Sind die Differenzen der Preise eines Objektes zu groß und durch Kriterien wie Zustand, Einband, Provenienz, Widmung etc. nicht mehr zu erklären, kann dies zu einem Kaufhinderungsgrund werden, daher versuchen die Plattformen die Einhaltung gewisser Qualitätskriterien bei ihren qualitativ durchaus arg unterschiedlichen Einstellern durchzusetzen – und bleiben damit relativ erfolglos.
In Auktionen wird die klassische Situation zwischen Anbietendem und Bieter durch den dazwischentretenden Dritten, die Anzahl fremder Gebote, verändert, was dazu führen mag, daß einmal die Preise enorm steigen: dies bedeutet, es fanden sich mindestens zwei, die dasselbe im selben Moment wollten. Ein andermal wird das Werk für ein so Weniges an Geldeswert zugeschlagen, daß dies nicht seinen wirklichen, weder den ursprünglichen noch den zeitlichen, Marktwert wiederspiegelt. Auktionsergebnisse sind demzufolge mit Vorsicht zu betrachten, höchstens ein Richtpfeil, wohin die Preisentwicklung führen mag.
Die Preisfindung
Unless one is wealthy there is no use in being a charming fellow. Romance is the privilege of the rich, not the profession of the unemployed. The poor should be practical and prosaic. It is better to have a permanent income than to be fascinating.
— Oscar Wilde: The Model Millionaire.
Auktionen ausgenommen findet das Werk seinen Preis also durch eine Vielzahl von Faktoren auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Außer acht lasse ich den Fall, daß das Buch der Klasse ‚Müll’ zuzurechnen ist, dann sollte es nicht angeboten werden (was auf den Plattformen leider immer wieder geschieht), sondern entsorgt.
Für alle anderen Fälle gilt, daß die Preisfindung sowohl subjektive wie objektive Komponenten birgt.
Subjektive sind zum Beispiel die Vorlieben des Händlers wie des Sammlers und die Hoffnung beider Seiten, am Ende den größeren Vorteil aus dem Geschäft zu ziehen, mag dieser nun psychologisch, ästhetisch, bibliophil oder wirtschaftlich sein.
Objektive Komponenten sind Preisgestaltung anderer Anbieter, ähnlicher Objekte, Angebot und Nachfrage. Als ich noch mehr oder weniger unschuldig sammelte und erste Erfahrungen in der Kunst des Bucherwerbs erwarb, bestellte ich gern in England, dessen Pfund damals etwa zwölf Deutsche Mark wog. Doch die erfahrenen Antiquare dort, vergleichbar manchen in Frankreich, boten schone, wohlerhaltene Bücher an. Manche preisten besonderen Augenschmaus in Guineas aus: “Guineas. Painters, poets, and physicians always get guineas.” Dichtkunst also nicht allein in Beschreibungen, sondern ebenso in der Preisauszeichnung.
Der Erhaltungszustand rangiert irgendwie dazwischen, denn in ihm vereinen sich objektive wie subjektive Kriterien: manche Sammler mögen das perfekt erhaltene, demnach ungelesene, unbenutzte Stück nicht, andere schätzen es über alle Maßen; Widmungen und Marginalien gelten nur dann als Mangel, sind sie unschön oder unbedeutend, bei allen anderen sonnt sich der glückliche Besitzer im Lichte seiner Vorgänger; der Einband der Zeit ist dem späteren vorzuziehen, außer es handelt sich dabei um einen besonderen.
Andererseits wird der Händler beim Unikat zwar dessen Erhaltungszustand in Erwägung ziehen, auch die Mühe beziehungsweise den Aufwand, das Stück in einen standesgemäßen Status zu versetzen, jemanden zu finden, der dazu noch fähig ist – doch bleiben diese Erwägungen außerhalb der eigentlichen Bedeutungssphäre des ‚Unikalen‘ und dessen besonderen Reizes. Wie hieß der New Yorker Antiquar, der den Erwerb der später als Jung-Codex recht berühmt gewordenen Handschrift ablehnte? Hat er schlaflose Nächte mit Selbstvorwürfen verbracht?
Und dann gibt es noch eine andere Klasse von Büchern, die sich der einfachen Wertbestimmung zu entziehen versuchen, jene Werke mit einer Aura: der des Vorbesitzes; Bücher, die mit einer Geschichte verbunden sind; andere, die wir mit einer persönlichen Geschichte zusammenbringen.
Jene Bibliophilen, die sich dauerhaft wie intensiv mit ihrer Leidenschaft abgeben, werden merken, daß die Bücher in ihren Regalen und Vitrinen, den interessanten unter den Menschen ähnlich, Individuen sind, die nicht gedanklich zerteilt werden möchten in Einband, Papier, Typographie, Illustration, sondern jeweils als Ganzes, als kleine Gesamtkunstwerke betrachtet, denn bereits der Akt bewußten Zusammentragens fügt ihnen die Aura hinzu: Der bedeutungsvollste Vorbesitz ist immer der eigene, die uns manchmal verwirrende, manchmal unseren Horizont erweiternde Gedankenwelt in diesem und um dieses Buch.
Noch ein Wort zu nagenden Erinnerungen an die entgangenen Schätze: Fehlkäufe können entsorgt werden, indem man sie wieder dem samsarischen Rad des Handels anvertraut, aber jene verwunschenen Bücher für die grad, wie so oft, das Geld nicht langte oder bei denen ein anderer schneller war – sie bleiben dem Gehirn treu in ihrer initialen Treulosigkeit, sind anderswo, fern von mir, enteilt wie eine flüchtige Begegnung auf der Straße – « Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. »
Es fehlt mir ein passabler Schlußsatz.
Wie kann ich das Erleben des Sammelns oder des Handelns in ein paar trockenen Worten zusammenfassen, wenn ich mehr als vierzig Lebensjahre samt ihrer Wechsel und Veränderungen darauf verwandt habe?
Exkurs 1: Normierung v/s Individualität
Nochmals zu den Plattformen: sie sind normierend – gewesen und immer noch. Sie geben den bei ihnen Bücher einstellenden Antiquaren Anzahl wie Reihenfolge der Datenbankfelder vor, selbst auf den Inhalt der Felder nehmen sie gleichmachenden Einfluß. Vor Internetzzeiten war das Antiquariatsgewerbe zwar nicht anarchisch, aber den persönlichen Präferenzen blieb ein gewisser, relativ großer Spielraum offen, so lange der Händler von seinem Kunden verstanden wurde. Auch sind die Ansichten der Plattformbetreiber meist fachfremd, ein treffendes Beispiel sind die alten Kategorien des Zvab, die nichts, rein garnichts mit antiquarischen Büchern zu tun haben.
Selbst die Darstellung der Suchergebnisse ist dem Inhalt unangemessen, zum einen, da es unmöglich ist, billige Gebrauchsbücher, wissenschaftliche Werke, bibliophile Kostbarkeiten und frühe Drucke über einen Leisten zu scheren, denn jedes von ihnen hat seine besonderen Anforderungen an die Darstellung auf dem Bildschirm oder im Katalog. Um nur einige der von mir intendierten Kriterien zu erwähnen: Textlänge, Umbruch des Textes, Hervorhebungen, Darstellung der Bilder. Zum andern, weil sich in jeder größeren Datenbank genügend Datenmüll befindet, der eine längere Ergebnisliste aus reichlich disparaten Einträgen zum unerfreulichen, zeitraubenden Anblick degeneriert.
Leider hat sich mit den sinkenden Niveau der Kommunikation auch eine gewisse Hilflosigkeit verbreitet: Man steht der Zukunft unsicher gegenüber, soll man nun ‚mit der Zeit‘ gehen und an allem, was das Internetz bietet, teilhaben – oder nur an einigem, den Rest, Twitter zum Beispiel oder alles, was unter Web 2 zusammengefaßt wird, ablehnen?
Denkbar wäre, jenseits der nivellierenden Plattformen, eine wieder größere Individualität jener Antiquare, die auf eben diese noch Wert legen, sei es aus persönlichen Gründen, sei es ihrer Ware wegen, und die sich zwecks dessen auf ihren eigenen Seiten der Möglichkeiten bedienten, die Technik wie Kommunikation im Netz dafür bieten, um gleichzeitig mittels der modernen Verständigungsformen eine neue Gemeinsamkeit, eventuell eine gemeinsame Basis aus eigenständigen Zellen zu erschaffen.
Exkurs 2: Die Preise von Drucken der Kelmscott Press
Am besten verkauften sich die in Golden type gesetzten Drucke, davon waren die Shakespeareschen Sonette der ‚Renner‘ – „The History of Godefrey of Boloyne“ erwies sich dagegen als Ladenhüter, und Jane Morris verschenkte die Restauflage 1897 an öffentliche Bibliotheken; an den kleinformatigen verdiente Morris im Vergleich mehr als an den großen, der „Chaucer“ bereitete ihm reichlich Kopfschmerzen.
Das erste Buch der Presse, „The Story of the Glittering Plain“, noch ohne die Illustrationen der zweiten Kelmscott-Ausgabe, kostete als Papierexemplar 2 Guineas (1 Guinea gleich 21 Shillings, also £ 1-1s-0d), auf Pergament 12 bzw. 15 Guineas; „The Poems of William Shakespeare“ waren mit 25 Shillings bzw. 10 Guineas vergleichsweise günstig.
Der „Chaucer“
Die „Taschen-Kathedrale“, der Chaucer, kostete den Kunden als Papierexemplar in der üblichen Broschur mit steifen Pappdeckeln und Leinwandrücken 20 englische Pfund, als Pergamentdruck 120 Guineas, die besonderen Einbände wurden extra berechnet; doch war die Herstellung dieses Meisterwerkes extrem teuer: £ 7217 11d, eine enorme Investition über den Herstellungszeitraum von vier Jahren und der Grund, daß die Auflage von den geplanten 325 Exemplaren auf 425 heraufgesetzt werden mußte. Burne-Jones z.B. erhielt £ 500 für seine Zeichnungen.
Tauschhandel
Aber nicht immer muß ein Preis die Verhandlungsbasis sein: William Michael Rossetti erhielt 1897 von S. C. Cockerell drei Kelmscott-Drucke für Morris’ Ölgemälde „Queen Genevere“, das er von seinem Bruder Dante Gabriel geerbt hatte und das einige Zeit verschollen gewesen war, nämlich „The Recuyell of the Historyes of Troye“, „Sidonia the Sorceress“ und „The Well at the World’s End“, vgl. den Katalog von Henry Sotheran & Co: „From William Michael Rossetti’s Library“, Nummern 1478, 1479 & 1480.
Die Lebensverhältnisse in Großbritannien waren sehr unterschiedlich. Um 1850 umfaßte die englische Arbeiterklasse etwa ein Viertel der Bevölkerung. Eine Sonderstellung nahmen die etwa 750.000 nach England, Wales und Schottland eingewanderter Iren ein, von denen harte Arbeit für geringes Entgelt ausführt wurde. Am oberen Ende der Arbeiterhierarchie standen die Facharbeiter im Maschinenbau; die 5 bis 6 Schilling pro Tag verdienten; darauf folgte die große Masse der Fabrikarbeiter, deren tägliche Arbeitszeit um 1850 zwischen 15 und 16 Stunden schwankte. In der Baumwollindustrie, die überwiegend Frauen und Kinder beschäftigte, betrug der Tageslohn 2 bis 4 Schilling. Am schlechtesten bezahlt wurden Heim- und Hilfsarbeiter; jene, die in den Minen schufteten, verdienten 1870 fünf Schilling pro Tag, zwanzig Jahre später waren es nur noch drei.
Die Löhne der Facharbeiter, die um 1870 etwa 30 Prozent der englischen Arbeiterklasse stellten, stiegen zwischen 1850 und 1865 real um etwa 15 Prozent an, und da die Preise zwischen 1874 bis 1900 rückläufig waren, verbesserten sich die Reallöhne von 1860 bis 1900 um etwa 60 Prozent.
Im Vergleich dazu erhielt der Gouverneur der Insel Helgoland 1889 ein jährliches Gehalt von 800 Pfund Sterling.