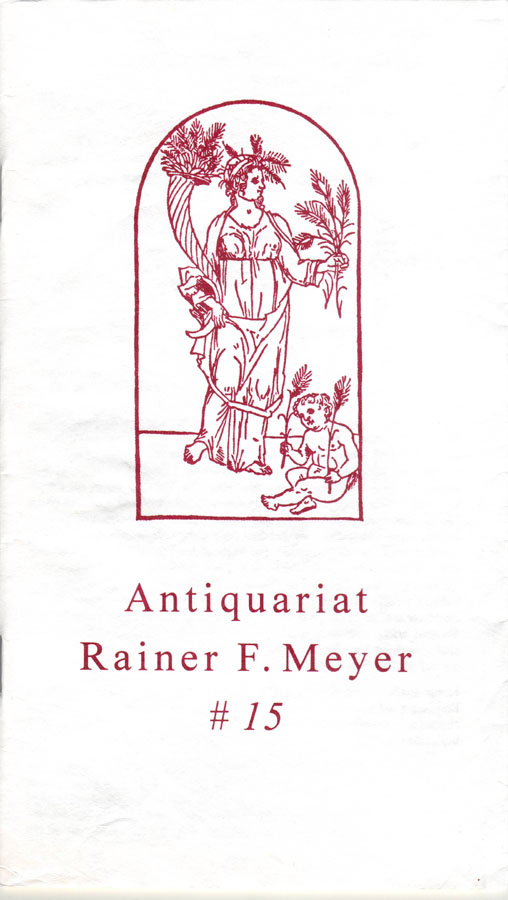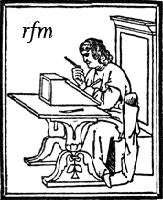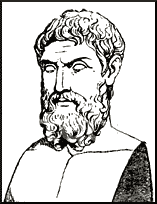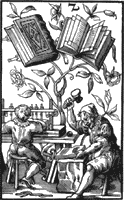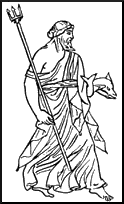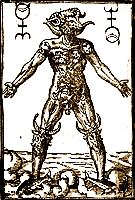Vier Essays zum Thema Buch
Vier Essays zum Thema Buch
Mit nichts als diesem Glauben, daß alle Bücher irgendwie zu unserer Seele reden, umgürtet, ließe sich vielleicht, ja vielleicht doch, in befremdlichen guten Stunden die Flucht aus dem schwindend hohen, eisig stillen Turmgemach unserer Einsamkeit beginnen.
— Hugo von Hofmannthal: Der Tisch mit den Büchern.
Über das Büchersammeln
Eines Menschen Erinnerungen reichen zurück bis in seine frühe Kindheit, weiter nicht. Durch Bücher erfährt unser Horizont, schriftlich Überliefertes als Medium benutzend, Erweiterung in die Jahrhunderte vor unserer Geburt, und wir entdecken, daß damals Menschen lebten, die ihr Leben anders oder ähnlich ausrichteten, nie gleich, und wir lernen von ihnen weit mehr, als wir es von unseren Zeitgenossen je vermöchten, die wie wir befangen sind in ihrer ihnen eigenen Gegenwart. In Zeiten der Diskursverengung durch staatliche Propaganda, sogar Verfolgung Andersdenkender gerät die literarische Überlieferung zum Freiheitselixier.
In den Erstausgaben, in denen die noch frischen Intentionen ihrer Verfasser am besten wiedergegeben werden, in denen letzter Hand, die den Reifeprozeß des Lebens Ausdruck finden lassen, in all den gelesenen Büchern, jenen die vor uns durch Hände wanderten, mehr noch in den annotierten Exemplaren, oder in den durch Autographen und Widmungen bereicherten Werken — überall dort finden wir den Autor, finden wir ein Leben, wie er es erfuhr, finden wir Vorgänger, finden wir Leben, wie es sich seit Anbeginn von Sprache und Schrift durch die Zeiten entwickelte.
Und im Gehäuse des Buches, in seinem Einband, erkennen wir Handwerk, bisweilen dessen Meisterschaft und im besten Falle ein Kunstwerk. Dies vermittelt uns, daß es ein Mehr als nur Nützlichkeit gibt.
Sammeln ist ein Ausdruck von Willkür, denn nur unser Wille leitet uns auf diesem auswählenden, uns verändernden Streifzug durch die Zeiten. Befreit von der Pflicht eines vorgeschriebenen Pensums widmet sich unser Geist der Kür: der Konversation mit ausgesuchten, erlesenen Geistern, die sich in den Bücherregalen und Vitrinen versammeln, darauf warten, herausgezogen, aufgeschlagen, studiert und genossen zu werden, unseren Verstand zu erweitern.
Und wenn wir die Texte lesen, Texte von Menschen, die vergangen sind — und deren Sätze uns trotzdem so berühren wie die Herausforderungen des alltäglichen wie des überraschenden Lebens, ja mehr noch bisweilen, wenn wir diese Texte lesen, sie zu uns sprechen lassen, dann wissen wir sicher und ohne Zweifel, daß wir uns in einer Kette befinden von Anbeginn der Wörter über die babylonische Sprachverwirrung bis heute, und daß wir uns durch die Zeiten nahe sind, in Freuden, Leid, Schönheit, Tiefsinn und Komik. Diese Verständigung über die Zeiten hinweg mag zu einem uns bereichernden Selbstverständnis führen.
Auf der Webseite eines Antiquars entdeckte ich vor kurzem eine recht frühe, von Andreas Asulanus gedruckte und Anfang des 19. Jh. von einem französischen Meisterbuchbinder mit einem neuen Einband versehene Aldine: Der Buchblock wurde offensichtlich gewaschen, so daß er dabei mittels Feuchtigkeit und anschließender Pressung minimal aufgequollen sein mag. Somit, durch die Papierglätte, dazu fast fleckenfei, anmerkungslos und ohne Anstreichungen vermittelt er den kalten Eindruck eines wohlbekleideten Buchgolems, gerade erst einem Labor entkrochen, geschichtslos, kein Teil unseres Gedächtnisses, unserer Überlieferung — Bestandteil bloß einer Mode, der es vornehmlich um Aneignung und Anhäufung, nicht um Studieren wie Bewahren ging.
Wir Antiquare und Sammler gehören zu den Nutznießern von Gedächtnisreisen der Menschheit, wir bewahren, wir öffnen uns diesen Füllhörnern, ohne die menschliche Existenz kaum möglich wäre. Alles Selbstfinden gründet auf dem Wissen um das Gefundensein. Hier entdecken wir uns, in der Überlieferung, in den Büchern, an ihnen entwickeln wir uns.
Bücherhaufen
Werden gemeinhin, einen gewissen Stand der Ordnung vorausgesetzt, Bibliotheken genannt. Dies sind im allgemeinen mittels Räume und Regale parzellierte Buchbestände, die auf Brettern liegend oder stehend gelagert sind. Natürlich schleppt jeder Mensch durch seine Geschichten, die ihm das bisherige Leben erzählen und das künftige vorbereiten, virtuelle Bibliotheken mit sich herum, doch von letzteren, die zudem meist leichte bis nettere neurotische Tendenzen aufweisen, soll im folgenden nicht die Rede sein, sondern von den äußeren, fast realen Haufen, die sich der allgemeinen Nivellierung in unserer schönsten aller unmöglichen — oder unserer absurdesten aller möglichen Welten tapfer entgegenstellen, bis auch sie einst von der entropischen Neigung alles Seins erfaßt werden, zerstreut, aufgelöst, in die Hände eines oder mehrerer jener Aasgeier gelangen, die sich hochtrabend Antiquare nennen — und dann haben sie noch Glück gehabt, die Bücher, nämlich ein Schicksal: Schlimmer erwischt es jene, die verbrannt, gefoltert, geplündert, verstümmelt werden, sei es aus Achtlosigkeit ihrer Besitzer, sei es aufgrund staatlicher, halbstaatlicher oder religiöser Willkürmaßnahmen wie Zensur, öffentliche Scheiterhaufen, Beschlagnahmen und was dergleichen weitere Akte sind.
So ist jedes richtig gute, von Menschenhirn erdachte und von Menschenhand geschriebene Buch auch die Geschichte seines Kampfes gegen eben diese Menschen, die ihm an den Kragen, nicht nur an den Buchdeckel, sondern besonders an seinen Inhalt wollen.
Was wären wir ohne diese Bücher, die uns bewegen, nicht bloß, weil sie schon zahlreiche Leser vor uns bewegt haben, sondern weil sie uns zur rechten Stunde kalt erwischen, uns die Haut abziehen, uns nackt in den Überresten unseres Denkens zurücklassen. Das sind unsere, unsere ganz persönlichen Bücher. Verallgemeinern wir, so gibt es solche Bücher auch für jeweils große Teilmengen der Menschheit: Was wären die Christen ohne das niedergeschriebene Wort, das zwar nicht am Anfang alles Seins, doch zu Beginn ihrer Gruppenexistenz stand, was, ohne jenes umgehende Gespenst, die Marxisten. Selbst wo Texte lange Zeit von Mund zu Ohr tradiert worden sind, wie die Veden, die buddhistischen Sutras, Homers Epen, so ist für jede dieser Traditionen irgendwann der Zeitpunkt gekommen, da sie sich in Tinte auf Papyrus oder Pergament — und später zu Druckerschwärze auf Papier verwandelt haben, materiell greifbar und damit angreifbar — und damit pflegebedürftig geworden sind.
Gute Bücher reichen wie manche Menschen eine Fackel weiter, bisweilen eine die erhellt oder erleuchtet, manchmal eine, die seelisch verbrennt. Böse Bücher verdunkeln uns. Wir brauchen sie alle, um die Welt zu begreifen, indem wir erfahren, wie andere so intensiv wie wir, nur anders, oder intensiver und anders als wir die Welt erfahren haben. Damit wir klüger, weiser, aufsässiger werden.
Es war einmal ein arm Kind und hat kei Vater und kein Mutter war Alles todt und war Niemand mehr auf der Welt. Alles todt, und es ist hingegangen und hat gerrt Tag und Nacht. Und wie auf der Erd Niemand mehr war, wollt’s in Himmel gehn, und der Mond guckt es so freundlich an und wie’s endlich zum Mond kam, war’s ein Stück faul Holz und da ist es zur Sonn gangen und wie’s zur Sonn kam, war’s ein verwelkt Sonneblum und wie’s zu den Sterne kam, warn’s klei golde Mücke, die warn angesteckt wie der Neuntödter sie auf die Schlehe steckt und wie’s wieder auf die Erd wollt, war die Erd ein umgestürzter Hafen und war ganz allein und da hat sich’s hingesetzt und gerrt und da sitzt’ es noch und ist ganz allein.
— Georg Büchner: Woyzeck
Hat Sie das gepackt? Ja? Lesen Sie weiter. Nein? Suchen Sie sich einen anderen Text, es gibt genug davon, bis Sie einen finden, der Sie packt, im Innersten umdreht und einen anderen aus Ihnen macht. Unter dem lohnt es sich nicht.
« L’ordre des mots »
Nur auf dem Papier ist die Ordnung der Wörter stets labyrinthisch präsent, gesprochen verliert sich das Subjekt des Satzes in der Ferne, es entschwindet dem Ohr, während die Aufmerksamkeit bereits durch das Verb gelenkt sich dem Objekt zuwendet. Auf dem Papier stehen sie alle, einerlei wie komplex der Satzaufbau ist, wieviele hypo- und parataktische Konstruktionen er aufweist, gleichberechtigt nebeneinander, nehmen aufeinander Bezug, und das Auge ist dank dieses simultanen Zusammentreffens und seiner ihm eigenen Bewegungsfreiheit in der Lage, dem vorgegebenen Verlauf zu folgen, ihn zu unterbrechen, den einen gefundenen Faden wiederaufzunehmen, einen anderen fallenzulassen — oder einfach in die Ferne zu schweifen und es dem Gehirn zu überlassen, den Text weiterzuspinnen.
Unser Leben ähnelt mehr dem gesprochenen Satz, unser Subjekt, wie es denn einmal entstand, ist in seiner Genese uns schon längst entschlüpft und wagt nur noch, sich einem meditierenden Subjekt wie im Spiegel als beinahe objektives, doch eher virtuelles Sein gegenüberzustellen; im übrigen haben wir uns einfach daran gewöhnt, ein Ich zu besitzen, das für den tagtäglichen Bedarf relativ gut als fokussierende Linse funktioniert. „Leben“ ist ein langanhaltendes Verb, das uns ständig begleitet und durch seine Aktivität anderes verwischt, doch auch der reflektiven Unterstützung bedarf.
Die Büchersammlung als weiterer Spiegel unseres Lebendigseins, unserer Existenz, bedeutet eine Sphäre sedimentierter Zeitabläufe, in der sich Metamorphosen durch ihr Werden in der Zeit mit ihr verfestigten. Bisweilen jedoch sind Jahre wie Schlangenhaut abgelegt, sprich, die Sammlung wandelte sich, alte, nicht mehr konvenierende Teile wurden abgestoßen, wieder in die freie Wildbahn antiquarischen Wiederverkaufs entlassen, neue traten hinzu, sich den Wandlungen unseres Verbs hinzugeben, ihnen beizustehen.
Labyrinthisches
Leben wie Büchersammlung sind Gärten sich verschlingender Pfade, eines umgrenzt von den Jahren und den Orten, das andere von den Wänden, die seinen Ort in der Zeit definieren. Beide mit der Möglichkeit, sich im Unendlichen wie im Zeitlosen zu verlieren, sich auf gewinnträchtige Reisen zu begeben, die in die Ferne führen, dorthin, wo die Füße uns nicht tragen werden, sondern nur die Phantasie und die Wörter, die uns Bilder vorführen. Und je länger wir mit den Büchern gemeinsam existieren, desto intensiver verschlingen sich unserer beider Pfade.
Eine der Aufgaben, die wir uns auferlegen, sammeln wir, ist die Objekte unserer Begierden zu ordnen — oder jene unserem Leben, beziehungsreicherweise den Dingen, immanente Struktur uns selbst aufzuzeigen. Bücher, darin gleichen sie den Lebenstationen im rückschauenden Gedächtnis, sind eher parataktisch, sie reihen sich aneinander, ohne auf den ersten Blick ihre semantische Aufeinanderbezogenheit, die eher den Buchstaben in ihrem Inneren zuzurechnen ist, preiszugeben. Sie zu ordnen ist ein Unterfangen, das stets die Möglichkeit des Scheiterns in sich birgt, weil ihre und unsere Struktur zuviel Gemeinsames bergen.
Manche Reihenfolgen sind plebejischerweise von der Materie vorgegeben: Pergamente stehen am liebsten eng beieinander, um sich einander durch das gegenseitige Anschmiegen familiäre Festigkeit zu schenken, die größeren den größeren, die kleineren den kleineren. Andere Bücher sind flexibler in ihrem Bedarf; nur die Folianten verlangen stets nach einem eigenen Fach, da sie, der Schwerkraft unterworfen wie der eigenen Instabilität, leicht dazu tendieren, wie jemand, der seines Gleichgewichtes nicht mehr sicher ist, sich nach links oder rechts zu neigen und ihre Mitbücher zu bedrängen. Für den Rest, die Formate zwischen Oktav und Quart, sind mehr oder weniger die gewöhnlichen Regale zuständig. Moderne, vielfarbige Bücher lassen sich wie der Regenbogen der Edition Suhrkamp nach Farben sortieren, ältere nach der Zeit ihres Entstehens, die sich in der Ornamentierung ihres Rückens ausdrückt: Jede Zeit gestaltet sich auch ihr Bildnis im Buchäußeren, das teils länger überdauert als Bauwerke, denen wir doch sonst besondere Stabilität zurechnen, und spricht bereits ohne Aufschlagen zu uns.
Alle diese äußerlichen Strukturen sind hinfällig, wenden wir unser Augenmerk auf die Inhalte. Dann steht — zumindest dem inneren Gehalt nach — neben dem Buch aus dem Barock oder der Renaissance das grad erschienene zum selben Thema.
Verweissysteme
Das notwendige Verweissystem entsteht entweder in unserem Kopf oder in Zettelkästen bzw. Computerdateien. Es besteht aus den Ariadnefäden, die uns die Pfade durch das Labyrinth der Bücher weisen. Nur genügt das eine Verweissystem meist nicht der Realität des Lesens und des vermittelten Gedankengehaltes: zwei, drei, viele drängen sich auf. Bücher besitzen durch ihr Äußeres und vor allem ihr Inneres jeweils mehrere Kontextebenen, die sie unterschiedlich untereinander kommunizieren lassen. Je umfangreicher die Büchermenge, desto komplexer und vielschichtiger werden die Verweise.
Die sozusagen ‚Mutter aller Verweissysteme’ beinhaltete alle Wörter aller Bücher unserer Sammlung samt ihrem jeweiligen Kontext. Das erste „und“ oben ist somit vom zweiten, das sich mit dem „Auge“ zusammentut, unterschieden, so wie sich gespielte Noten nach Stück und Interpret anders definieren, was uns im Jazz am offensichtlichsten entgegentönt. Dies Register wäre umfangreicher und genauer als die Borgessche Landkarte Chinas, die das Reich samt all seiner Provinzen im Verhältnis eins zu eins abbildet.
Auch ein Index ist quasi ein Buch und verhält sich wie ein solches in Relation zu anderen seinesgleichen, so bedarf selbst er des Erschlüsseltwerdens durch Indices oder Verweissysteme. Da andererseits ein jedes Register Aspekte von Vergeßlichkeit wie von Faulheit darstellt, vermeidet man Extreme und schlüsselt seine Büchersammlungen etwas weniger komplex auf. Und sicherlich ist ein Index ein Aspekt von Faulheit, da er dem Benutzer die Mühsal erspart, jedes einzelne Buch genau von vorn bis hinten zu studieren, um sich dessen Inhalt wortwörtlich zu merken; und von Vergeßlichkeit, weil man die einmal gelesene Stelle leichthin wiederfindet, obgleich man ihren Wortlaut nicht mehr zu rekonstruieren vermag. Last not least stellt jeder Index ein neues Verschlüsselungssystem dar, indem er Wörter nebeneinander oder einander gegenüberstellt, die im Text meilenweit voneinander entfernt stehen: Er strukturiert die Wörter neu, ohne Sätze, und erschafft so andere Bedeutungsebenen.
Die Vermehrung der Bücher bewirkte schon im sechzehnten Jahrhundert die Vermehrung der Indices, denn die Klosterbibliothek von gut fünfzig Büchern konnte noch leicht selbst während des damaligen, etwas kürzeren Lebens mit langsamerem Lesen bewältigt werden — die Druckkunst vervielfältigte im wörtlichen Sinne das Geschriebene, so daß sich immer weniger Menschen in der Lage sahen, den Stoff ihres Zeitalters zu bewältigen, bis es irgendwann im achtzehnten oder neunzehnten Jahrhundert unmöglich wurde. So fügte man den Schriftwerken Register anbei, die dem Leser erklären, wo er die Information zu seinem Thema finden könne. Fortan brauchte man nur noch eine kurze Passage zu studieren und konnte dann das Buch zurück ins Regal stellen. Lexika und Enzyklopädien stellen die Ausformung dieses Prinzips dar: Werke, die Bibliotheken, Welt und Wissen zwischen ihren Buchdeckeln einfangen, ἐγκύκλιος παιδεία beschreibt es recht treffend: ein Kreis, der Bildung umfängt, eine Auswahl trifft und sie abschirmt.
haec de Grammatice, quam brevissime potui, non ut omnia dicerem sectatus, quod infinitum erat, sed ut maxime necessaria; nunc de ceteris artibus, quibus instituendos, priusquam rhetori tradantur, pueros existimo, strictim subiungam, ut efficiatur orbis ille doctrinae, quem Graeci ἐγκύκλιον παιδείαν vocant.
— Marcus Fabius Quintilianus: „Institutio Oratoria“, I,10.1. auf englisch.I have made my remarks on this stage of education as brief as possible, making no attempt to say everything, (for the theme is infinite), but confining myself to the most necessary points. I will now proceed briefly to discuss the remaining arts in which I think boys ought to be instructed before being handed over to the teacher of rhetoric: for it is by such studies that the course of education described by the Greeks as ἐγκύκλιον παιδείαν or general education will be brought to its full completion.
Übersetzt von Harold Edgeworth Butler. London: Heinemann, 1920.
Heutzutage wird der im Internet Suchende ohne die Vorauswahl der Editoren und solche enzyklopädische Abschirmung mit Eindrücken überflutet und erhält daraus den Eindruck, als bestünde all unser Wissen aus indizierten Seiten, die gewichtslos nebeneinandergestellt werden, weil sie von niemandem gewichtet, ihrer Bedeutung, Wissenschaftlichkeit, Lesbarkeit, Sprachgewalt, ihrem Informationsgehalt nach geordnet wurden. Sammlungen solcher Fundstücke sind akzidentiell, da sie das Essentielle, den Kern der Information, nicht zurückerstatten, sondern unterschlagen. Literatur wie Wissenschaft verlieren ihre Konturen: Was als Wellen noch sichtbar an die Oberfläche tritt, sind kurzlebige Moden, die sich im stofflichen Bereich als Bestseller ‚outen’, um bald der kollektiven Amnesie, dieser Entropie des Geistes, anheimzufallen.
Die Bibliothek als Ansammlung von Büchern nach den subjektiven Vorlieben einer Persönlichkeit ist der Fels wider diese Wellen: Das Individuum stellt um sich seine ihm, einzig ihm, eignende geistige Umwelt auf, stets mit dem Aspekt, sich durch das Lesen fortzuentwickeln, neue Bereiche zu erschließen, dies als Spiegel und Fortführung seines Lebendigseins im Kontext der Welt. Und doch ist, und eben darum ist das Buch, das ich vor dreißig Jahren las, heute, wenn ich es nochmals lese, mir ein anderes geworden, als hätten wir uns beide entwickelt.
Die Verknüpfungen zwischen den Werken einer solchen Sammlung sind das Persönlichste, was man sich zu erdenken vermag, und sie geben wie durch kommunizierende Röhren verbunden das Innere ihres Benutzers wider: Dôgen Zenji, Meister Eckhart und Daisetsu Teitaro Suzuki sind in meinem Gehirn unlösbar miteinander verknüpft, während sie als Bücher in drei verschiedenen Regalen, die in drei verschiedenen Räumen stehen, getrennt sind: Der Leser wird zum lebendigen, wandelnden Register, zu einer Auszugsammlung seiner Bücher. 
By this art you may contemplate the variation of the 23 letters, which may be so infinitely varied, that the words contemplated and deduced thence will not be contained within the compass of the firmament; ...
— Robert Burton: The Anatomy of Melancholy, II, ii, 4.
También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre del Libro. En algún anaquel de algún hexágono (razonaron los hombres) debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás: algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios.
— Jorge Luis Borges: La biblioteca de Babel, In: El Jardín de senderos que se bifurcan. auf deutsch.Auch wissen wir von einem anderen Aberglauben jener Zeit: dem Glauben an den «Buchmenschen». In irgendeinem Regal irgendeines Sechsecks (so dachten die Menschen) muß es ein Buch geben, das Inbegriff und vollkommener Auszug aller anderen ist: ein Bibliothekar hat es durchgesehen und ist gottähnlich.
Jorge Luis Borges: Die Bibliothek von Babel. In: Labyrinthe. München: Hanser, 1959, p. 194.
Aleph ℵ
Ehe wir die Welt sehen, wie sie ist, fragen wir uns, was es sein könnte, dies Um-uns-Herum. Sehen wir die Welt, wie sie ist, sind wir verwundert und bleiben es. Dieses Verwundert-Sein ist der Ausgangspunkt, das Aleph, unseres Wesens, aus ihm strömen die Handlungen, Wörter, jede Form von Teilhaben. Tauchen wir immer tiefer ins Aleph ein, dann wird das Verwundert-Sein immer stärker, denn kein Stein bleibt auf dem anderen, kein Atom an seinem Ort.
Und doch ist das Aleph kein Ursprung im platonischen Sinne, es ist da, so wie alles andere da ist, fast wäre man geneigt zu sagen, es sei ein Gesichtspunkt, der Ausblick in die Nähe gewährte.
Teufel! Da sind wir schon wieder auf der Grenze. Das ist ein Land, wie eine Zwiebel, nichts als Schalen, oder wie ineinandergesteckte Schachteln, in der größten sind nichts als Schachteln und in der kleinsten ist gar nichts.
— Georg Büchner: „Leonce und Lena“, II, i
Trotzdem hat es den Anschein, als entstünden uns die Wörter aus einer Springquelle vor einem hellen Hintergrund; hat sich da das Schreiben auf Papier so sehr in unser Denken und Fühlen eingeschlichen? Erst die Textur des gesamten Textes ist durch jeden ihrer einzelnen Punkte gleichzeitig vorhanden, der Betrachter muß nur sein Augenmerk darauf lenken, darin gleicht sie der Welt um uns. Die Punkte verschränken sich ineinander, so mag der eine für den anderen stehen, der eine andere enthalten. Jedes der Wörter ist eine Zwiebel, die es Schale für Schale zu enthüllen gilt — selbst wenn dabei die Augen ins Tränen geraten sollten.
Und die Quelle sprudelt vor sich hin, die Imaginationen, Begriffe, Wendungen rinnen wie in Reihenfolge, eins nach dem anderen — doch stets mit einem unscharfen Bild im Hintergrund, wie das Ganze sein könnte, wo es sich hinentwickelte, etwa gleich dem Wasserzeichen im Papier, das dem Auge ebenfalls nicht sofort sichtbar ist: Schreiben ist wie Schwimmen in einem durchsichtigen Gewässer, das bisweilen starke Strömungen aufweist und uns trotz unserer Schwimmstöße umhertreibt — das Aleph ist die Nährlösung, in der wir gleiten.
Wozu sollen diese Gedanken? Wozu soll dergleichen Musik? Wozu sollen dergleichen historische Schauspiele? Wozu soll am Ende die ganze Welt? Wozu sollen aber auch solche Fragen? In ihnen steckt kein Verstand.
Von der Mücke bis zum Elephanten ist alles zunächst um sein Selbstwillen da, des Menschen zu geschweigen; so sollte es nicht auch mit Gedanken sein, die früher sind als ihre Anwendung? Nicht ebenfalls mit Laune und Kunst und Lachen und einer verkehrten Welt? Verkehrt sie nur noch einmal, so kehrt ihr die rechte Seite heraus, und ihr sagt dann nicht: darin ist kein Verstand.
— Ludwig Tieck: „Die verkehrte Welt“, Dritter Akt, „Rondo“.
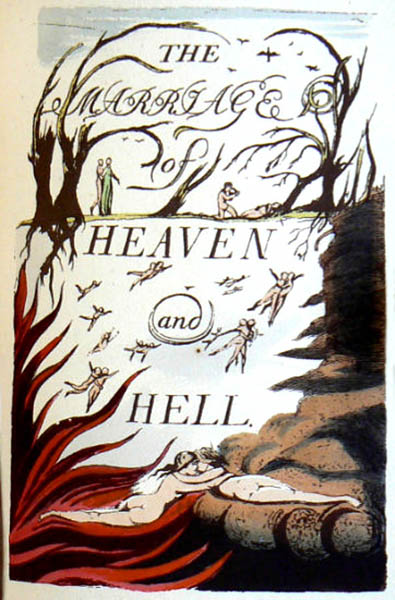
Dem Schatten gerecht werden: Der digitalisierte Antiquar
Folgendes, erstmals vor mehreren Jahren geschrieben und nun der Zeit notdürftig angepaßt, ist immer noch keine abschließende Betrachtung, sondern wie damals Beitrag zu einer Diskussion, die von der Branche, den Lesern und Sammlern, selbst von den überzeugten Bibliophilen wie Buchabhängigen, meinetwegen auch von jedem einzelnen mit sich, geführt werden sollte.
If a poet has any obligation toward society, it is to write well. Being in the minority, he has no other choice.
— Joseph Brodsky: „To Please a Shadow“
Ich bin geneigt, dies auf die Antiquare und Bibliophilen zu übertragen: Falls ein Antiquar irgendeine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft haben sollte, so ist es die, gute Bücher zu erwerben, anzuhäufen und zu verkaufen. Unseren Kunden gleich werden wir immer Minderheit bleiben, Randphänomen einer ins Leseunlustige abdriftenden Mehrheit, vielleicht sogar, die Zeit wird es uns mitteilen, zurückgelassene Endmoräne.
Digitalisat & Faksimile
Digitalisate sind keine Faksimiles, denn sie bemühen sich nicht um die dem Urbild möglichst nahe Nachgestaltung. Das ideale Faksimile wäre wie die Borgessche Landkarte Chinas ein Neues, dem Alten so nachfühlend produziert, das es ihm darin, und dadurch in seiner erzeugten Gestalt, gleichkäme.
In der realen Produktion ist man bestrebt, sich dem anzunähern: Papier, das wie Pergament ausschaut und sich ähnlich anfühlt, Lichtdruck oder kleinrasteriger Offsetdruck, der den Tintenverlauf der Handschrift wiedergibt, Goldprägung, die in Glanz und Höhung echtem Gold nahekommt, Druck-Farben, die den mineralischen oder organischen Bestandteilen der Miniaturmalereien und Initialen im Anschein gleichen.
Mithin ist ein Faksimile ein Stellvertreter, der das schwer zugängliche Original für weitere Kreise von Benutzern und Liebhabern zu ersetzen versucht. Es ist sich seiner Grenzen bewußt, seine Hersteller wissen, daß die Annäherung nicht asymptotisch verläuft, sondern gezwungenermaßen immer in materialgegebener Distanz verweilt: Es gibt einen Abstand zwischen Faksimile und Original, der sich nicht überwinden läßt.
Während das Faksimile neben dem Sehsinn wenigstens versucht, andere anzusprechen, begnügt sich das zweidimensionale Digitalisat mit einem: Auf dem Bildschirm des Computers oder E-Buches sind Schriftzeichen und vielleicht Malereien zu sehen. Ihre Farben, ihre Kontraste, ihre Größen hängen ab von den beim jeweiligen Benutzer vorhandenen Geräten sowie deren spezifischen Einstellungen. Dem kann nur mittels mitgelieferter Farbbalken und Zollstöcke entgegengewirkt werden, doch werden die meisten Bildschirme nie kalibriert, man wird kaum die Bildschirmgröße nach dem Faksimile, das grad über ihn flimmert, erwerben (was zumal bei größeren Folianten recht interessant wäre!).
Also wird das Original seiner Stofflichkeit enthoben, dadurch der Umfang provozierter Sinnenreize auf weniges verringert, den anderen Bildschirminhalten gleichgestellt: Es ist nur einen Tab weit von den Nachrichten auf ...-Online entfernt, einen anderen von Facebook oder Twitter. Damit reduziert es sich auf seinen textlich-semantischen Inhalt — seine bildhaften Botschaften geraten zu Annäherungen, die ebensogut fehlgehen mögen, da der Endpunkt des Übermittelungsprozesses, anders als beim Faksimile, nicht in der Macht der Herstellenden liegt. Hier kann kein Drucker gescholten werden, weil der Purpur wenig nach Purpur aussieht, sondern nach Signalrot — au contraire, es fällt kaum auf, weil das vergleichende Auge auf dem Übertragungsweg abhanden gekommen ist, zudem ihm die Erfahrung an Originalen fehlt.
Andererseits können bei genügend hoher Bildauflösung Details gezeigt werden, die dem normalen Blick ohne Hilfsmittel wie Lupen, Mikroskope und dergleichen verschlossen blieben.
Eingeschränkte Sinnlichkeit
Nun steht zu befürchten, daß in Zeiten knapper öffentlicher Kassen die Bibliotheken ihre Benutzer mehr und mehr auf Online-Zugriffe beschränken, die Öffnungszeiten reduzieren, gar wertvolle Stücke kaum mehr werden vorlegen wollen außer in den berüchtigten monumentalen Ausstellungen, die Publikum, gleich welches, von überallher anlocken sollen, die Existenzberechtigung des Museums wie der Kultur an sich zu beweisen.
An dieser Stelle möchte ich festhalten, daß Digitalisate immer einen Verlust bedeuten. Lebt der Mensch in einem Umfeld, das alle seine Sinne anspricht, wie es beim herkömmlichen Buch noch der Fall ist (auch wenn es selten verspeist wurde), so schränkt das digitalisierte, dadurch zweidimensionale Endprodukt seine Rezeption auf den Sehsinn ein, der zudem die Räumlichkeit des Betrachteten in seiner Vorstellung hinzugeben muß.
Nicht allein das, auch die einem alten Buch immanenten Hinweise auf seinen Entstehungsprozeß wie Buchdruck, Büttenpapier, Bindemethode, Art des Leinens, Leders oder Pergamentes, die bereits beim neueren weniger sind, da maschinell gefertigte Materialien und Photosatz verwendet werden, während zuvor mit der fachmännischen Hand gearbeitet wurde, gehen beim Digitalisat gegen Null. Gerade jedoch diese aus der Genese eines menschlichen Produktes rührenden Beiläufigkeiten machen die ihm eigene ‚Menschlichkeit’ aus: Es wird dadurch für uns begreiflich, kann zeitlich und handwerklich eingeordnet werden und Metainformationen liefern, die einen Kontext darum aufbauen, in dem wir uns zuhause fühlen dürfen.
Um es deutlich zu machen: Das digitalisierte Original einer Handschrift und das digitalisierte Lichtdruckfaksimile derselben wären auf dem Bildschirm nur bei sehr hoher Auflösung unterscheidbar. Die minimale Erhöhung der Farbe des Kupferstiches, die größere der Miniaturmalereien, der Eindruck des Buchdruckes, die Narbung des Leders ebenso wie die Vertiefungen der Goldprägung werden der Bildschirmnivellierung unterzogen.
Folgen für den antiquarischen Markt
Krankte der deutsche Nachkriegsmarkt, teils ausgeglichen durch den erhöhten Bedarf öffentlicher Institutionen, eh an der durch Flucht und Ermordung kleiner gewordenen Bildungsschicht und folglich an weniger allgemeinem, täglichem Umgang mit gedrucktem, gemaltem sowie selbstmusiziertem Kulturgut, wie es in den gutbürgerlichen Kreisen zuvor üblich gewesen war, so wird der früher selbstverständliche Ansatz, aktiv mit Tradition sowie der eigenen Kultur umzugehen und sich als fortführender Teil ihrer zu verstehen, noch weiter zurückgehen.
Kultur ist in meinem Verständnis nicht das nur intellektuelle Auseinandersetzen mit Inhalten, sondern ein Ganzes, Vielschichtiges, das als solches verstanden, auf allen seinen Ebenen dem Teilhabenden Bedeutung zurückerstattet.
Begrenzt auf semantische Qualität — ohne die Stofflichkeit des Marmors oder Papiers — geht nicht allein der Rest verloren, sondern Kultur selbst reduziert sich und entsagt ihrer früheren, lebensumhüllenden Fülle.
Auch heißt leichterer Zugang zu allem und jedem mittels digitalisierter Abbilder noch lange nicht, daß mehr Verstehen entsteht, sondern ein anderes, wenn überhaupt, das sich auf Teile des Ganzen, wie oben angedeutet, beschränkt: Mit den Digitalisaten kann kein persönlicher Umgang entstehen, schalte ich den Computer oder das Lesegerät aus, sind sie entschwunden — im Gegensatz zum Ölbild oder gedruckten Buch, das ohne mein Zutun sichtbar und greifbar weiterexistiert, auch wenn es im Regal oder in der Vitrine ruht.
Und schließlich wird wohl gelten, daß alles, was in digitalisierter Form vorliegt, irgendwann, auf irgendeine Weise zum Freiwild gerät, da seine Immaterialität einem geldlichen Gegenwert widerspricht. So wie die Musikstücke auf MP3-Format geschrumpft die Festplatten füllen, so werden auch die ungelesenen Texte weitere Festplatten besetzen, allein des Sammelns wegen. Diese Vervielfältigung kann nur zu Wertverlust führen, nicht allein der Geldeswert ist gemeint, sondern gleichfalls der ideelle.
Daher halte ich beide kulturellen Einschnitte, den während der Nazizeit bis nach dem letzten Krieg und den jetzigen durch die Digitalisierung, in ihren Folgen (wohlgemerkt: nur darin!) für vergleichbar, durch ihre zeitliche Abfolge sich in ihrer Wirkung verstärkend und dem weiteren lebensvollen Tradieren europäischen Geistesgutes für wenig zuträglich.
Ausblick
Neben dem Gebrauchsbuch, dessen Nutzen sich vorerst im Lesen unterwegs, im Bett oder dergleichen erhalten wird, einfach weil die Menschen es so gewohnt sind und die jüngeren, denen es noch nicht Usus geworden ist, die eventuell den Bildschirm vorzögen, in den nächsten Jahren keine so große Marktmacht in diesem Sektor darstellen werden — neben diesem wird es weiterhin das antiquarische und künstlerische Buch geben, das fortan in die Nähe von Antiquitäten, Luxus und gehobener Kultur rückt, dessen Käuferkreis sich also dementsprechend verkleinern wird, da der zu seiner Rezeption notwendige Bildungsgrad höchstwahrscheinlich noch weniger als jetzt wird vorausgesetzt werden können.
Fraglich bleibt, inwieweit künftige, an Digitalisate gewöhnte Benutzer imstande sein werden, sich dem Buch zuzuwenden, ob es für sie nicht eine obsolete Sache darstellt, der nur noch eignet, fossiliengleich in Ausstellungen und Museen bewundert zu werden.
Auf eine solche oder ähnliche Entwicklung werden sich Plattformen wie Antiquare möglichst rechtzeitig einstellen müssen. Das bedeutet schichtenspezifisch agieren und werben, die Gebrauchsbücher anders und für eine andere Kundengruppe präsentieren als die antiquarischen. Antiquare müßten sich allen Alt-68er-Bestrebungen zum Trotz eingestehen, für eine Elite zu arbeiten.
Resümee
Um auf den Titel zurückzukommen, der Schatten ist jenes aus Vergangenheit, Brauchtum und Selbstverständnis erlangte Bild, das ich von mir, Sie, werter Leser, von sich haben. Man lebt mit ihm, füttert es, und wird dafür als Gegenleistung von ihm beeinflußt oder erhält Mahnrufe.
Der Antiquar wird nicht mit Digitalisaten handeln können. Es fehlt ihnen die sie rar machende Stofflichkeit, sowieso das Handwerkliche. Was ein wertvolles gedrucktes Buch in seinem Handeinband auszeichnet, nämlich daß es selbst mit all den Spuren verflossener Zeit wie seiner Vorbesitzer, wegen all dieser Spuren, einzigartig ist, dies kann dem Digitalen nicht zugebilligt werden. Selbst die nach n Jahren gezogene n-te Kopie ist dem Original gleich. Marginalien werden in einer separaten Datei abgespeichert und sind nur die Überbleibsel von Kratzern auf dem Bildschirm.
Auch wird der Antiquar nicht mit Informationen über das von ihm angehäufte Gut handeln können, denn zum einen ist er selten allumfassend gebildet genug, darüber Bescheid zu wissen, ist zum anderen dies Wissen, einmal in eine digitalisierte Sphäre entlassen, Freiwild.
Doch nichts spricht gegen das Benutzen der digitalen Spären, ich meine des Internetzes, der E-Post, des elektronischen Kataloges für die Zwecke des antiquarischen Handels. Das dort präsentierte Buch will gerade nicht als Surrogat des realen stehen, sondern Beschreibung wie Bild verstehen sich als Hinweiszeichen auf das wirkliche, so wie im gedruckten Katalog, der ebenfalls nicht die in ihm dargebotenen Objekte ersetzen will, sondern sie anpreisen.
Die Kunst selbst hingegen ist nur durch das Kunstobjekt zu rezipieren und zu begreifen. Der Stofflichkeit seiner Handelsobjekte läßt sich der Antiquar nicht entkleiden, eher seines Ruhmes, falls der ihn je verfolgt haben sollte, eher seiner Berufsgrundlagen.
Die Welt dort draußen war kompliziert, aber mit Käsetoast, Liebe und einem soliden Handwerk würden sie sicher und glücklich leben bis an ihr Ende.
Philip Pullman: Ich war eine Ratte