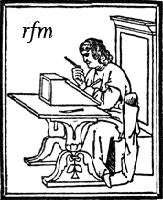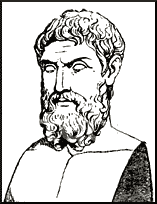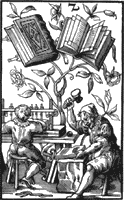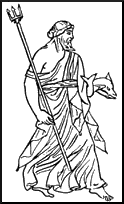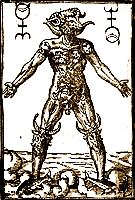George Gordon Byron: The Vampyre, Der Vampyr
Die Blutsauger
E. T. A. Hoffmann: Vampirismus
Théophile Gautier: La Morte Amoureuse
Varney the Vampire; or, the Feast of Blood
Der Vampyr
Der Vampyr, eine Erzählung von Lord Byron
 s ereignete ſich, daß mitten unter den Zerſtreuungen eines Winters zu London, in den verſchiedenen Geſellſchaften der tonangebenden Vornehmen ein Edelmann erſchien, der ſich mehr durch ſeine Sonderbarkeiten, als durch ſeinen Rang auszeichnete. Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her mit einer Miene, als könne er nicht an derſelben Theil nehmen. Nur das leichte Lachen der Schönen ſchien ſeine Aufmerkſamkeit zu erregen, allein es ſchien auch, als wenn ein Blick aus ſeinem Auge es plötzlich hemme und Furcht in die vorher heitere und unbefangene Bruſt der Fröhlichen ſtreue. Diejenigen, welche dieſen Schauder empfanden, konnten nicht angeben, woher er entſtehe; einige ſchrieben ihn dem faſt ſeelenloſen grauen Auge zu, das, wenn es ſich auf das Geſicht eines Menſchen richtete, obſchon an ſich nichts eindringendes zu haben, doch oft mit einem Blicke das innerſte Herz zu durchbohren ſchien; richtete es ſich auf die Wange, ſo ſchien der Stral ſchwer wie Bley zu ſeyn, der die Haut nicht durchdringen könne. Seiner Sonderbarkeit wegen wurde er in jedes Haus eingeladen; alle wünſchten ihn zu ſehen, und diejenigen, welche an lebhafte Aufregung gewohnt waren und nun die Laſt der Langeweile fühlten, freuten ſich, ein Weſen um ſich zu ſehen, welches ihre Aufmerkſamkeit zu feſſeln vermochte. Trotz der todtenbleichen Farbe ſeines Geſichts, das weder von dem Erröthen der Scham, noch dem Aufwallen der Leidenſchaft jemals ein wärmeres Colorit bekam, obgleich die Form und Umriſſe deſſelben ſehr ſchön waren, verſuchten es doch einige weibliche Glücksjäger, ſeine Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen, um wenigſtens einige Beweiſe von dem zu erhalten, was ſie Zuneigung nennen mochten; Lady Mercer, welche ſeit ihrer Verheirathung der Gegenſtand des Spottes jeder Häßlichen in der Geſellſchaft geweſen war, ſtellte ſich ihm in den Weg, und ſuchte auf alle Weiſe ſelbſt durch den auffallendſten Anzug ſeine Aufmerkſamkeit zu reizen, – allein umſonſt – wenn ſie vor ihm ſtand und ſeine Augen dem Anſcheine nach auf die ihrigen gerichtet waren, ſchien es doch immer, als würde ſie nicht bemerkt, ſelbſt ihre freche Unverſchämtheit wurde endlich verwirrt und ſie verließ das Feld. Allein obgleich eine ſo bekannte freie Dame nicht einmal die Richtung ſeiner Augen beſtimmen konnte, ſchien das weibliche Geſchlecht ſelbſt ihm keinesweges gleichgültig zu ſeyn, indeſſen war die anſcheinende Vorſicht, mit der er ein tugendhaftes Weib, ein unſchuldiges Mädchen anredete, ſo groß, daß ſich nur wenige überhaupt deſſen rühmen konnten. Er behauptete jedoch den Ruf eines einnehmenden Sprechers, und ſey es nun, daß dies ſelbſt die Furcht vor ſeinem ſeltſamen Character überwand, oder daß man ſich von ſeinem anſcheinenden Haſſe gegen das Laſter rühren ließ, genug, er befand ſich eben ſo oft unter ſolchen Frauen, welche den Glanz ihres Geſchlechts in häuslichen Tugenden ſuchen, als unter ſolchen, die ihn durch ihre Laſter beflecken.
s ereignete ſich, daß mitten unter den Zerſtreuungen eines Winters zu London, in den verſchiedenen Geſellſchaften der tonangebenden Vornehmen ein Edelmann erſchien, der ſich mehr durch ſeine Sonderbarkeiten, als durch ſeinen Rang auszeichnete. Er blickte auf die laute Fröhlichkeit um ihn her mit einer Miene, als könne er nicht an derſelben Theil nehmen. Nur das leichte Lachen der Schönen ſchien ſeine Aufmerkſamkeit zu erregen, allein es ſchien auch, als wenn ein Blick aus ſeinem Auge es plötzlich hemme und Furcht in die vorher heitere und unbefangene Bruſt der Fröhlichen ſtreue. Diejenigen, welche dieſen Schauder empfanden, konnten nicht angeben, woher er entſtehe; einige ſchrieben ihn dem faſt ſeelenloſen grauen Auge zu, das, wenn es ſich auf das Geſicht eines Menſchen richtete, obſchon an ſich nichts eindringendes zu haben, doch oft mit einem Blicke das innerſte Herz zu durchbohren ſchien; richtete es ſich auf die Wange, ſo ſchien der Stral ſchwer wie Bley zu ſeyn, der die Haut nicht durchdringen könne. Seiner Sonderbarkeit wegen wurde er in jedes Haus eingeladen; alle wünſchten ihn zu ſehen, und diejenigen, welche an lebhafte Aufregung gewohnt waren und nun die Laſt der Langeweile fühlten, freuten ſich, ein Weſen um ſich zu ſehen, welches ihre Aufmerkſamkeit zu feſſeln vermochte. Trotz der todtenbleichen Farbe ſeines Geſichts, das weder von dem Erröthen der Scham, noch dem Aufwallen der Leidenſchaft jemals ein wärmeres Colorit bekam, obgleich die Form und Umriſſe deſſelben ſehr ſchön waren, verſuchten es doch einige weibliche Glücksjäger, ſeine Aufmerkſamkeit auf ſich zu ziehen, um wenigſtens einige Beweiſe von dem zu erhalten, was ſie Zuneigung nennen mochten; Lady Mercer, welche ſeit ihrer Verheirathung der Gegenſtand des Spottes jeder Häßlichen in der Geſellſchaft geweſen war, ſtellte ſich ihm in den Weg, und ſuchte auf alle Weiſe ſelbſt durch den auffallendſten Anzug ſeine Aufmerkſamkeit zu reizen, – allein umſonſt – wenn ſie vor ihm ſtand und ſeine Augen dem Anſcheine nach auf die ihrigen gerichtet waren, ſchien es doch immer, als würde ſie nicht bemerkt, ſelbſt ihre freche Unverſchämtheit wurde endlich verwirrt und ſie verließ das Feld. Allein obgleich eine ſo bekannte freie Dame nicht einmal die Richtung ſeiner Augen beſtimmen konnte, ſchien das weibliche Geſchlecht ſelbſt ihm keinesweges gleichgültig zu ſeyn, indeſſen war die anſcheinende Vorſicht, mit der er ein tugendhaftes Weib, ein unſchuldiges Mädchen anredete, ſo groß, daß ſich nur wenige überhaupt deſſen rühmen konnten. Er behauptete jedoch den Ruf eines einnehmenden Sprechers, und ſey es nun, daß dies ſelbſt die Furcht vor ſeinem ſeltſamen Character überwand, oder daß man ſich von ſeinem anſcheinenden Haſſe gegen das Laſter rühren ließ, genug, er befand ſich eben ſo oft unter ſolchen Frauen, welche den Glanz ihres Geſchlechts in häuslichen Tugenden ſuchen, als unter ſolchen, die ihn durch ihre Laſter beflecken.
Um dieſe Zeit kam ein junger Edelmann, Namens Aubry, nach London. Er war verwaiſt. Seine Eltern, die er ſchon in früher Kindheit verlor, hatten ihn und ſeiner einzigen Schweſter ein ſehr großes Vermögen hinterlaſſen. Die Vormünder nahmen ſich mehr der Verwaltung ſeines Vermögens, als der Sorge für ſeine Erziehung an, und ſo blieb dieſe in den Händen von Miethlingen, welche mehr ſeine Phantaſie, als ſeinen Verſtand zu bilden ſuchten. Er beſaß daher jenes hohe romantiſche Gefühl für Ehre und Aufrichtigkeit, welches täglich ſo viel Hundert Lehrlinge zu Grunde richtet. Er glaubte, alle Menſchen müßten die Tugend lieben, und dachte, das Laſter ſey von der Vorſehung blos des ſceniſchen Effectes wegen in das Weltdrama eingewebt worden; er dachte, das Elend in den Hütten beſtehe blos in der Kleidung, die doch warm ſey und dem Auge des Malers durch den unregelmäßigen Faltenwurf, die bunten Flecke darauf beſſer zuſage. Mit einem Worte, er hielt die Träume der Dichter für die Wirklichkeiten des Lebens. Er war hübſch, frei und reich; drei Urſachen, warum ihn beim Eintritt in die heitern Zirkel der Welt viele Mütter umringten, und Alles verſuchten, was ihre ſchmachtenden oder ſcheidenden Günſtlinge mit den lebhafteſten Farben zu ſchildern vermochten, indeß die Töchter durch ihr glänzendes Benehmen, wenn er ſich ihnen näherte, und durch ihre blitzenden Augen, wenn er die Lippen öffnete, ihn zu falſchen Vorſtellungen von ſeinen Talenten und ſeinem Verdienſte verleiteten. Seiner romantiſchen Einſamkeit ganz hingegeben ſtaunte er nicht wenig, als er fand, daß, die Talg- oder Wachslichter ausgenommen, welche nicht vor der Gegenwart eines Geiſtes, ſondern aus Mangel an Lichtputzen flackerten, in dem wirklichen Leben durchaus kein Grund zu Anhäufung jener lachenden Gemälde und Beſchreibungen vorhanden ſey, wie ſie ſich in den Büchern fanden, die er zum Gegenſtand ſeines Studiums gemacht hatte. Da er indeſſen einige Vergütung in ſeiner geſchmeichelten Eitelkeit fand, war er im Begriff, ſeine Träume aufzugeben, als das außerordentliche Weſen, welches wir oben beſchrieben haben, ihm in den Weg trat.
Er beobachtete ihn, und die völlige Unmöglichkeit, ſich einen Begriff von dem Character eines Mannes zu bilden, der blos in ſich ſelbſt verſunken, wenig andere Zeichen ſeiner Beachtung äußeren Gegenſtände von ſich gab, als die ſtillſchweigende Anerkennung ihres Daſeyns vollendete die Vermeidung gegenſeitiger Berührung. Da er ſeiner Phantaſie geſtattete, jedes Ding, das ſeiner Neigung zu ſeltſamen und ausſchweifenden Ideen ſchmeichelte, ſorgfältig auszumalen, ſo hatte er auch ſchon dieſes Weſen zum Helden eines Romans umgebildet, und betrachtete nunmehr den Sprößling ſeiner Phantaſie als die lebende Perſon außer ihm. Er wurde bekannt mit ihm, bewies ihm Aufmerkſamkeiten und gelangte doch ſo weit bei ihm, daß er ſeine Gegenwart anerkannte. Er erfuhr nach und nach, daß Lord Ruthvens Angelegenheiten zerrüttet ſeyen, und daß er im Begriff ſtehe, eine Reiſe zu unternehmen. Voll Verlangen über dieſen ſeltſamen Character, der bis jetzt ſeine Neugier nichts weniger als befriedigt hatte, genauere Forſchungen anzuſtellen, äußerte er ſein Vormündern, daß es nun Zeit für ihn ſeyn möchte, die Tour zu machen, die man ſeit Jahrhunderten für nöthig gehalten habe, und den Jüngling in den Stand zu ſetzen, einige raſche Fortſchritte auf der Bahn des Laſters zu machen, und ſo die Aeltern einzuhohlen, damit er nicht wie aus den Wolken gefallen ſcheine, wenn man empörende Intriguen als Gegenſtände des Spottes oder Lobes behandele, je nachdem dabei mehr oder weniger Geſchicklichkeit aufgewendet worden ſey. Sie ſtimmten in ſein Begehren. Aubray gab dem Lord Ruthven ſogleich ſeine Abſicht zu erkennen, und erſtaunte nicht wenig, von ihm den Antrag zu erhalten, die Reiſe gemeinſchaftlich zu machen. Geſchmeichelt durch ſolch ein Zeichen der Achtung von dem, der dem Anſcheine nach mit andern Menſchen nichts gemein hatte, nahm er ihn freudig an, und in wenig Tagen hatten ſie das trennende Meer überſchritten.
Bisher hatte Aubrey keine Gelegenheit gehabt, Lord Ruthvens Character zu ſtudiren, und nun fand er, daß, da er mehrere ſeiner Handlungen beobachten konnte, die Reſultate verſchiedene Schlüſſe auf die ſcheinbaren Bewegungsgründe ſeines Betragens darboten. Sein Gefährte war verſchwenderiſch-freigebig – der Faule, der Landſtreicher, der Bettler erhielt aus ſeinen Händen mehr als genug, um den augenblicklichen Mangel zu ſtillen. Der tugendhafte, unverſchuldete Arme hingegen ging oft unbefriedigt von ſeiner Thüre, wurde wohl gar mit höhniſchem Lachen abgewieſen. Der Lüſtling, der ſich immer tiefer in den Schlamm ſeiner Ausſchweifungen verſenken wollte, konnte auf ſeine Unterſtützung rechnen. Ein Umſtand war indeß bei den Geſchenken des Lords ſeinem Gefährten bemerklich geworden; es ruhte offenbar der Fluch auf ihnen, denn die Empfänger waren entweder dadurch auf das Schaffot gebracht worden, oder in das tiefſte, verachtungswertheſte Elend verſunken. In Brüſſel und andern großen Städten hatte der Lord zu Aubrey’s Verwunderung die Cirkel der großen Welt aufgeſucht. Er ſpielte und wettete, erſteres ſtets mit Glück, außer wenn ein bekannter Gauner ſein Gegner war, dann verlor er mehr als er gewonnen hatte, allein ſein Geſicht behielt dieſelbe Unveränderlichkeit, womit er gemeiniglich die Geſellſchaft umher beobachtete. Wenn er aber dem raſchen, unbeſonnenen Jünglinge begegnete, oder dem unglücklichen Vater einer zahlreichen Familie, dann ſchien ſein Wunſch Fortunens Geſetz zu werden, die anſcheinende Abſtractheit ſeines Gemüths verſchwand und ſeine Augen glänzten, wie die der Katze, wenn ſie mit der halbtodten Maus ſpielt. Indeſſen nahm er keinen Groſchen vom Spieltiſche mit, ſondern verspielte zum Ruin manches Andern, die letzte Münze, die er eben aus der Hand der Verzweiflung gewonnen hatte; dieſes mochte das Reſultat eines gewiſſen Grades von Einſicht ſeyn, die jedoch nicht im Stande war, die ſchlauere Erfahrung zu täuſchen. Aubrey wünſchte oft ſeinem Freunde dies vorzuſtellen und ihn zu bitten, einer Freigebigkeit und einem Vergnügen zu entſagen, welches alle Menſchen unglücklich mache und ihm keinen Vortheil gewähre, allein er verſchob es immer in der Hofnung, eine recht paſſende Gelegenheit dazu zu erhalten, welche ſich nie zeigte. Lord Ruthven war in ſeiner Laufbahn, und mitten unter den mannigfachen bald wilden, bald lachenden Naturscenen immer derſelbe – ſein Auge ſprach noch weniger als ſeine Lippen, und obgleich Aubrey nun dem Gegenſtande ſeiner Neugier ſo nahe war, als er ſeyn konnte, hatte er doch dadurch nichts mehr, als eine ſtärkere Anreizung zu Enthüllung des Geheimniſſes erhalten, das ſeiner exaltirten Einbildungskraft immer mehr wie etwas Uebernatürliches verkam.
Sie gelangten bald nach Rom, und Aubrey verlor ſeinen Gefährten einige Zeit aus den Augen. Dieſer befand ſich täglich in den Morgenzirkeln einer italiäniſchen Gräfin, indeß er die Denkmäler einer längſt untergegangenen Vorwelt aufſuchte. Unter dieſer Beſchäftigung erhielt er Briefe aus England, die er mit der größten Sehnſucht öffnete. Der erſte war von ſeiner Schweſter und athmete die reinſte Zärtlichkeit; die andern waren von ſeinen Vormündern, und dieſe ſetzten ihn in Erſtaunen. Hatte er ſchon vorher den Gedanken gehegt, daß in ſeinem Gefährten irgend ein böſer Geiſt wohnen möge, ſo erhielt derſelbe nun dadurch volle Beſtätigung. Die Vormünder drangen in ihn, er möchte ſogleich ſich von ſeinem Freunde trennen, denn da dieſer eine unwiderſtehliche Macht der Verführung zu beſitzen ſcheine, ſo werde ſein Umgang höchſt gefährlich. Man habe nämlich entdeckt, daß ſeine Verachtung gegen Lady Mercer nicht auf ihren Character ſich gegründet, ſondern daß er, um ſeine Gunſtbezeugung zu erhöhen, verlangt habe, daß ſein Schlachtopfer, die Theilnehmerin ſeiner Schuld, von dem Gipfel unbefleckter Tugend in den tiefſten Abgrund des Laſters habe herabgeſchleudert werden ſollen. Auch ſey man nun gewiß geworden, daß alle Frauen, die er dem Scheine nach ihrer Tugend wegen aufgeſucht, ſeit ſeiner Abreiſe ſich in ganz anderm Lichte, ja in der höchſten Unverſchämtheit gezeigt hätten.
Aubrey beſchloß, nunmehr einen Mann zu verlaſſen, deſſen Character auch nicht einen Lichtſtral zeigte, auf dem das Auge mit Luſt weilen konnte. Er beſchloß auf einen Vorwand zu ſinnen und ſich von ihm zu trennen, doch in der Zwiſchenzeit ihn noch genauer als vorher zu beobachten, und nicht den geringſten Umſtand aus der Acht zu laſſen. Er begab ſich in denſelben Zirkel und ſahe, daß der Lord verſuchte, auf die unerfahrne Tochter des Hauſes zu wirken. In Italien iſt es ſelten, daß man unvermählte Damen in der Geſellſchaft trifft, daher mußte er ſeine Pläne im Geheim auszuführen ſuchen. Allein Aubrey’s Auge folgte ihm in allen ſeinen Wendungen, und bald bemerkte er, daß es bis zu einem Rendezvous gekommen ſey, wo wahrſcheinlich die Unſchuld des verdachtloſen Mädchens geopfert werden ſollte. Ohne Zeitverluſt trat er zu dem Lord Ruthven ins Zimmer, und fragte ihn unverholen nach ſeiner Abſicht mit der Signora; der Lord verſetzte, ſeine Abſicht ſey die bei ſolchen Gelegenheiten gewöhnliche, und auf die abermalige Frage, ob er denn das Mädchen zu heyrathen gedenke, lachte er laut. Aubrey entfernte ſich, ſchrieb ihm aber auf der Stelle einen Abſchiedsbrief, ließ ſeine Sachen in eine andere Wohnung bringen, und unterrichtete die Mutter von Allem, was er wußte, auch von des Lords Character. Das Rendezvous wurde verhindert. Den andern Tag ſandte der Lord eine Erklärung, daß er mit der Trennung wohl zufrieden ſey, ließ aber nicht das Geringſte merken, daß er wiſſe, ſein Plan ſey durch Aubrey vereitelt worden.
Nachdem Aubrey Rom verlaſſen, wandte er ſeine Schritte nach Griechenland, und befand ſich nach Durchſtreifung der Halbinſel zu Athen. Er nahm hier ſeine Wohnung in dem Hauſe eines Griechen, und bald beſchäftigte er ſich damit, die erbleichenden Erinnerungen alter Herrlichkeit auf den Denkmälern aufzuſuchen, die ſich ſchämend, die Thaten freier Menſchen vor Sclaven zu erzählen, ſich entweder in die ſchützende Erde verſteckt, oder hinter rankende Geſträuche verborgen hatten. Mit ihm unter einem Dache aber lebte ein Weſen ſo zart und ſchön, daß es einem Maler hätte zum Model dienen können, der die den Gläubigen in Mahomets Paradieſe versprochene Hoffnung hätte lebend abbilden wollen, nur daß ihr Auge zu viel Seele zeigte, als daß man es denen hätte zutheilen können, welche keine Seelen haben. Wenn ſie auf der Ebene tanzte, oder längs den Gebirgen hinsprang, glaubte man eine Gazelle zu ſehen, aber ihr Auge, aus dem die ganze beſeelte Natur zu ſprechen ſchien, wo hätte dieſes ein Gleichniß gefunden? – Janthe’s leichter Schritt begleitete Aubrey oft auf ſeinen forſchenden Wanderungen, und nicht ſelten enthüllte das unbefangene Geſchöpf bei Verfolgung eines Schmetterlings alle Reize ſeiner ſchönen Geſtalt dem gierigen Blicke des Fremdlings, der nun gern die kaum entzifferten Buchſtaben auf einer halbverlöſchten Tafel über dem Anſchauen dieſer lebenden Schönheit vergaß. Die Flechten ihres ſchönen blonden Haares glichen, um ihr Haupt herabfallend, den Sonnenſtralen, und verdunkelten das Auge des Antiquars, ſtatt es zu erleuchten. Doch wozu der Verſuch, das Unbeſchreibliche zu beſchreiben?
Wenn er bemüht war, die Ueberreſte der alten Welt in Zeichnungen für künftige Stunden aufzubewahren, ſo ſtand das Mädchen bei ihm, ſeine Arbeit bewundernd, und ihm die ländlichen Tänze ihrer Heimath beſchreibend, oder einen Hochzeitszug, deſſen ſie ſich noch aus ihrer Kindheit erinnerte. Oft erzählte ſie ihm auch Märchen, worunter ſich das von einem lebenden Vampyr befand, der Jahrelang unter ſeinen Freunden und Verwandten umhergegangen ſey, gezwungen, jedes Jahr, durch Aufzehrung des Lebens eines ſchönen Weibes ſeine Exiſtenz für die nächſte Zeit zu verlängern. Aubrey gerann dabei das Blut in den Adern, indeß er verſuchte die Erzählerin wegen ihrer furchtbaren Phantaſien auszulachen. Janthe aber nannte ihm die Namen alter Leute, welche ein ſolches Weſen erſt unter ſich entdeckt hatten, als viele ihrer nächſten Verwandten und Kinder mit den Zeichen des geſtillten Appetits ihres Feindes gefunden worden waren, und als ſie ihn ſo ungläubig fand, bat ſie ihn, ihr doch ja zu glauben, denn man habe bemerkt, daß die, welche es gewagt hätten, die Exiſtenz der Vampyrn zu bezweifeln, genöthigt worden waren, mit gebrochenem Herzen endlich die Wahrheit einzugeſtehen. Sie beſchrieb ihm das Aeußere dieſer Weſen der Sage gemäß, und wie groß war ſein Entſetzen, als er darin eine treue Schilderung des Lord Ruthven erkannte; demohngeachtet ſuchte er ihr ihre Furcht auszureden, ob er ſich gleich verwunderte über ſo Manches, das hier zuſammengetroffen war, um den Glauben an eine übernatürliche Gewalt des Lords Ruthven zu begründen.
Aubrey neigte ſich immer mehr und mehr zu Janthen hin; ihre Unſchuld, im Contraſte mit den affectierten Tugenden der Weiber, unter denen er Urbilder ſeiner romantiſchen Ideen geſucht hatte, gewann ſein Herz, und indeß er es lächerlich fand, daß ein junger Engländer ein unerzogenes griechiſches Mädchen heyrathen wolle, fand er ſich immer ſtärker und ſtärker von der ſchönſten Geſtalt angezogen, die er je geſehen hatte. Janthe ahnete dieſe aufkeimende Liebe nicht, und blieb ſich in ihrer erſten kindlichen Unbefangenheit immer gleich. Sie trennte ſich zwar immer ungern von Aubrey, allein meiſtens deshalb, weil ſie nun Niemand hatte, unter deſſen Schutze ſie ihre Lieblingsorte beſuchen konnte. In Hinſicht der Vampyrs hatte ſie ſich auf ihre Eltern berufen, und beide beſtätigten, bleich vor Schrecken ſchon bei Nennung des Worts, die Wahrheit der Sache.
Kurz darauf wollte Aubrey wieder einen Ausflug machen, der ihn einige Stunden beſchäftigen konnte; als die Leute den Namen des Ortes hörten, baten ſie ihn dringend, nur nicht des Nachts zurückzukehren, weil er durch einen Wald reiten müſſe, wo ſich kein Grieche nach Sonnenuntergang zu verweilen pflege. Hier hielten nämlich die Vampyre ihre nächtlichen Orgien, und wehe dem, der ihnen dabei begegnete. Die Leute entſetzten ſich, als er es wagte über die Gewalt unterirdiſcher Mächte zu ſpotten, und ſo ſchwieg er.
Am nächſten Morgen begab ſich Aubrey ohne alle Begleitung auf ſeine Wanderung; er wunderte ſich über das ſchwermüthige Anſehen ſeines Wirthes, und war ſehr bewegt, als er hörte, daß ſeine Worte, womit er den Glauben an jene furchtbaren Feinde verspotten wollen, auf die Familie ſo ſchreckend gewirkt hatten. Als er ſich zu Pferde ſetzte, bat ihn Janthe nochmals, vor Nachts zurückzukehren, und er versprach es.
Seine Nachforſchungen beſchäftigten ihn indeſſen dergeſtalt, daß er das Abnehmen des Tages nicht bemerkte, und wie ſich am Horizonte eine von den kleinen Wolken zeigte, die in wärmern Climaten ſo ſchnell zu furchtbaren Gewittern anwachſen und oft Verheerung über ganze Gegenden verbreiten. Er beſtieg demohngeachtet ſein Pferd, um durch Eile die versäumte Zeit nachzuholen, allein zu ſpät. Die Dämmerung iſt in jenen Gegenden faſt ganz unbekannt; ſogleich nach Untergang der Sonne wird es Nacht, und er war noch nicht weit geritten, als das Ungewitter mit Sturm, Regen, Blitz und Donner losbrach. Sein Pferd wurde ſcheu und ſtürmte mit furchtbarer Schnelligkeit durch den finſtern Wald hin. Endlich blieb es ermüdet ſtehen, und beim Scheine der Blitze erkannte er, daß er ſich in der Nähe einer Hütte von Binſen oder Rohr befinde, die kaum aus der Maſſe welker Blätter und verworrenen Gebüſches hervorſah, womit ſie umgeben war. Er ſtieg ab und näherte ſich in der Hoffnung, entweder einen Führer nach der Stadt oder wenigſtens Schutz vor dem Ungewitter zu finden. Als er ganz nahe war und der Donner einen Augenblick ſchwieg, vernahm er das ſchreckliche Geſchrei einer weiblichen Stimme, untermiſcht mit einem höhniſchen Gelächter, das faſt ununterbrochen fortdauerte. Er ſtutzte, aber aufgeſchreckt von dem über ihn hinrollenden Donner erbrach er mit einer gewaltigen Anſtrengung die Thür der Hütte. Er ſtand in dicker Finſterniß, doch leitete ihn der Schall; er rufte, aber der Ton dauerte fort. Man ſchien ihn nicht zu bemerken. Er ſtieß endlich mit Jemanden zuſammen, den er ſogleich faßte; da ſchrie eine Stimme: Abermals getäuſcht! worauf ein lautes Gelächter folgte. Endlich fühlte er ſich ſelbſt von Jemand ergriffen, der eine übermenſchliche Stärke zu haben ſchien. Er beſchloß, ſein Leben ſo theuer als möglich zu verkaufen, und kämpfte, allein vergebens, ſeine Füße glitten aus und er wurde mit ungeheurer Gewalt zu Boden geworfen. Sein Feind warf ſich auf ihn und ſtemmte ihm die Hand auf die Bruſt, da fiel der Schein einiger Fackeln durch das Loch, wodurch das Tageslicht eindrang; ſogleich ſprang jener auf, ließ ſeine Beute los, rannte zur Thür hinaus, und bald vernahm man das Geräuſch der Zweige nicht mehr, durch die er ſich Bahn gemacht hatte.
Der Sturm war nun vorüber, und Aubrey, der ſich nicht rühren konnte, wurde von denen gehört, die draußen waren. Sie traten herein; das Licht der Fackeln fiel auf die ſchmutzigen Wände und die einzelnen Lagerſtätten von Stroh und Binſen, worauf einige Kleidungsſtücke lagen. Auf Aubreys Begehren ſuchte man nach derjenigen, deren Geſchrei ihn angezogen hatte. Er blieb nun wieder im Dunkeln; allein wer mahlt ſein Entſetzen, als er beim Lichte der rückkehrenden Fackeln die reizende Geſtalt ſeiner Führerin erkannte, die jetzt ein lebloſer Leichnam war. Er traute ſeinen Augen kaum, doch ein abermaliges Hinſtarren überzeugte ihn, daß es wirklich das liebliche Geſchöpf ſey. Auf ihren Wangen, ſelbſt auf ihren Lippen war keine Farbe mehr; doch war über das Geſicht eine Ruhe verbreitet, die faſt ſo anziehend ſchien, als das ſonſt hier wohnende Leben; auf ihrem Nacken und ihrer Bruſt war Blut ſichtbar, und an der letztern ſogar das Zeichen von Zähnen, die eine Ader geöffnet hatten. Plötzlich riefen die Männer mit Entſetzen darauf hindeutend: ein Vampyr! ein Vampyr! Man machte eine Tragbahre und legte Aubrey an die Seite derjenigen, welche vor Kurzem noch der Gegenſtand ſeiner Bewunderung und manches ſüßen Traumes geweſen war. Er wußte nicht, was er denken ſollte, ſein Geiſt verſank in eine wohlthätige Betäubung; auf einmal ergriff er faſt bewußtlos einen bloßen Dolch von ganz beſonderer Bildung, der in der Hütte am Boden gelegen hatte; da erſchienen auch Leute, die die Vermißte im Namen der Eltern ſuchten. Als ſie ſie fanden, ſchrien ſie laut auf; und als endlich die Eltern das unglückliche Kind erkannten, ſtarben beide in Kurzem vor Schmerz und Gram.
Aubrey wurde von einem hitzigen Fieber befallen und hatte oft Geiſteſabweſenheiten, in dieſen rufte er den Lord Ruthven und Janthe – durch eine unerklärliche Verbindung der Ideen ſchien er ſeinen frühern Gefährten zu bitten, das Leben derjenigen zu ſchonen, die er liebte. Zu andern Zeiten ſchüttete er Verwünſchungen über ſein Haupt aus, als über ihren Mörder und Verführer.
Lord Ruthven kam um dieſe Zeit ſelbſt nach Athen, und ſobald er von Aubreys Zuſtande hörte, nahm er ſeine Wohnung gleichfalls in demſelben Hauſe und wurde ſein immerwährender Geſellſchafter. Als der Kranke aus ſeiner Geiſtesabweſenheit zu ſich kam, erſchrack und erſtaunte er über den Anblick desjenigen, deſſen Bild er ſtets mit dem eines Vampyrs verwechſelt hatte; allein Lord Ruthven versöhnte den Kranken bald mit ſeiner Gegenwart durch ſeine freundlichen Reden und durch die Reue, die er über den Fehler bezeugte, der ihre Trennung veranlaßt hatte, mehr noch aber durch die Aufmerkſamkeit, Beſorglichkeit und Theilnahme, die er ihm bewies.
Der Lord ſchien in der That gänzlich verändert. Er war gar nicht mehr das theilnahmloſe Weſen, das ſo furchtbar auf Aubrey gewirkt hatte; allein ſo wie deſſen Geneſung vorſchritt, fiel jener auch wieder in ſein voriges Weſen zurück, und Aubrey bemerkte keine Veränderung an ihm, als das zuweilen Ruthvens Blick mit einem Ausdrucke von höhniſchen Lächeln um die Lippen feſt auf ihm zu ruhen ſchien. Dieſes Lächeln erfüllte ihn mit geheimen Schauder, ohne daß er wußte warum.
Aubrey’s Gemüth war durch dieſe Erſchütterung äußerſt angegriffen worden, und jene geiſtige Elaſticität, die ihn ſonſt ausgezeichnet hatte, ſchien auf immer verſchwunden. Er war jetzt ein eben ſo großer Liebhaber der Einſamkeit, als Lord Ruthven, allein ſein Gemüth konnte dieſes Verlangen nicht in der Nachbarſchaft von Athen erfüllt finden; wo er ſich hier hin begab, ſtand Janthe’s liebliche Geſtalt vor ihm; in den Wäldern glaubte er ihren leichten Schritt zu bemerken, wie ſie Veilchen und andere Frühlingsblumen ſuchte, bis ſie ihm plötzlich ihr bleiches Geſicht und ihre verwundete Bruſt mit einem holdſeligen Lächeln auf den roſigen Lippen zu zeigen ſchien. Er beſchloß eine Gegend zu fliehen, wo ihn ſolche Erinnerungen verfolgten, und machte daher dem Lord Ruthven, dem er ſich für die zarte Theilnahme verbunden fühlte, die er ihm während ſeiner Krankheit bewieſen hatte, den Vorſchlag, diejenigen Gegenden Griechenlands zu beſuchen, die ſie noch nicht geſehen hatten. Sie durchſtreiften nun das Land in allen Richtungen, ohne jedoch das ſehr zu beachten, was ſich ihren Blicken darbot. Sie hörten viel von Räubern, fingen jedoch an auf dieſe Nachrichten wenig acht zu geben, weil ſie ſie für die Erfindung eigennütziger Perſonen hielten, welche ihren Schutz theuer verkaufen wollten. Die Warnung der Einwohner überſehend reiſten ſie auch einſt nur mit weniger Bedeckung, die ihnen mehr zu Führern als zum Schutze diente. In einem engen Hohlwege, in deſſen Tiefe ein Bach hinrauſchte, und den auf beiden Seiten hohe Felſenmaſſen umſtarrten, hatten ſie Urſache, ihre Nachläſſigkeit zu bereuen, denn kaum war der ganze Zug in den Engweg hinein, als ſie durch das Pfeifen von Kugeln dicht über ihren Häuptern durch den Knall von Flintenſchüſſen, die das Echo wiederholte, erſchreckt wurden. In einem Augenblicke hatten ſie ihre Wachen verlaſſen, und hinter die Felſen ſich ſtellend begannen ſie in der Richtung zu feuern, woher die Schüſſe tönten. Lord Ruthven und Aubrey ihr Beispiel nachahmend zogen ſich für einen Augenblick hinter die ſchützenden Seitenwände des Hohlweges zurück, allein ſich ſchämend, daß ſie ſich vor einem Feinde verſtecken ſollten, der ſie herauszufordern ſchien, und fürchtend hier endlich im Rücken genommen zu werden, beſchloſſen ſie den Angreifern muthig entgegen zu gehen. Allein kaum hatten ſie ihren Schutzort verlaſſen, als Lord Ruthven einen Schuß in die Schulter erhielt, der ihn zu Boden ſtreckte. Aubrey eilte ihm zu Hülfe, und ſahe ſich bald nun von den Räubern umringt, denn die Begleiter hatten ſchon ihre Waffen weggeworfen und ſich ergeben.
Durch Versprechung großer Belohnung brachte Aubrey die Räuber dahin, ſeinen verwundeten Freund in eine nahe Hütte zu tragen, und nachdem er ein Löſegeld versprochen hatte, wurde er nicht mehr durch ihre Gegenwart beläſtigt, denn ſie begnügten ſich blos den Eingang zu bewachen, bis der Abgeſchickte mit dem Löſegeld zurückgekehrt ſeyn würde.
Lord Ruthvens Kräfte nahmen ſchnell ab, in zwei Tagen war er dem Tode nahe, und er fühlte dieſen mit ſchnellen Schritten ſich nahen. Sein Anſehen und Benehmen hatte ſich nicht verändert, er ſchien weder der Schmerzen noch ſeiner Umgebungen zu achten, gegen Ende des letzten Abends aber wurde er ſichtbar unruhig, und ſein Auge heftete ſich oft auf Aubrey, der ihm ſeinen Beiſtand mit mehr als gewöhnlichem Ernſt anzubieten ſich gedrungen fühlte:
Helfen Sie mir! Sie können mich retten! Sie können mehr thun, als das! – ich meine nicht mein Leben, ich achte den Verluſt deſſelben nicht höher, als den des ſcheidenden Tages, aber – meine Ehre können Sie retten, Ihres Freundes Ehre! –
Wie? Reden Sie! Ich werde Alles thun, was ich vermag, verſetzte Aubrey. –
Ich bedarf nur wenig … mein Leben entflieht ſchnell … ich kann nicht Alles enthüllen … wenn Sie aber, was ſie von mir wiſſen, verbergen wollen, ſo würde meine Ehre vom Gerede der Welt unbefleckt bleiben … und wenn mein Tod einige Zeit in England unbekannt bliebe … Ich … aber das Leben …
Er ſoll nicht bekannt werden!
Schwören Sie! rief der Sterbende, indem er ſich mit ungewöhnlicher Heftigkeit aufrichtete. – Schwören Sie bei Allem, was Ihnen heilig iſt, bei Allem, was Sie fürchten, daß Sie binnen Jahr und Tag keinem lebenden Weſen auf irgend eine Art das mittheilen wollen, was Ihnen von meinem Verbrechen und meinem Tode bekannt iſt, es mag ſich ereignen, was da will, Sie mögen ſehen, was Sie wollen.
Seine Augen ſchienen ſich bei dieſer Rede aus ihren Kreiſen zu drehen.
Ich ſchwöre! rief Aubrey, und jener ſank ſterbend auf ſein Kiſſen zurück und athmete nicht mehr.
Aubrey begab ſich zwar zur Ruhe, konnte aber nicht ſchlafen, die mancherlei Umſtände, wovon ſeine Bekanntſchaft mit dieſem Manne begleitet geweſen war, wurden wieder klar in ſeiner Seele, und er wußte nicht, wie es geſchah, wenn er ſich ſeines Schwures erinnerte, überfiel ihn ein kalter Schauer, wie das Vorgefühl von etwas Schrecklichem, das ihn erwartete.
Mit dem früheſten Morgen ſtand er auf, und eben war er im Begriff, die Hütte zu betreten, wo er den Leichnam verlaſſen hatte, als ihm ein Räuber entgegen trat und ihm meldete, daß ſich jener nicht mehr dort befinde, indem er von ihm und ſeinen Kameraden auf dem Gipfel eines benachbarten Berges getragen worden ſey, in Gemäßheit des Versprechens, das ſie dem Lord gegeben, daß er dem erſten kalten Strale des Mondes, der nach ſeinem Tode aufgehen würde, ausgeſetzt werden ſollte. Aubrey erſtaunte, nahm einige der Männer mit ſich, entſchloſſen, den Berg zu beſteigen und den Leichnam an dem Orte zu beerdigen, wo er läge. Allein als er den Gipfel erreicht hatte, fand er weder Spuren von dem Leichnam, noch von den Kleidern, obgleich die Räuber ſchworen, das ſey derſelbe Felſen, wohin ſie den Todten gelegt hätten. Er verlor ſich einige Zeit in ſeltſamen Vermuthungen, allein endlich kehrte er zurück in der Ueberzeugung, daß ſie den Körper, um die Kleider zu gewinnen, beerdigt hätten.
Ueberdrüßig einer Gegend, wo er ſo furchtbares Mißgeſchick erfahren hatte, und wo ſich Alles verſchworen zu haben ſchien, jene zum Aberglauben ſich neigende Schwermuth zu nähren, die ſich ſeines Gemüths bemächtigt hatten, beſchloß er abzureiſen, und in Kurzem befand er ſich in Smyrna. Indeß er auf ein Schiff wartete, welches ihn nach Otranto oder Neapel überführen ſollte, beſchäftigte er ſich mit Ordnung der Sachen, die er als dem Lord Ruthven zugehörig mit ſich genommen hatte. Unter denſelben befand ſich auch eine Kiſte, welche verſchiedene Angriffswaffen enthielt, die mehr oder weniger geſchickt waren, einen unfehlbaren Tod zu geben. Auch mehrere Dolche und Ataghans waren dabei. Indem er ihre ſeltſame Geſtalt betrachtete, wie erſchrack er, als er eine Scheide fand, in derſelben Art verziert, wie der Dolch, den er in der Hütte gefunden hatte … Er ſchauderte … nach weitern Beweiſen ſuchend fand er auch die Waffe, und man kann ſich ſeinen Schreck denken, als er entdeckte, daß ſie, wenn auch beſonders geformt, in die Scheide genau paſſe, die er in der Hand hielt. Wie gern hätte er gezweifelt. Er ſtarrte feſt auf den Dolch hin, ja! er war es … auch Blutſtropfen waren auf ihn und der Scheide zu bemerken! –
Er verließ Smyrna, und auf ſeinem Rückwege nach der Heimath war es in Rom ſein erſtes Geſchäft, ſich nach der jungen Dame zu erkundigen, die er aus des Lords Ruthven Fallſtricken zu befreien geſucht hatte. Ihre Eltern lebten im Elende, ihr Vermögen war zu Grunde gerichtet, und man hatte ſeit des Lords Abreiſe nichts wieder von ihr gehört. Aubrey’s Gemüth erlag faſt unter den Stürmen ſo wiederhohlter Schreckniſſe, er fürchtete auch, die junge Italienerin möchte Janthe’s Verführer zur Beute geworden ſeyn. Er wurde düſter und einsylbig; ſein Geſchäft beſtand blos darin, die Poſtillons zur Eil anzutreiben, gleich als ſey er im Begriffe, das Leben eines ihm theuern Weſens zu retten. So kam er in Calais an; ein Landwind, der ſeinen Wünſchen günſtig war, brachte ihn ſchnell an Englands Küſte. Er eilte nach dem väterlichen Hauſe, und hier ſchien er, auf Augenblicke wenigſtens, in den Umarmungen ſeiner Schweſter, die Erinnerungen des Vergangenen aus den Augen zu verlieren. Hatte ſie ſchon früher durch ihre kindlichen Liebkoſungen ſeine Zuneigung gewonnen, ſo erſchien ſie ihm jetzt als Jungfrau noch reizender und liebenswerther.
Miß Aubrey beſaß nicht jenes einnehmende Weſen, welches die Aufmerkſamkeit und den Beifall großer Geſellſchaften zu erregen im Stande iſt. Nichts von jenem glänzenden Schimmer, der nur in der erhitzten Atmosphäre eines vollgeſtopften Zimmers leuchtet. Ihr blaues Auge war nicht der leicht bewegliche Spiegel eines leichtſinnigen Gemüths. Ein melancholiſcher Reiz wohnte darin, der nicht von Unglück, ſondern von einem tiefern Gefühl herzurühren ſchien, das auf eine Seele ſchließen ließ, die ſich eines höhern Vaterlandes bewußt war. Ihr Schritt war nicht ein leichtes Hüpfen, durch einen Schmetterling oder eine glänzende Blume angezogen, ſondern ernſt und ſinnend. Wenn ſie allein war, wurde ihr Geſicht nie durch das Lächeln der Freude verklärt, aber wenn ihr Bruder ihr ſeine Liebe bewies, wenn er in ihrem Umgange jenen Gram zu vergeſſen ſuchte, der, wie ſie wußte, ſeine Ruhe untergrub, wer hätte dann ihr Lächeln gegen das der Wolluſt vertauſcht? – Dann ſchien es, als glänzten dieſe Augen, dieſes Geſicht in dem Lichte ihres ſchönern Geburtslandes. Sie ſtand erſt im achtzehnten Jahre, und war noch nicht in die Welt eingeführt worden, indem es ihre Vormünder für beſſer gehalten hatten, ihre Vorſtellung daſelbſt ſo lange zu verſchieben, bis ihr Bruder vom feſten Lande zurückgekehrt, öffentlich als ihr Beſchützer würde auftreten können.
Es war nun beſtimmt, daß der nächſte Hofzirkel, der nicht ſehr entfernt war, die Epoche ihres Eintritts auf den geräuſchvollen Schauplatz werden ſollte. Aubrey hätte ſich freilich lieber auf ſein väterliches Haus beſchränkt und der Melancholie Nahrung gegeben, die ſich ſeiner ganz und gar bemächtigte. Er konnte keine Theilnahme empfinden an dem leichtfertigen Gespräch modiſcher Fremder, indeß ſein Gemüth durch die Begebenheiten zerriſſen wurde, von denen er Augenzeuge geweſen war; allein er beſchloß, ſeine eigene Bequemlichkeit der Beſchützung ſeiner Schweſter aufzuopfern. Bald trafen ſie in der Stadt ein, und bereiteten ſich für den nächſten Tag, der zum Gallatage angeſetzt war.
Die Menſchenmenge war außerordentlich, ſeit langer Zeit war kein Zirkel geweſen, und Alles, was ſich in dem Lächeln der Hoheit zu ſonnen trachtete, eilte ſehnſuchtsvoll herbei. Aubrey mit ſeiner Schweſter hatte ſich gleichfalls eingefunden. Indeß er einſam in einer Ecke ſtand, die Umgebungen wenig beachtend, verſank er in die Erinnerung, daß er an derſelben Stelle den Lord Ruthven zum erſten Mal geſehen habe. … Da fühlte er ſich plötzlich am Arme ergriffen, und eine nur zu bekannte Stimme raunte ihm ins Ohr: „Gedenke deines Eydes!“ Er hatte kaum den Muth, ſich umzuſehen, fürchtend, er möchte ein Gespenſt erblicken, als er in einiger Entfernung dieſelbe Geſtalt wahrnahm, welche ſeine Aufmerkſamkeit beim erſten Eintritte in dieſen Saal auf ſich gezogen hatte. Er ſtarrte darauf hin, bis ihn ſeine Füße nicht mehr tragen wollten, dann faßte er den Arm eines Freundes, bahnte ſich einen Weg durch die Menge, warf ſich in den Wagen und eilte nach Hauſe. Hier ſchritt er mit heftigen Schritten das Zimmer auf und ab, die Hand an die Stirn gelegt, gleich als fürchtete er, die Gedanken möchten dieſe zersprengen. Lord Ruthven ſtand vor ihm … Umſtände aus der Vergangenheit belebten ſich … der Dolch … ſein Eid! – Sollten die Todten auferſtehen? – Er glaubte, ſeine Phantaſie habe blos das Bild belebt, welches in ſeiner Seele wohnte. Es konnte unmöglich Wirklichkeit ſeyn, er beſchloß daher, wieder in Geſellſchaft zu gehen; denn ob er gleich verſucht hatte, ſich nach Lord Ruthven zu erkundigen, ſo erſtarb doch der Name auf ſeinen Lippen, und er vermochte Nichts über ihn zu erfahren.
Einige Tage nachher beſuchte er mit ſeiner Schweſter eine Geſellſchaft bei einem nahen Verwandten. Er ließ ſie unter dem Schutze einer ältern Dame und begab ſich an einen ſtillen Ort, wo er ſeinen Gedanken nachhing. Da er aber endlich bemerkte, daß Einige Abſchied nahmen, erhob er ſich, ging in ein anderes Zimmer, und fand hier ſeine Schweſter von Mehrern umgeben, und wie es ſchien, im ernſten Gespräche; er ſuchte ſich Platz zu machen und zu ihr zu gelangen, da wandte ſich Jemand, den er bat ihn durchzulaſſen, und – er erkannte dieſelben Züge, die er ſo ſehr verabſcheute. Schnell ergriff er den Arm ſeiner Schweſter und zog ſie eilig mit ſich fort nach der Straße. An der Thür wurde er durch die Menge der Diener verhindert, vorwärts zu kommen, und indem er ſich durchdrängen wollte, hörte er, daß eine Stimme wieder ganz dicht bei ihm flüſterte: „Gedenke deines Eides!“ Er wagte es nicht, ſich umzuſchauen, ſondern eilte, ſeine Schweſter mit ſich fortziehend, ſchnell nach Hauſe.
Aubrey wurde faſt wahnſinnig. War ſein Geiſt ſchon vorher in einem einzigen Gedanken verſunken geweſen, wie ſehr wurde dieſer Zuſtand verſtärkt, da er nun die Gewißheit hatte, daß des Ungeheuers Leben von neuem ſein Gemüth belaſtete. Er beachtete ſeiner Schweſter Zärtlichkeit kaum, und vergebens drang ſie in ihn, nach der Urſache ſeines räthſelhaften Benehmens forſchend. Er ſtieß blos wenige Worte aus, und dieſe erſchreckten ſie. Jemehr er nachſann, um ſo verſtörter wurde er. Sein Eid machte ihn ſchaudern … ſollte er denn geſtatten, daß das Ungeheuer Verderben hauchend unter allen, was ihm theuer war, umhergehe, und nicht verſuchen, ſeine Fortſchritte zu hemmen? Seine eigene Schweſter konnte ja von ihm erreicht werden. – Aber geſetzt auch, er wollte ſeinen Eid brechen und ſeine Vermuthungen laut werden laſſen, wer würde ihm glauben? Er kam wohl auf den Gedanken, ſeine eigene Hand zu brauchen, um die Welt von ſolch einem Elenden zu befreien, allein der Tod, erinnerte er ſich, hatte ja keine Gewalt über ihn. Mehrere Tage blieb er in dieſem Zuſtande, ſchloß ſich in ſeinem Zimmer ein, und genoß blos einige Nahrung, wenn ſeine Schweſter zu ihm kam und ihn mit thränenden Augen bat, doch um ihretwillen ſeine Kräfte nicht ſinken zu laſſen. Endlich konnte er ſelbſt die Stille und Einſamkeit nicht länger ertragen, er verließ ſeine Wohnung und eilte von Straße zu Straße, ängſtlich fliehend vor dem Bilde, welches ihn immerwährend verfolgte. Er vernachläſſigte ſeine Kleidung und wanderte eben ſo am hellen Tage, wie um Mitternacht umher. Man erkannte ihn kaum. Anfangs kehrte er mit dem Abende nach Hauſe zurück, allein endlich legte er ſich da nieder, wo ihn die Ermüdung überfallen hatte. Seine Schweſter, besorgt für ſeine Geſundheit, ſtellte Leute an, die ihm folgen mußten, allein ſie verloren ihn bald aus dem Geſichte, denn er floh vor jedem Verfolgenden ſchneller, als mancher vor – Gedanken.
Indeſſen änderte ſich mit einem Male ſein Benehmen. Ergriffen von der Idee, daß er in ſeiner Abweſenheit alle ſeine Freunde mit einem Feinde allein ließ, deſſen Gegenwart ſie nicht ahneten, beſchloß er wieder in Geſellſchaft zu gehen und ihn genau zu bewachen, in der Abſicht, trotz ſeines Eides alle zu warnen, denen ſich Lord Ruthven auf eine vertrauliche Art nähern möchte. Allein wenn er in einen geſelligen Kreis trat, waren ſeine lauernden, ſpähenden Blicke ſo ergreifend, ſein innerlicher Schauder ſo ſichtbar, daß ſich ſeine Schweſter endlich genöthigt ſah, ihn zu bitten, er möge ihrentwegen doch nicht eine Geſellſchaft beſuchen, welche einen ſo unangenehmen Eindruck auf ihn zu machen ſcheine. Da jedoch alle Vorſtellungen fruchtlos waren, glaubten die Vormünder ſich ins Mittel ſchlagen zu müſſen, und fürchtend, daß ſein Geiſt zerrüttet werden möchte, hielten ſie es für hohe Zeit, ein Amt wieder zu übernehmen, das ihnen ſchon vorher von Aubrey’s Eltern übertragen worden war.
Voll Verlangen, ihn vor den Beleidigungen und Unannehmlichkeiten zu ſchützen, die er täglich auf ſeinen Wanderungen erfuhr, und den Augen der Menge nicht das blos zuſtellen, was ſie für Zeichen des Wahnſinns hielten, veranlaßten ſie einen Arzt, in ſeinem Hauſe Wohnung zu nehmen und ihn in ſteter Obhut zu halten. Er ſchien dies kaum zu bemerken, ſo ſehr war ſein Geiſt nur mit dem einzigen furchtbaren Gegenſtande beſchäftigt. Seine innere Verworrenheit wurde endlich ſo groß, daß er auf ſein Zimmer beſchränkt werden mußte. Hier lag er denn oft auf einer Stelle Tage lang, ohne daß er im Stande war aufzuſtehen. Er war äußerſt mager geworden, ſeine Augen hatten ein gläſernes Anſehen bekommen, das einzige Zeichen von Gefühl und Erinnerung entfaltete er beim Eintritte ſeiner Schweſter, dann ſprang er zuweilen auf, und ihre Hand ergreifend, bat er ſie mit Blicken, die ſie in innerſter Seele durchdrangen, ſie möchte ihn nicht berühren. „O! ſagte er, berühre ihn ja nicht! wenn deine Liebe zu mir aufrichtig iſt, nähere dich ihm nicht!“ Wann ſie nun forſchte, worauf ſich dieſe Bitte bezöge, war ſeine einzige Antwort: Gewiß! gewiß! und dann ſank er wieder in einen Zuſtand zurück, aus dem auch ſie ihn nicht erheben konnte. So blieb es mehrere Monate; ſo wie indeß das Jahr allmälig vorüberging, wurden auch ſeine Gemüthszerrüttungen minder häufig, und ſein Geiſt befreite ſich zum Theil von ſeiner Verdüſterung. Seine Wächter bemerkten auch, daß er des Tags zuweilen eine gewiſſe Zahl an den Fingern berechnete und dann lächelte.
Faſt war die Zeit verfloſſen, als am letzten Tage des Jahres einer ſeiner Vormünder in das Zimmer trat und mit dem Arzte über den traurigen Umſtand ſprach, daß ſich Aubrey noch immer in einer ſo ſchrecklichen Lage befinde, indeß ſeine Schweſter nächſtens verheirathet werden würde. Dieſes erregte ſogleich Aubrey’s Aufmerkſamkeit, und er fragte ängſtlich: An wen? – Voll Freude über dieſen Beweis des rückkehrenden Verſtandes, deſſen ſie ihn ſchon für ganz beraubt gehalten hatten, nannten ſie ihn den Namen des Earl von Marsden. Da er dachte, daß dies ein junger Edelmann ſey, den er in Geſellſchaft geſehen habe, ſchien Aubrey ſehr zufrieden, und ſetzte die Vormünder noch mehr dadurch in Verwunderung, daß er den Wunſch zu erkennen gab, bei der Hochzeit zugegen zu ſeyn und ſeine Schweſter zu ſehen. Sie antworteten nichts, allein in wenigen Minuten war ſeine Schweſter bei ihm.
Er war dem Anſcheine nach noch fähig, von der Wirkung ihres lieblichen Lächelns gerührt zu werden, denn er drückte ſie an ſeine Bruſt und küßte ihre Wange, welche Thränen benetzten, die dem Gedanken floſſen, daß ihres Bruders Gemüth den Empfindungen der Liebe wieder geöffnet ſey. Er begann nun mit all ſeiner gewöhnlichen Wärme zu ſprechen, und ihr Glück zu wünſchen zu ihrer Vermählung mit einem durch Rang und andere Vollkommenheiten ſo ausgezeichneten Manne, da bemerkte er plötzlich ein Miniaturbild auf ihrer Bruſt; er betrachtete es genauer, und wie groß war ſein Erſtaunen, als er die Züge des Ungeheuers erkannte, welches einen ſo langen Einfluß auf ſein Leben gehabt hatte. In einem Anfall von Wuth ergriff er das Portrait und trat es mit Füßen. Als ſie ihn fragte, warum er ſo die Abbildung ihres künftigen Gemahls zerſtöre, ſahe er ſie an, als wenn er ſie nicht verſtünde, dann ergriff er ihre Hände und ſchauete ſie mit einem Ausdrucke wilder Verwirrung an, indem er ſie bat zu ſchwören, daß ſie nie dieſes Ungeheuer heirathen wolle, denn er … Er konnte nicht weiter ſprechen, es ſchien, als ob die Stimme ihn wieder aufforderte, ſeines Eides zu gedenken, – ſchnell wandte er ſich um und dachte Lord Ruthven zu erblicken, allein er ſah Niemand. Unterdeſſen waren die Vormünder und der Arzt eingetreten, welche das alles mit angehört hatten, und da ſie es für die Rückkehr ſeines Wahnſinnes hielten, trennten ſie ihn mit Gewalt von Miß Aubrey und baten ſie, ſich zu entfernen. Nun fiel er ihnen zu Füßen, bat, beſchwor ſie nur einen Tag um Aufſchub. Sie wurden dadurch noch mehr in ihrer Meinung von dem rückkehrenden Wahnſinne Aubrey’s beſtärkt, verſuchten ihn zu beruhigen und entfernten ſich.
Lord Ruthven hatte den Morgen nach dem Hofzirkel ſeinen Beſuch machen wollen, war jedoch ſo wie Niemand angenommen worden. Als er von Aubrey’s Uebelbefinden hörte, fühlte er wohl, daß er es verurſacht habe; als er aber vollends erfuhr, er ſey wahnſinnig geworden, konnte er ſeine Freude kaum vor denen verbergen, von denen er dieſe Nachricht erfahren hatte. Er eilte nach der Wohnung ſeines frühern Gefährten, und durch beharrliche Aufmerkſamkeit, ſo wie durch Aeußerung einer großen Zärtlichkeit gegen den Bruder und Theilnehmer an ſeinem Unglücke, gelang es ihm, allmälig bei Miß Aubrey Gehör zu finden. Wer vermochte auch ſeinen Künſten zu widerſtehen? Er hatte Gefahren und Beſchwerden zu erzählen, – ſprach von ſich ſelbſt, als von einem Weſen, welches durchaus mit keinem andern auf der Welt, außer mit der, an die er ſeine Worte richtete, übereinſtimmend empfinde, erzählte ihr, wie nur, ſeitdem er ſie kenne, ſein Daſeyn ihn der Erhaltung werth geſchienen habe, gleich als ob er nur ihren ſchmeichelnden Worten und Tönen habe lauſchen wollen, – mit einem Worte, er wußte die Schlangenkünſte ſo trefflich zu brauchen, oder es war vielmehr der Wille des Schickſals, daß er ihre volle Zuneigung gewann. Da der Titel des ältern Zweiges der Familie mit der Zeit auf ihn fiel, ſo erhielt er einen anſehnlichen Geſandtſchaftspoſten, der ihm zur Entſchuldigung diente, daß er die Vermählung (trotz des Bruders zerrütteter Geſundheit) beſchleunigte, denn ſie ſollte den Tag vor ſeiner Abreiſe nach dem feſten Lande Statt finden.
Aubrey verſuchte, als ihn die Vormünder und der Arzt verlaſſen hatten, die Diener zu beſtechen, doch vergebens! Er verlangte Feder und Dinte. Es wurde ihm gereicht; er ſchrieb einen Brief an ſeine Schweſter, indem er ſie beſchwor, ſo werth ihr ihre eigene Glückſeligkeit, ihre eigene Ehre und die Ehre derer ſey, die nun im Grabe ſchlummerten, aber ſie einſt als die Hofnung ihres Hauſes in ihren Armen hielten, nur um wenig Stunden eine Vermählung zu verſchieben, auf die er die ſchrecklichſten Verwünſchungen ausſchüttete. Die Diener versprachen ihm, den Brief zu beſtellen, übergaben ihn aber dem Arzte, der es für beſſer hielt, das Gemüth der Miß Aubrey nicht noch mehr durch das zu ängſtigen, was er für Anfälle eines Wahnſinnigen hielt.
Die Nacht verſtrich den geſchäftigen Bewohnern des Hauſes ohne Ruhe, und Aubrey hörte mit einem Entſetzen, das man ſich eher vorſtellen, als beſchreiben kann, die Zeichen geſchäftiger Vorbereitungen. Der Morgen kam und das Geräuſch der anfahrenden Wagen berührte ſein Ohr. Aubrey gerieth ganz außer ſich. Die Neugier der Diener beſiegte endlich ihre Wachſamkeit; ſie ſtohlen ſich allmälig weg und ließen Aubrey in der Aufſicht eines alten ſchwachen Weibes. Er benutzte dieſe Gelegenheit. Mit einem Sprunge war er aus dem Zimmer, und in einem Augenblicke ſtand er in dem, wo ſich alles zur Feierlichkeit verſammelt hatte. Lord Ruthven war der erſte, der ihn bemerkte; er trat ſogleich zu jenem hin, ergriff ihn heftig beim Arme und riß ihn, ſprachlos vor Wuth, mit ſich aus dem Zimmer. Auf der Treppe raunte ihm Lord Ruthven ins Ohr: „Erinnern Sie ſich ihres Eides, und bedenken Sie, daß, wenn Ihre Schweſter nicht heut meine Gemahlin wird, ſie entehrt iſt! Die Weiber ſind ſchwach!“ – Mit dieſen Worten drängte er ihn gegen ſeine Diener hin, welche durch das alte Weib aufgeregt, ihn zu ſuchen gekommen waren. Aubrey konnte ſich nicht länger aufrecht erhalten. Seine Wuth, die keinen Ausbruch fand, hatte ein Blutgefäß zerriſſen, und er wurde ſogleich zu Bette gebracht. Dies wurde indeſſen ſeiner Schweſter verſchwiegen, welche bei ſeinem Eintritte nicht zugegen geweſen war, denn der Arzt wollte ſie nicht beunruhigen. Die Vermählung wurde vollzogen und Braut und Bräutigam verließen London.
Aubrey’s Schwäche nahm immer mehr zu; der Blutverluſt erzeugte Symptome des herannahenden Todes. Er wünſchte, ſeiner Schweſter Vormünder möchten zu ihm gerufen werden, und als die Glocke Mitternacht geſchlagen hatte, erzählte er alles – was die Leſer auf den vorſtehenden Blättern gefunden haben, und ſtarb augenblicklich.
Die Vormünder eilten fort, Miß Aubrey zu retten, allein es war zu ſpät. Lord Ruthven war verſchwunden und Aubrey’s Schweſter hatte den Durſt eines Vampyr geſtillt.
⮝ Philip Burne-Jones (1861 – 1926): The Vampire
Philip Burne-Jones (1861 – 1926): The Vampire
George Gordon Byron: The Vampyre
 ut first, on earth as vampire sent,
ut first, on earth as vampire sent,
Thy corse shall from its tomb be rent,
Then ghastly haunt thy native place,
And suck the blood of all thy race.
There from thy daughter, sister, wife,
At midnight drain the stream of life,
Yet loathe the banquet which perforce
Must feed thy livid living corse.
Thy victims ere they yet expire
Shall know the demon for their sire,
As cursing thee, thou cursing them,
Thy flowers are withered on the stem.
Wet with thine own best blood shall drip
Thy gnashing tooth and haggard lip;
Then stalking to thy sullen grave,
Go — and with Gouls and Afrits rave;
Till these in horror shrink away
From Spectre more accursed than they!
George Gordon Byron: A Fragment
June 17, 1816.
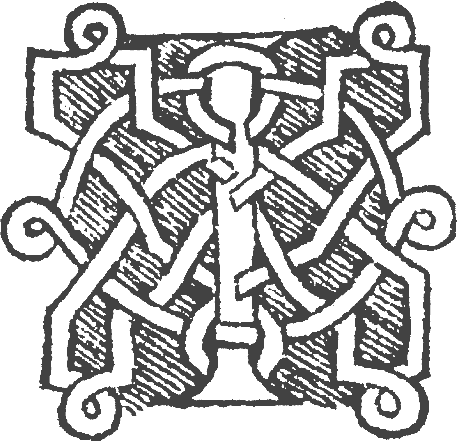 n the year 17—, having for some time determined on a journey through countries not hitherto much frequented by travellers, I set out, accompanied by a friend, whom I shall designate by the name of Augustus Darvell. He was a few years my elder, and a man of considerable fortune and ancient family—advantages which an extensive capacity prevented him alike from undervaluing or overrating. Some peculiar circumstances in his private history had rendered him to me an object of attention, of interest, and even of regard, which neither the reserve of his manners, nor occasional indications of an inquietude at times nearly approaching to alienation of mind, could extinguish.
n the year 17—, having for some time determined on a journey through countries not hitherto much frequented by travellers, I set out, accompanied by a friend, whom I shall designate by the name of Augustus Darvell. He was a few years my elder, and a man of considerable fortune and ancient family—advantages which an extensive capacity prevented him alike from undervaluing or overrating. Some peculiar circumstances in his private history had rendered him to me an object of attention, of interest, and even of regard, which neither the reserve of his manners, nor occasional indications of an inquietude at times nearly approaching to alienation of mind, could extinguish.
I was yet young in life, which I had begun early; but my intimacy with him was of a recent date: we had been educated at the same schools and university; but his progress through these had preceded mine, and he had been deeply initiated into what is called the world, while I was yet in my noviciate. While thus engaged, I had heard much both of his past and present life; and although in these accounts there were many and irreconcileable contradictions, I could still gather from the whole that he was a being of no common order, and one who, whatever pains he might take to avoid remark, would still be remarkable. I had cultivated his acquaintance subsequently, and endeavoured to obtain his friendship, but this last appeared to be unattainable; whatever affections he might have possessed seemed now, some to have been extinguished, and others to be concentred: that his feelings were acute, I had sufficient opportunities of observing; for, although he could control, he could not altogether disguise them: still he had a power of giving to one passion the appearance of another in such a manner that it was difficult to define the nature of what was working within him; and the expressions of his features would vary so rapidly, though slightly, that it was useless to trace them to their sources. It was evident that he was a prey to some cureless disquiet; but whether it arose from ambition, love, remorse, grief, from one or all of these, or merely from a morbid temperament akin to disease, I could not discover: there were circumstances alleged, which might have justified the application to each of these causes; but, as I have before said, these were so contradictory and contradicted, that none could be fixed upon with accuracy. Where there is mystery, it is generally supposed that there must also be evil: I know not how this may be, but in him there certainly was the one, though I could not ascertain the extent of the other—and felt loth, as far as regarded himself, to believe in its existence. My advances were received with sufficient coldness; but I was young, and not easily discouraged, and at length succeeded in obtaining, to a certain degree, that common-place intercourse and moderate confidence of common and every day concerns, created and cemented by similarity of pursuit and frequency of meeting, which is called intimacy, or friendship, according to the ideas of him who uses those words to express them.
Darvell had already travelled extensively; and to him I had applied for information with regard to the conduct of my intended journey. It was my secret wish that he might be prevailed on to accompany me: it was also a probable hope, founded upon the shadowy restlessness which I had observed in him, and to which the animation which he appeared to feel on such subjects, and his apparent indifference to all by which he was more immediately surrounded, gave fresh strength. This wish I first hinted, and then expressed: his answer, though I had partly expected it, gave me all the pleasure of surprise—he consented; and, after the requisite arrangements, we commenced our voyages. After journeying through various countries of the south of Europe, our attention was turned towards the East, according to our original destination; and it was in my progress through those regions that the incident occurred upon which will turn what I may have to relate.
The constitution of Darvell, which must from his appearance have been in early life more than usually robust, had been for some time gradually giving way, without the intervention of any apparent disease: he had neither cough nor hectic, yet he became daily more enfeebled: his habits were temperate, and he neither declined nor complained of fatigue, yet he was evidently wasting away: he became more and more silent and sleepless, and at length so seriously altered, that my alarm grew proportionate to what I conceived to be his danger.
We had determined, on our arrival at Smyrna, on an excursion to the ruins of Ephesus and Sardis, from which I endeavoured to dissuade him in his present state of indisposition—but in vain: there appeared to be an oppression on his mind, and a solemnity in his manner, which ill corresponded with his eagerness to proceed on what I regarded as a mere party of pleasure, little suited to a valetudinarian; but I opposed him no longer—and in a few days we set off together, accompanied only by a serrugee and a single janizary.
We had passed halfway towards the remains of Ephesus, leaving behind us the more fertile environs of Smyrna, and were entering upon that wild and tenantless track through the marshes and defiles which lead to the few huts yet lingering over the broken columns of Diana—the roofless walls of expelled Christianity, and the still more recent but complete desolation of abandoned mosques—when the sudden and rapid illness of my companion obliged us to halt at a Turkish cemetery, the turbaned tombstones of which were the sole indication that human life had ever been a sojourner in this wilderness. The only caravansera we had seen was left some hours behind us, not a vestige of a town or even cottage was within sight or hope, and this “city of the dead” appeared to be the sole refuge for my unfortunate friend, who seemed on the verge of becoming the last of its inhabitants.
In this situation, I looked round for a place where he might most conveniently repose:—contrary to the usual aspect of Mahometan burial-grounds, the cypresses were in this few in number, and these thinly scattered over its extent: the tombstones were mostly fallen, and worn with age:—upon one of the most considerable of these, and beneath one of the most spreading trees, Darvell supported himself, in a half-reclining posture, with great difficulty. He asked for water. I had some doubts of our being able to find any, and prepared to go in search of it with hesitating despondency—but he desired me to remain; and turning to Suleiman, our janizary, who stood by us smoking with great tranquillity, he said, “Suleiman, verbana su,” (i. e. bring some water,) and went on describing the spot where it was to be found with great minuteness, at a small well for camels, a few hundred yards to the right: the janizary obeyed. I said to Darvell, “How did you know this?”—He replied, “From our situation; you must perceive that this place was once inhabited, and could not have been so without springs: I have also been here before.”
“You have been here before!—How came you never to mention this to me? and what could you be doing in a place where no one would remain a moment longer than they could help it?”
To this question I received no answer. In the mean time Suleiman returned with the water, leaving the serrugee and the horses at the fountain. The quenching of his thirst had the appearance of reviving him for a moment; and I conceived hopes of his being able to proceed, or at least to return, and I urged the attempt. He was silent—and appeared to be collecting his spirits for an effort to speak. He began.
“This is the end of my journey, and of my life—I came here to die: but I have a request to make, a command—for such my last words must be—You will observe it?”
“Most certainly; but have better hopes.”
“I have no hopes, nor wishes, but this—conceal my death from every human being.”
“I hope there will be no occasion; that you will recover, and——”
“Peace!—it must be so: promise this.”
“I do.”
“Swear it, by all that”——He here dictated an oath of great solemnity.
“There is no occasion for this—I will observe your request; and to doubt me is——”
“It cannot be helped,—you must swear.”
I took the oath: it appeared to relieve him. He removed a seal ring from his finger, on which were some Arabic characters, and presented it to me. He proceeded—
“On the ninth day of the month, at noon precisely (what month you please, but this must be the day), you must fling this ring into the salt springs which run into the Bay of Eleusis: the day after, at the same hour, you must repair to the ruins of the temple of Ceres, and wait one hour.”
“Why?”
“You will see.”
“The ninth day of the month, you say?”
“The ninth.”
As I observed that the present was the ninth day of the month, his countenance changed, and he paused. As he sate, evidently becoming more feeble, a stork, with a snake in her beak, perched upon a tombstone near us; and, without devouring her prey, appeared to be stedfastly regarding us. I know not what impelled me to drive it away, but the attempt was useless; she made a few circles in the air, and returned exactly to the same spot. Darvell pointed to it, and smiled: he spoke—I know not whether to himself or to me—but the words were only, “’Tis well!”
“What is well? what do you mean?”
“No matter: you must bury me here this evening, and exactly where that bird is now perched. You know the rest of my injunctions.”
He then proceeded to give me several directions as to the manner in which his death might be best concealed. After these were finished, he exclaimed, “You perceive that bird?”
“Certainly.”
“And the serpent writhing in her beak?”
“Doubtless: there is nothing uncommon in it; it is her natural prey. But it is odd that she does not devour it.”
He smiled in a ghastly manner, and said, faintly, “It is not yet time!” As he spoke, the stork flew away. My eyes followed it for a moment, it could hardly be longer than ten might be counted. I felt Darvell’s weight, as it were, increase upon my shoulder, and, turning to look upon his face, perceived that he was dead!
I was shocked with the sudden certainty which could not be mistaken—his countenance in a few minutes became nearly black. I should have attributed so rapid a change to poison, had I not been aware that he had no opportunity of receiving it unperceived. The day was declining, the body was rapidly altering, and nothing remained but to fulfil his request. With the aid of Suleiman’s ataghan and my own sabre, we scooped a shallow grave upon the spot which Darvell had indicated: the earth easily gave way, having already received some Mahometan tenant. We dug as deeply as the time permitted us, and throwing the dry earth upon all that remained of the singular being so lately departed, we cut a few sods of greener turf from the less withered soil around us, and laid them upon his sepulchre.
Between astonishment and grief, I was tearless.
Die Blutsauger
 uf der Insel Lido, der schönsten unter allen denen, welche Venedigs alterthümliche Paläste tragen, lebte die junge Bettina die von Liebe und Hoffnung bewegt, mit Ungeduld auf den Geliebten harrte, dessen Abwesenheit sie schon seit einiger Zeit beweinte und mit welchem sie auf immer vereint zu seyn, so sehnlich wünschte.
uf der Insel Lido, der schönsten unter allen denen, welche Venedigs alterthümliche Paläste tragen, lebte die junge Bettina die von Liebe und Hoffnung bewegt, mit Ungeduld auf den Geliebten harrte, dessen Abwesenheit sie schon seit einiger Zeit beweinte und mit welchem sie auf immer vereint zu seyn, so sehnlich wünschte.
Mitternacht war herangekommen. Der schöne, heitere, mit Sternen besäete Himmel Italiens erhellte mit mattem Scheine die Umgebungen von Venedig; aber der Mond hob in der Ferne den majestätischen Pallast des Doge hervor und beleuchtete mit seinem melancholischen Scheine die Hütten der Gondeliere an der Küste von Lido. Unter ihnen zeichnete sich die Wohnung des Oberhauptes der Gondelführer durch ihren Umfang aus und heute erschien sie vorzüglich glänzend; denn eine Menge von Vorbereitungen verkündigten ein nahes Fest.
Aber noch war rings umher Alles ruhig und in tiefen Schlaf begraben. Nur ein leiser Hauch des Windes unterbrach die Stille des nahen Haines und die Stunde schien für die seligen Träume und für alle Geheimnisse der Liebe bestimmt. Da öffnete sich langsam ein Fenster und Bettina erschien, Durch die Nacht und die Einsamkeit geschützt waren ihre Reize von keinem undurchdringlichen Schleier verhüllt. Das leichte Gewand, das sie bedeckte, ohne sie zu verbergen erhöhete ihre Schönheit. Die schwarzen Locken, welche auf die Schultern herabhingen, hoben die Blässe ihres Gesichts und gaben allen Zügen einen rührenden Ausdruck. Das verlassene Lager rief sie umsonst zurück, denn ein sehr lebhaftes Gefühl schien ihr den Schlaf zu rauben. Ihr Gesicht sprach eine große Unruhe aus und mit gespannter Aufmerksamkeit blickte sie auf das Meer hin, das sich zur weiten Ferne vor ihren Blicken. ausdehnte. Das geringste Geräusch schien ein freundliches Bild oder eine selige Hoffnung in ihr zu wecken. Aber plötzlich hebt sich jetzt ihr Busen schneller, während ihr Gesicht von der Freude geröthet wird. Ihre Augen sind auf einen fernen Gegenstand gerichtet, welcher sich zu nähern scheint. Sie glaubt ein schnell ruderndes Fahrzeug zu erblicken; sie glaubt es nur, und schon ruft sie den Namen ihres Geliebten. Doch umsonst! Der Schatten eines Felsen, welcher sich anfangs auf den Wellen bewegte und dann plötzlich still stand, hatte sie getäuscht und mit einem tiefen Seufzer beklagte sie nun ihren Irrthum.
Aber welche neue Ueberraschung! Eine süße Melodie läßt sich hören und eine liebliche Stimme singt ein Liebeslied. Der Sänger ist nicht zu sehen; das Gehölz entzieht ihn Bettina’s Augen. Wer ist der Sänger? Ist es Leonti oder ein Fremder? Diese Fragen kann sie sich noch nicht beantworten. Sie hört deshalb dem Gesange noch aufmerksamer zu, aber ach! die Stimme ist ihr unbekannt und ihre Hoffnung ist abermals getäuscht. Doch, jetzt ruft der Sänger plötzlich: „Bettina!“
„O Himmel,“ erwiedert diese, „Leonti!“ Aber kaum ist ihr Ruf verhallt, so kehrt die vorige Stille zurück und der Sänger scheint sich entfernt zu haben, wie nach einem Traume, dessen Bilder das plötzliche Erwachen verwischt, so ist Alles verschwunden. Bettina horcht umsonst, Leontis Name verhallt am Gestade des Meeres und sie überzeugt sich, daß der Sänger nicht der war, den sie rief. Wer ist aber dieser heimliche Liebhaber, der bei dem Namen eines begünstigten Nebenbuhlers entflieht? Diese Frage ängstigt sie um so mehr, da sie nicht weiß, ob er auch großmüthig genug seyn wird, um es sie nicht zu schmerzlich bereuen zu lassen, daß sie so unvorsichtig durch ein einziges Wort das Geheimniß ihres Herzens verrathen hat.
Bettina liebte Leonti. An demselben Ufer geboren, hatten sie schon ihre ersten Jahre in kindlicher Zuneigung verlebt. Mit der Zeit und den Hindernissen, die sich ihr in den Weg stellten, nahm diese Liebe zu. Ein Streit über unbedeutende Gegenstände trennte ihre Eltern, die sonst in sehr freundschaftlichen Verhältnissen lebten. Bald darauf verließ Leonti, dem Bettina’s Vater die Hand derselben verweigert hatte, nachdem auch seine geliebte Mutter gestorben war den Wohnsitz seiner Väter, um in den Waffen Schutz gegen sein Unglück zu suchen. Er hoffte, daß der Ruhm einst die Thränen der gibt trocknen und daß Torelli dem Vertheidiger Venedigs das zugestehen würde, was jetzt sein Haß dem bloßen Gondelier verweigerte. In dieser Hoffnung wurde er dadurch noch mehr bestärkt, daß Verina, Bettina’s Mutter, aus Liebe zu ihrer Tochter, seine Wünsche begünstigte und die Erfüllung derselben selbst herbei zu führen suchte.
Leonti hatte schon einen Kampf für sein Vaterland mitgekämpft und sein Regiment war seit einigen Tagen wieder in Venedig angekommen. Er hatte der Geliebten seine Ankunft gemeldet und versprochen, bei dem Feste der Gondeliere zu erscheinen, weil er hier, unter dem Jubel der ausgelassensten Fröhlichkeit, sich ihr zu zeigen und ungestört mit ihr zusammen zu seyn hoffen durfte. Und eben dies Versprechen war es, was alle Gedanken Bettina’s beschäftigte und sie verleitet hatte, das Geheimniß ihrer Liebe den ungetreuen Winden anzuvertrauen.
Endlich brach nun der Tag an und ein Freudengeschrei erfüllte die Lüfte. Das Ruder stieß die Gondel vom Ufer ab; das Lied der fröhlichen Gondeliere mischte sich zu den Tönen der Guitarre, und das Echo des Gestades sagte es der Ferne, daß Italiens begeisternder Boden das Vaterland melodischer Lieder ist.
Rings umher herrscht Leben und Freude; Bettina allein nimmt an der allgemeinen Fröhlichkeit nicht Theil. Nur ein Gedanke fesselt sie: das Fest rückt immer weiter vor und Leonti erscheint nicht.
Jetzt kam plötzlich ein Fremder herbei, dessen Kleidung wie sein Benehmen auf einen hohen Rang deuteten; aber seine wilden Züge, sein unruhiger Blick entsprachen der Seelenruhe nicht, die er zu erheucheln suchte und die tiefen Furchen auf seiner Stirn überzeugten Jedermann, daß ein großer Kummer sein Leben verbittert haben müsse. Man empfing ihn ehrerbietig und fragte, was er begehre?
„Indem ich,“ antwortete er, „dem ermüdenden Geräusche der Städte mich zu entziehen suchte, bin ich auf dies Ufer gekommen. Ich schweifte in euren Wäldern umher, als das Jauchzen der Freude mir zu Ohren kam. Der Anblick glücklicher Menschen hat für mich einen unwiderstehlichen Reiz, deshalb bin ich hieher gegangen. Doch, fahrt in euren Spielen ruhig fort, ich werde sie nicht stören!“
Der Tanz und die Spiele fingen nun von neuem an und sehr bald wurde Bettina von dem Fremden bemerkt. Bei dem Anblicke dieser Schönheit, frisch, wie die eben aufgebrochene Blume, verlor sein Gesicht zwar jene dunkle, todtenähnliche Blässe nicht; aber ein inneres Feuer röthete seine Lippen und ein schreckliches Lächeln belebte seine Züge. Er trat näher zu ihr, befragte sie theilnehmend und errieth die Ursache der Unruhe eines Herzens, das seine heftigen Gefühle nicht verbergen konnte. Er beklagte und tröstete sie, bot ihr seine Dienste an und raubte so, ohne große Mühe, ihr ganzes Vertrauen, das nur zu gern sich einer solchen zuvorkommenden, liebreichen Theilnahme ergab. Des Himmels schönste Gabe ist die Unschuld: aber sie ist wehrlos gegen je vergifteten Reize der Verführung und wie die Blume des Feldes vom Herbstwinde zerknickt wird, so zerstört ein Augenblick sie auf ewig!
Während sich jetzt die Tänzer auf einen Augenblick ausruheten, trat eine Tyrolerin unter sie. Sie erzählte, daß sie unaufhörlich umher wandere, daß sie in fernen Ländern viel erfahren habe und die Zukunft vorher sagen könne. Sogleich bildete sich ein Kreis um sie her; ihr Gespräch machte Allen Vergnügen, aber Niemand wagte es, sie um sein Schicksal zu befragen, wenn gleich der Wunsch, seine Zukunft zu kennen, noch so lebhaft sprach.
Elmoda las aus den Blicken der Umstehenden, was ein Jeder von ihr fürchtete oder hoffte; sie bewegte ihren Zauberstab in der Luft und mit begeisterter Miene sprach sie, im Gefühle ihrer prophetischen Kraft, also:
„Ihr, die ihr mich umgebt, hört meinen Gesang! Ihr sollt die Wunder einer Kunst kennen lernen, deren Ursprung sich in die ältesten Zeiten verliert. Die weissagenden Gestirne von Chaldäa, die heiligen Geheimnisse der Egypter und die größten Orakel der Griechen haben sich uns enthüllt.“
„Als Boten der himmlischen Mächte auf die Erde gesandt, sind wir von ihnen bestimmt, das Schicksal der Menschen auszusprechen. An uns richtet eure Gebete, ihr Völker! Beugt euch vor den heiligen Eingebungen, welche wir verkünden, ihr Könige der Erde, denn was wir verkünden, ist Wahrheit!“
„Und ihr Alle, die ihr euer Schicksal kennen lernen wollt, erscheinet vor mir! Mein Blick wird bis in das Innerste eurer Brust dringen.“
Elmoda schwieg; die Gondeliere standen unbeweglich, die jungen Mädchen zitterten und die Stimme der Wahrsagerin, die umsonst Zutrauen zu gewinnen suchte, fing schon an, Furcht und Schrecken um sich her zu verbreiten.
Jetzt aber zog das auffallende Aeußere des Fremden die Tyrolerin auf sich. „Gnädiger Herr,“ sagte sie zu ihm, indem sie auf ihn losging, „wollt Ihr eure Zukunft wissen? Ich will Euch sogar das Vergangene sagen, was Euch bis auf den heutigen Tag begegnet ist.“ — „Nein!“ erwiederte der Fremde mit barschem Tone. Sie wandte sich deshalb an Bettina und sagte: „Gieb mir Deine Hand, schönes Kind! Warum zitterst Du? ... Armes Mädchen. Du hast viel Kummer. Du erwartest Jemand. Er ist Dein Geliebter.“ — „Ihr Bräutigam!“ rief Torelli. — „Wie, lieber Vater?“ ... „Ja, er sang in der letzten Nacht unter Deinem Fenster. Ich habe ihn gehört. Er ist auf dem benachbarten Dorfe geboren, aber er hat seine Jugendjahre unter uns hier herlebt.“ — „Wie heißt er denn?“ — „Tomaso. Ich habe ihm Deine Hand zugesagt und ich wundere mich sehr, daß er nicht bei unserm Feste erschienen ist.“ — „Er wird kommen,“ fuhr die Tyrolerin zu Bettina fort. — „Wer?“ fragte diese. — „Der, den Du liebst, Doch warte, Dein Schicksal interessirt mich und ich will es ganz durchschauen.“ —
Nun zog Elmoda mehrere Zauberbilder aus ihrem Busen, mischte sie, untersuchte sie, gebot tiefes Stillschweigen und fuhr dann fort, sie zu prüfen. Eine heftige Bewegung malte sich auf ihrem Gesichte. Ihr Auge irrte umher, ihre Hände zitterten, ihr Mund bewegte sich. „Großer Gott!“ rief sie, „ich sehe ...“ — „Was siehest Du?“ fragten hastig mehrere Stimmen. — „Ein Unglück, ein abscheuliches Verbrechen.“ — „Rede“ — „Dieß junge Mädchen ...“ — „Bettina?“ — „muß bald ...“ — „Nur“ — „Ja, Bettina muß bald sterben!“ ...
Bei diesen Worten hörte man ein lautes Geschrei. Ein junger Soldat, der vom Walde her eben erst herbeigekommen war, bahnte sich mit Gewalt einen Weg durch den Haufen und indem er auf die Tyrolerin los stürzte, fragte er: „Unglückliche, was unterstehest Du dir zu sagen?“ — Es war Leonti. — „Ja,“ fuhr Elmoda fort, indeß Bettina todtenblaß wurde und ihre Kräfte verlor, ja, ihr Leben wird bedroht. Ihr Blut wird sie einen Tropfen nach dem andern verlieren. Zittert für sie zittert für euch, ihr, die ihr mich hört! Entfliehet Alle von hier, um euch zu retten, denn wisset, daß ein Vampyr ...“ — „O Himmel,“ rief Leonti, — „ein Blutsauger Ist es möglich? Sag, wo ist er?“ — „Ja, gewiß, er ist auf diesem Ufer, jetzt gerade mitten unter euch, es ist ...“ — „Halt ein, Unverschämte!“ rief hastig der Fremde dazwischen, indem er einen fürchterlichen Blick auf die Tyrolerin warf. „Höre auf mit Deinen Verläumdungen! Du willst nur Geld dadurch gewinnen — da nimm! Aber bewache Dein eigenes Leben, ehe Du Andern den Tod vorher sagst und entferne Dich jetzt von hier oder fürchte meinen Zorn!“
„O, Bettina!“ rief Leonti außer sich, „geliebte Bettina, komm wieder zu Dir! Ich, Dein Geliebter, bin es ja, der Dich darum bittet, der Dich in seinen Armen hält und Dich mit Thränen benetzt, Dein Leben müssen sie Dir wohl lassen. Wer sollte es wagen, Dich anzugreifen, da ich nur lebe, um Dich anzubeten und zu vertheidigen? Fürchte nichts, sondern verlaß Dich ganz auf meine Liebe und meine Rache. Noch ehe ein Feind bis zu Dir gedrungen wäre, würde mein Arm schon bereit seyn, Dich zu rächen und mit diesem Schwerdte, schneller als der Pfeil, der durch die Lüfte schwirrt, das Herz des Schuldigen zu durchbohren.“
Alle waren entflohen, selbst die Tyrolerin hatte sich entfernt. Torelli und Verina standen wie versteinert. Bettina war indeß wieder zu sich gekommen und im höchsten Grade erstaunt; allein ihr Lächeln, dem das Unglück eine himmlische Sanftmuth gab, die von der Schaamröthe gefärbte Stirn, ihre Verlegenheit, ihre Bewegung, Alles bewies, daß sie nur mit ihrem Geliebten und dem Glücke, in seinen Armen zu seyn, beschäftigt war. Alles Uebrige schien sie vergessen zu haben. Leonti sprach zu ihr, nannte sie mit den zärtlichsten Namen und hielt ihre zitternde Hand fest in der seinigen. Ihr Vater hörte und sah es und doch verrieth sein Blick keinen Unwillen darüber.
„Laßt uns diesen Ort verlassen,“ sagte jetzt der Fremde, „und vergeßt einen thörichten Schrecken. Ihr kennt ja die Frechheit solcher Weiber, die nur Geld erwerben wollen und nichts unversucht lassen, um zu ihrem Zwecke zu gelangen. Ueber die Gegenwart wagen sie nie etwas zu sagen, weil sie dabei zu leicht Gefahr laufen, daß man ihre Lügen aufdeckt, und so setzen sie dann die Bilder ihrer rasenden Einbildungskraft an die Stelle der undurchdringlichen Zukunft und locken Leichtgläubige durch ihre Weissagungen an sich. Doch, wir müssen woht von diesem Gespräche abbrechen, um Bettina zu schonen, die nur zu sehr geneigt scheint, jeden traurigen Eindruck in sich aufzunehmen. Kommt, Torelli, wir wollen nach Eurer Wohnung vorangehen und uns indeß über Eure Angelegenheiten und Wünsche besprechen!“ Damit gingen Beide in lebhaftem Gespräche fort und langten bei Torelli’s Wohnung an.
Leonti konnte eine Bewegung von Eifersucht und Mißtrauen in seinem Innern nicht unterdrücken, der Fremde beunruhigte ihn; allein Bettina zerstreuete jeden Verdacht. „Er wird unser Beschützer seyn,“ sagte sie, „das hat er mir versprochen. Du siehest, er spricht schon mit meinem Vater, dessen Freundlichkeit uns eine gute Vorbedeutung ist; und wenn es dem Fremden durch seine Vorstellungen, seine Bitten und sein Ansehen gelingen sollte, meines Vaters Zustimmung zu unserer Verbindung zu erlangen, so würde ich ihm mehr, als für mein Leben, verpflichtet seyn. Ach, Leonti, Du Gegenstand meiner sehnlichsten Wünsche! Beste Mutter“ — Thränen der Freude erstickten ihre Worte. Die Arme überließ sich den seligsten Hoffnungen, ohne der Erfüllung derselben gewiß zu seyn“ — Sie langten nun auch bei Torellis Wohnung an und Alle setzten sich um einen Tisch, der zum Abendessen gedeckt war. Der Fremde mit seinen einschmeichelnden Worten erhob die Freigebigkeit des Wirthes, ermuthigte die beiden Liebenden und nahm Alle, die ihm zugehörten, ganz für sich ein.
Leonti, der vorher nur an die Gefahren dachte, die Bettina bedrohen könnten, beschäftigte sich jetzt nur noch mit den letzten Worten Elmoda’s und sann hin und her, wo der Vampyr seyn könnte, den sie meinte. Eine dunkle Ahnung ergriff ihn wider seinen Willen, und der bloße Gedanke an einen solchen Blutsauger erregte ein Grausen in ihm, dessen er nicht Herr zu werden vermochte. Je schrecklicher es ihm schien, desto mehr bezweifelte er, daß es wirklich Geschöpfe gäbe, die zu allen den Gräueln fähig wären, welche man jenen Ungeheuern zuschreibt. Er fragte den Fremden um seine Meinung und lächelnd antwortete ihm dieser:
„Lange Zeit hat man die Erzählungen von Vampyren für Fabeln gehalten und geglaubt, daß sie nur ein Bild für die verfolgte und unterdrückte Tugend wären. Nur zu häufig sehen wir in der Welt, daß Unschuld und Tugend dem Angriffe der Bosheit unterliegen müssen; nun sagt man, daß Menschen, welche hier auf der Erde dieß Unglück erlebten, wenn sie mit der unbefriedigten Rache im Herzen stürben, nach ihrem Tode wiederkämen und jeden ihrer Schritte mit Blut bezeichneten. Diese Vampyre suchen sich mit unerbittlicher Grausamkeit unter dem schönen Geschlechte das Wesen zum Opfer aus, welches am reizendsten und liebenswürdigsten ist, und in kurzer Zeit wird die, welche sie erkoren haben, ihre Beute.“
„O Gott“ sagte Leonti, „und dennoch befreiet man die Erde von diesen schrecklichen Ungeheuern nicht!“ — „Es giebt kein äußres Merkmahl, das sie kenntlich machte; sondern meistens ist ihre Tücke sogar unter dem anziehendsten Aeußern verborgen.“ — „Also existiren doch wirklich solche Wesen?“ — „Ich habe mich davon überzeugt und ihr mögt darüber nach einer Begebenheit urtheilen, die ich selbst erlebt habe.“
„Ich bin ein großer Freund vom Reisen, und um mein Vergnügen zu erhöhen und stets neue Gegenstände zu sehen, habe ich mich nie an gewisse Länder gebunden, sondern mir die ganze Erde zur Reiseroute vorgezeichnet, indem ich nie zum zweiten Male an einen Ort gehe, wo ich schon gewesen bin. So hatte ich einst auch das weite Gebiet der russischen Czaare durchwandert und reisete nun über Königsberg und Warschau, wo ich mich einige Zeit aufhielt, zurück. Ich mochte etwa zwanzig Meilen schon wieder von Warschau entfernt seyn, als sich mein Kutscher eines Abends verirrte, so daß der Wagen halten mußte. Es war schon ganz finster und die Pferde konnten in dem tiefen Schnee durchaus nicht weiter kommen, da entdeckte der Postillion ganz in der Nähe ein Schloß und rieth mir, dort ein Nachtlager zu suchen. Ich war gezwungen, diesen Rath zu befolgen und machte mich auf den Weg. Das Thor war geöffnet; ich trat hinein, aber kein Mensch war zu sehen; ich rief, Niemand antwortete. Dennoch war das Schloß bewohnt, denn schon von weitem hatte ich durch die Bäume ein hell erleuchtetes Zimmer gesehen; ich suchte deshalb dies Zimmer auf. Die Stille, welche im ganzen Hause herrschte, und die Finsterniß machten mich wirklich etwas furchtsam; doch, bald sah ich das Licht durch eine Thür schimmern, die ich öffnete. An einem wohlbesetzten Tische saß eine junge, ausgezeichnet schöne Frau; mein Eintreten schien sie nicht zu stören, denn sie regte sich nicht und hatte den Kopf an einen Sessel gelehnt, als ob sie von Müdigkeit ergriffen, einem unerwarteten Schlummer unwillkührlich hätte unterliegen müssen. Anfangs bestärkte mich Alles in dieser Meinung; vier Kinder waren um sie her; eins derselben überhäufte sie weinend mit Liebkosungen; zwei andere riefen sie unaufhörlich und ein junges, höchst reizendes Mädchen, die eben erst über die Kinderjahre hinaus war, bemühete sich, die übrigen zum Schweigen zu bringen. Sobald sie mich erblickte, eilte sie mir entgegen und sagte mit liebenswürdiger Offenheit:
„Mein Herr, die Mutter hat Ruhe nöthig, denn sie hat den ganzen Tag so viel geweint. Wecken Sie sie ja nicht auf; sehen Sie, sie schläft.“ — Ueberrascht fragte ich das schöne Kind, was hier vorgefallen sey? und sie antwortete mir: „Wir aßen zu Abend und ein Freund der Mutter war bei uns. Er sprach und die Mutter weinte. Dann näherte er sich ihr so, daß ich darüber erschrak, doch endlich ging er fort. Aber die Mutter wurde bleich und, indem sie zitternd etwas auf dieß Papier schrieb, rief sie mich plötzlich: Elisca! Ich eilte zu ihr, sie sah mich an, aber ihr Blick machte mich bange, dann schlief sie ein.“
„Jetzt stieg ein schrecklicher Verdacht in mir auf, ich nahm das Papier aus Elisca’s Händen und las es. Es enthielt einige abgerissene Zeilen, die sie mit vieler Mühe geschrieben zu haben schien und die ungefähr Folgendes sagten: „Das Ungeheuer ... ich habe ihn gastfreundschaftlich aufgenommen ... ich liebte ihn und er bringt mich um ... ich habe nur noch einen Augenblick zu leben, meine Kraft verlischt ... mein Blut ist ausgesogen ... ach, meine armen Kinder, was soll aus euch werden “ — Ich untersuchte die unglückliche Mutter, aber jeder Versuch, sie wieder ins Leben zu bringen, war vergebens; sie war nicht mehr Ein Vampyr hatte sie gemordet.“ —
„Ein Vampyr?“ sagte Torelli. — „Ja, ich habe ihn selbst gesehen.“ — „Ihn gesehen?“ wiederholte Leonti, vor Wuth zitternd. — „Ja, er kam noch einmal zurück, nahm die reizende Kleine die ihn mit ihren Händchen schlagen wollte, in seine Arme und in wenigen Augenblicken war auch die schöne Elsca todt. Ich aber eilte mich von diesem Schauplatze des Schreckens zu entfernen“ —
„Wie“ rief Leonti, „Ihr stießet dem Ungeheuer nicht sogleich einen Dolch ins Herz?“ — „Das war nicht möglich.“ — „Nun, so hättet Ihr den Bösewicht wenigstens der Gerechtigkeit überliefern sollen“ — „Ich hatte wichtige Gründe, die ich Euch nicht entdecken kann, um ihn weniger streng zu behandeln!“ erwiederte, heimlich lächelnd, der Fremde. „Doch, es ist schon spät; wir wollen uns entfernen, junger Mann! Lebt wohl, ehrlicher Torelli! Auf Wiedersehen, reizende Bettina!“
Welche verwirrte Gefühle wurden jetzt in Leontis Seele durch das, was er den Tag über gehört und gesehen hatte, geweckt! Eine unwillkührliche Traurigkeit, gleichsam die Anzeige eines bevorstehenden Unglücks, bemächtigte sich seiner.
Er folgte dem Fremden; aber mit einer unerklärlichen Unruhe schied er dies Mal von Bettina. Besonders in dem Augenblicke, wo die Gondel, welche ihn nach Venedig zurückführen sollte, von Lido’s Ufer abstieß, schlug sein Herz heftiger, als je. Selbst das fröhliche Lied des Schiffers konnte seinen Trübsinn nicht zerstreuen, und als die Gondel am jenseitigen Ufer angekommen war, verließ Bettina’s Geliebter das Fahrzeug eben so niedergeschlagen, als er es betreten hatte.
Der Fremde, welcher noch kein Wort gesprochen hatte, und eben so unempfindlich gegen die Seufzer Leontis, wie gegen den muntern Gesang seines Fährmanns gewesen war, unterbrach endlich das Schweigen. „Ich muß Euch betrüben,“ sagte er zu Leonti; „aber ein Freund hat ja oft schmerzliche Pflichten zu erfüllen, und da ich lebhaften Antheil an Euch nehme, so ist es auch meine Pflicht, Euch zu sagen, was ich weiß.“ —
„Redet,“ erwiederte Leonti hastig, „ich bin auf Alles gefaßt.“ — Der Fremde fuhr deshalb sofort: „Bettina’s Ohnmacht und der Schrecken, welchen eine elende Landstreicherin allen Gemüthern einzuhauchen wußte, hat heute den ungerechten Haß Torelli’s gegen Euch unterdrückt; aber er hat deshalb seine Gesinnung nicht geändert, sondern er beharrt bei seinem ersten Entschlusse. Nur auf meinen Rath und auf meine dringenden Bitten, hat er sich entschlossen, um die Gesundheit seiner Tochter zu schonen, Euch in seinem Hause zu lassen. Ihr habt einige Augenblicke hindurch ein Glück genossen, das nicht länger währt, als ein Traum. Dies ist das Unglück, welches Euch bevorsteht. Gebt jede Hoffnung auf, diese Bestimmung zu ändern. Torelli hat mir aufgetragen, Euch zu sagen, daß Ihr den Willen eines Vaters respectiren und nie mehr Euch an einem Orte sehen lassen möchtet, wo schon Eure bloße Gegenwart unangenehme Störungen bewirkt.“ —
„Nun,“ erwiederte Leonti, „wenn nichts den Grausamen rühren kann, so will ich fliehen. Ja, weit in die Ferne will ich auf ewig entfliehen! — Doch, was sage ich? Was soll aus Bettina werden? Sie wird vor Gram sterben und ich werde Schuld an ihrem Tode seyn ... Nein, nein!“ rief er wüthend, „ich will sie nicht verrathen, ich werde sie nie verlassen“ — „Wenn Ihr euch nicht von ihr trennen wollt,“ sagte der Fremde, „so bleibt Euch nur noch ein Mittel übrig.“ — „Sagt, welches?“ — „Ihr müßt sie entführen.“ —
„Entführen! ... Aber wie? ... Ohne Unterstützung.“ — „Die sollt Ihr finden.“ — „Ohne Vermögen.“ — „Ihr könnt über das meinige nach Eurem Belieben schalten.“ — „Großmüthiger Freund “ — „Ich will Euch Dienste in der schottischen Armee verschaffen; ich werde Euch ein Empfehlungsschreiben an den General, der sie commandirt, mitgeben; er ist mein Verwandter und mein Freund und wird für Eure Beförderung sorgen.“ —
„Aber mein Regiment, mein Oberst, der mich liebt und mich auszeichnet.“ — „Ihr müßt Eure Flucht geheim halten.“ — „Meine Ehre!“ — „Ich habe durch bittere Erfahrungen Welt und Menschen kennen und über ihre Grundsätze urtheilen gelernt. Auch für Euch wird die Zeit kommen, wo Euch die Heftigkeit der Jugend nicht mehr zu Irrthümern verleitet; dann werdet Ihr durch Erfahrung überzeugt seyn, daß die Ehre ein nichtsbedeutendes Wort, ein leeres Traumbild und eine Täuschung des heuchlerischen Stolzes ist. Junger Mann, laßt solche Thorheiten und denkt an Euer Glück“ —
„Wenn mein Glück mich zum Verbrecher macht, so will ich es nicht!“ — „Nun, so müßt Ihr auf Bettina verzichten“ — „Ihr entsagen! Unmöglich.“ — „So geht meinen Vorschlag ein.“ — „Gut, ich will mich Euch blindlings überlassen.“ — „Ich werde für Alles sorgen.“ — „Ihr müßt uns zur Flucht behülflich seyn,“ — „Ein Fahrzeug soll für Euch am Ufer bereit stehen.“ — „Wann?“ — „Morgen, bei Tages Anbruch.“ — „Wohlan“ — „Rechnet ganz auf mich.“ — „Lebt wohl!“ sagte Leonti mit dumpfer Stimme.
Langsam vergingen indeß die Stunden der Nacht. Während Leonti in der heftigsten Bewegung war, lag Bettina, von den Auftritten des verflossenen Tages ermüdet, sorglos in tiefem Schlafe. Ein heiterer Traum beschäftigt ihre Phantasie, welche ihr das Bild einer glücklichen Zukunft vorhält. Alle Hindernisse sind aus dem Wege geräumt und trunken vor Liebe und Freude liegt Leonti vor ihr auf den Knien. Er nennt sie seine Vielgeliebte, seine angebetete Gattin und ihr Vater selbst führt sie zum Altare, wo der Priester die Liebenden auf ewig vereinen will. Aber in demselben Augenblicke bricht ein ungeheures Gewitter los. Der Sturm braust, die Blitze folgen hastig einer auf den andern, der Donner krachte so, daß die Säulen des Tempels zusammenstürzen und alles untergeht. Bettina sinkt leblos zu Boden ... So träumte Bettina, als sie plötzlich aus dem Schlummer geweckt wurde, indem Jemand mit einem kleinen Steine an ihr Fenster warf. Sie erhob sich von ihrem Lager. „Ich erwarte Dich im Walde“ rief ihr Jemand zu. Sie rieb sich die Augenlieder und sah umher, aber es war Niemand mehr zu sehen.
Vor Erstaunen blieb sie einen Augenblick unbeweglich, indem sie nicht wußte, ob das alles ihr nur geträumt, oder ob wirklich Jemand sie gerufen habe; dann aber ermunterte sie sich und überzeugte sich, daß sie nicht bloß geträumt, sondern ganz deutlich Leontis Stimme gehört habe. „Im Walde?“ diese Worte klangen noch in ihren Ohren fort und da ihr Vater abwesend war, so benutzte sie die günstige Stunde, sich schnell anzukleiden und zu der heimlichen Zusammenkunft sich in den Wald zu begeben.
Sie irrte lange umher, ohne Leonti zu finden; doch endlich erblickte sie ihn an einem einsamen Orte am Ufer. Er sah bleich und verstört aus und seine Blicke hingen fest an dem Spiegel des adriatischen Meeres, dessen Ausdehnung er zu messen schien. Bettina eilte auf ihn zu und sagte, als sie näher kam: „Was fehlt Dir, theurer Leonti? Woher kommt es, daß bei meiner Annäherung sich eine solche Unruhe auf Deinem Gesichte malt?“ —
„Nenne es Ungeduld, Bettina; denn noch heute, ja in diesem Augenblicke muß ich wissen, ob Du mich wirklich liebst.“ — „Konntest Du je daran zweifeln?“ erwiederte sie. „Seit mein Mund geschworen hat, daß ich keinem Andern, als Dir angehören wollte, habe ich keinen andern Wunsch, keine andere Hoffnung gehegt, als Dich. Während Deiner Abwesenheit haben Sehnsucht und Thränen mich verzehrt; aber weder meines Vaters Zorn, noch alle Hindernisse, die sich meinen Wünschen in den Weg stellten, noch auch das Unangenehme, was ich sonst erdulden mußte, nichts konnte, lieber Leonti, und nichts wird jemals in meinem Herzen die Liebe zu Dir unterdrücken können.“ —
„Wohlan, so fasse Muth“ — „Die Zeit der Prüfungen ist jetzt vorüber; ein milderes Geschick läßt uns wenig fürchten und alles hoffen.“ — „Täusche Dich nicht!“ — „Mein Vater hat Dich ja gestern ohne Widerwillen in seinem Hause gesehen.“ — „Er verstellte sich!“ — Nein, er wird jetzt gewiß in unsere Verbindung willigen.“ ... — „Im Gegentheil hat er mir verboten, Dich jemals wieder zu sehen.“ — „Himmel Wer hat Dir das gesagt?“ — „Der Fremde.“ — „Der Fremde“ — „Ja, und ich muß nun fort von hier“ — „Leonti, Du wolltest mich verlassen?“ — „Du sollst mit mir fliehen.“ — „Was forderst Du von mir“ — „Das einzige, was uns noch übrig ist.“ — „Du liebst Deine Bettina und willst sie so entehren!“ — „Ich will sie retten.“ —
„Du willst mich retten und verlangst, daß ich meine Familie verlassen und meine Ehre Preis geben soll? Besinne Dich, bester Leonti; laß von Deinem Vorhaben ab! Bedenke, daß uns das Unglück mit seiner Rache überall verfolgen würde.“ — „Ich denke nur an Dich und an unsere Liebe. Alles ist zu unserer Flucht bereit.“ — „Zu unserer Flucht Nein, nein, ich fliehe nicht.“ — „So lebe wohl!“ — „Leonti! kennst Du die Stimme nicht mehr, die Dir einst so teuer war? Wie, Du gehest? Du willst fliehen und mich verlassen?“ — „Du weinst, Bettina, und doch ...“ — „Undankbarer, den ich so sehr geliebt habe.“ —
„O Bettina, suche nicht mich von der Ausführung meines Vorhabens abzuhalten; denn wenn ich bliebe, würde ich nur Deinem Glücke im Wege stehen. Darum will ich in ferne Gegenden fliehen und dort auf dem Gipfel eines einsamen Felsens oder in einer verborgenen Höhle soll der Himmel allein Zeuge meines ewigen Schmerzes seyn. Unglücklich genug, Dich hoffnungslos geliebt zu haben, Dich ewig anzubeten und doch noch unglücklicher dadurch, daß ich es Dir nicht mehr sagen kann, werde ich, ohne Vaterland, ohne Obdach, ohne Freund, wenn der Tod mich endlich erlösen wird, noch mit der letzten Bewegung meiner Lippen der Einöde, die mich verbirgt, Deinen Namen nennen und meine Thränen —“ —
„Halt ein, Leonti, Du zerreißest mir das Herz. Bei allem, was Dir heilig ist, beschwöre ich Dich, habe Mitleid mit mir, verschone mich!“ — „Aber wir müssen uns trennen.“ — „Ich werde Dich nie verlassen.“ — „So folge mir dann!“ — „Unmöglich!“ — „Die Zeit entflieht, so muß ich denn allein gehen! Lebe wohl!“ — „Ach, bleibe! Höre auf die Bitten Deiner Geliebten, die Dich anbetet! Grausamer hier zu Deinen Füßen beschwöre ich Dich“ ...
In diesem Augenblicke kam der Fremde eiligst herbei und sagte den beiden Liebenden, daß Torelli nach Hause zurückgekommen wäre und jetzt ihren Wünschen geneigt zu seyn schiene. Er ermunterte Leonti, diese Stimmung Torelli’s zu benutzen und sagte: „Man erwartet Euch; eilt, säumt nicht einen Augenblick! Geht voran, wir werden Euch sogleich folgen. Bald werde ich selbst Eure geliebte Bettina in die Arme ihres Vaters führen, der schon halb und halb geneigt ist, unsern vereinten Bitten Gehör zu geben.“
Leonti ließ ihm kaum Zeit, auszureden. Von der süßesten Hoffnung beseelt, eilte er dem Orte zu, wo er die Versicherung eines lange ersehnten Glückes zu finden hoffte. Nahe bei Torelli’s Wohnung blieb er stehen und horchte auf die Reden einer Menge von Soldaten, welche um die Gondeliere her versammelt waren. Torelli erkundigte sich nach ihrem Begehren. Sie fragten nach Leonti und dieser trug kein Bedenken, sich ihnen zu zeigen. — „Wir müssen Euch arretiren!“ sagten, die Soldaten zu ihm. — „Mich arretiren?“ — „Ja, folgt uns nur.“ — „Was habe ich denn gethan?“ erwiederte Leonti ganz erstaunt. — „Ihr habt von hier desertiren und in schottische Dienste gehen wollen.“ — „Wie? Wer hat euch das gesagt?“ rief Leonti, von Ahnung des Zusammenhanges ergriffen.
Das Gespräch wurde indeß durch einen andern Auftritt unterbrochen. Athemlos und ganz erschrocken stürzte ein Gondelier herbei, „Freunde“ rief er, „ich muß euch eine schreckliche Nachricht mitteilen. Es ist ein abscheuliches Verbrechen begangen. Während ich den Kanal hinabfuhr, fand meine Gondel einen Widerstand im Wasser, ich sah nach und, o Himmel ich erblickte — noch zittere ich an allen Gliedern — ich erblickte einen Leichnam, der auf dem Wasser schwamm und in welchem ich die Tyrolerin erkannte, die bei unserm Feste erschien und uns vor einem Vampyr warnte.“ —
„Gott,“ rief Leonti, „welcher Verdacht steigt in mir auf Wie wird mir nun alles klar: Die Tyrolerin ermordet; mein Geheimniß verrathen ... Ja, er ist es ... Torelli! Soldaten! Gondeliere! ihr sollt alles erfahren. Eilt mit mir nach dem Walde zu. Laßt uns Bettina und den Verräther suchen! Eilt, denn ich zittere, daß wir zu spät kommen. Aber was erblicke ich?“
Aechzend, bleich und entstellt, mit wildflatternden Haaren erschien Bettina, einem Gespenste gleich; mit großer Anstrengung schleppte sie sich noch wenige Schritte vorwärts und indem sie alle ihre Kräfte zusammen nahm, rief sie: „Bester Vater, theurer Leonti! rächet mich! Der Fremde ...“ Doch, sie konnte nicht mehr weiter reden; das Wort erstarb auf ihren Lippen. Ihr letzter Seufzer entfloh und leblos sank sie zu den Füßen ihres Geliebten nieder.
Schrecken und Verzweiflung ergriff alle Anwesende und wüthend riefen sie: „Wo ist der Fremde?“ Leonti, sah und hörte nicht mehr. Er eilte vor allen übrigen voraus und wie ein wüthendes Raubthier suchte und verfolgte er seine Beute, Torelli und die Gondeliere folgten ihm. Umsonst versuchte er Worte hervorzubringen; nur zu einem wüthenden Geschrei öffnete sich sein Mund und durch Zeichen mußte er die Orte angeben, wo er den Mörder zu finden hoffte. Rache malte sich auf dem Gesichte eines Jeden; Alle brannten vor Begierde, den Schuldigen zu bestrafen. Man lief, man suchte, man rief — doch umsonst, der Fremde war verschwunden.
So folgt oft dem größten Glücke das härteste Unglück, den seligsten Hoffnungen der größte Schmerz. Leonti war oder glaubte sich wenigstens dem Ziele zu nahe, das ihn zum glücklichsten Menschen machen sollte, und nun riß der Tod so plötzlich das Wesen aus seinen Armen, das er anbetete, das ihn allein noch mit süßen Banden an die Erde und an dies Leben fesselte. Wie immer der tiefste Schmerz der ruhigste ist, indem er selbst zu den augenblicklichen Ausbrüchen desselben die Kräfte raubt; so waren auch Leonti selbst die lindernden Thränen versagt. In dumpfer Verzweiflung starrte er vor sich hin. Für ihn war nun Alles dahin, da Bettina nicht mehr lebte. Ihr Engelskopf ruhete entseelt in dem Schooße ihrer Mutter und bald mußte eine Hand voll Erde auch die letzten sichtbaren Spuren aller ihrer Reize verwischen. Funfzehn Jahre hatte sie der Unschuld und der Liebe gelebt und ein einziger Augenblick reichte hin, sie auf ewig von dieser Erde zu nehmen. Aber Leonti wollte seine geliebte Bettina nicht überleben. Seine starren Augen hingen an dem entseelten Körper; er rief den Namen seiner Freundin, die ihn nicht mehr hörte und indem seine Kräfte sich in dumpfer Verzweiflung verzehrten, sank er bewußtlos zu Boden.
Man hob ihn auf und trug ihn mit der theuren Leiche in Torelli’s Haus, wo man sich mit der größten Sorgfalt seiner annahm. Seine Krankheit wurde gefährlicher und eine anhaltende Schwäche schien ihn nicht wieder verlassen zu wollen; doch endlich trug seine jugendliche Natur den Sieg über das verzehrende Fieber davon, welches sich seiner bemächtigt hatte. Aber nicht so glücklich erholte sich sein Geist; nichts konnte in seinem Innern die Wuth gegen den Fremden, der ihn so schändlich verrathen hatte, unterdrücken. Er beschloß, seine geliebte Bettina nur zu überleben, um sie zu rächen und alles aufzubieten, um den Mörder derselben mit seinem Schwerdte zu erreichen. Noch ein Mal ging er in den Wald zu jenem ihm wohlbekannten Baume, in dessen Schatten Bettina einst ihm ewige Liebe geschworen hatte und wo sie nachher ein Raub des Blutdürstigen geworden war. Von den verschiedenen Erinnerungen, welche dieser verhängnißvolle Ort ihm aufdrängte, bewegt, irrte er weiter im Walde umher, bis er endlich an die Spitze desselben gelangte, Aber, welche Ueberraschun erwartete ihn hier! —
Auf einem Baumstamme saß ein Mann, beschäftigt, die schöne Gegend zu zeichnen, dessen Figur, dessen Haltung, selbst dessen Kleidung Leonti die Ueberzeugung gab, Bettina’s Mörder gefunden zu haben. Wüthend stürzte er, deshalb auf ihn los, um ihn von hinten zu ergreifen; aber verwundert sah der Mann sich um und Leonti erblickte ein ganz fremdes Gesicht, dessen Augen in Thränen schwammen. Wehmüthig blickte er Leonti an, dessen Zorn augenblicklich dem Mitleiden und der Rührung wich, welche das Gesicht des Fremden bei ihm erweckte.
„Junger Mann,“ sagte er bewegt, „verzeihet mir! Euer Gesicht benimmt mir einen Irrthum, in welchen mich Eure Gestalt versetzt hatte und den ich, von Schmerz und Rache gefoltert, zu schnell für Wahrheit nahm.“ — „Ach!“ erwiederte der Fremde, „wenn Ihr von Schmerzen gequält, wenn Ihr unglücklich seyd, so setzt Euch zu mir, ich bin es auch. Wenn wir einander zu Vertrauten unseres Unglücks machen, so werden wir dadurch Beide Linderung unserer Schmerzen bekommen.“ —
Leonti fühlte das dringende Bedürfniß, ein Herz zu hören, das mit dem seinigen gleichgestimmt wäre und so vergaßen es Beide leicht, daß sie einander noch fremd waren. Wie zwei Menschen, die nichts als ihr Vaterland gemein haben, wenn sie sich plötzlich in fernen, fremden Landen begegnen, einander gleich bekannt und befreundet sind; wie sich Beide durch das Eigenthümliche, durch die Kleidung und die Sprache des Vaterlandes in einem Augenblicke, wie alte Bekannte, wie Brüder angezogen fühlen; so werden auch zwei Herzen, die ein gleiches Unglück erfahren haben, durch einen Augenblick für immer mit einander befreundet und verbunden, und eben so wurden auch Leonti und der Fremde in einem Augenblicke Freunde.
Leonti erzählte zuerst von seiner langen, treuen Liebe, von den Hindernissen, die ihr Torelli in den Weg legte, von seiner Entfernung von Venedig, von seiner Rückkehr und seinen Hoffnungen, von der Verrätherei des Fremden und von Bettina’s Tode. Als er bei diesem letzten Umstande seiner Erzählung den Fremden beschrieb, unterbrach ihn sein neuer Freund plötzlich und rief: „Ja, das war er; das war Lord Ruthwen!“ — „Wie,“ erwiederte Leonti befremdet, „kennt Ihr das Ungeheuer?“ — „Ach! er ist die Ursache aller meiner Leiden. Doch kommt, laßt uns gemeinschaftlich ihn verfolgen. Ihr sollt alle Verbrechen unsers Feindes kennen lernen: laßt uns nur jetzt dabei keine Zeit verlieren, sondern vielmehr unsere Kräfte vereinigen, um Rache an ihm zu nehmen.“ — „Aber, sagt mir nur, wohin ...“ — „Kommt! sage ich Euch; vertrauet Euch ganz einem treuen Freunde und macht Euch augenblicklich mit mir auf den Weg.“ —
So sah sich Leonti gezwungen, ihm zu folgen. Beide bestiegen ein Fahrzeug und ein günstiger Wind entführte dasselbe so schnell, daß sie bald das prächtige Venedig aus den Augen verloren.
II
 ord Ruthwen, dieser seltsame, geheimnißvolle Mann, der unter dem äußern Scheine von Biederkeit und Liebenswürdigkeit die abscheulichsten Eigenschaften verbarg, hatte eine günstige Gelegenheit zu benutzen gewußt, um dem unglücklichen jungen Aubrey, der ihn eine Zeit lang auf seinen Reisen begleitet und dabei einen großen Theil seiner Verbrechen kennen gelernt hatte, einen Schwur darauf abzunehmen, daß er ein Jahr lang über alles, was er von ihm gesehen und erfahren hätte, schweigen wolle. Weil er den Lord mit dem Tode kämpfen sah, hatte Aubrey diesen Eid geleistet und er glaubte ihn ohne Nachtheil halten zu können, da jener vor seinen Augen verschied. So kehrte er mit dem in seiner Brust verschlossenen Geheimnisse nach London, seiner Vaterstadt, zurück. Aber wer schildert sein Erschrecken, als hier, bald nach ihm, auch der todt geglaubte Ruthwen erschien und ihn an seinen Schwur mahnte. Mit Zittern sah Aubrey, wie der Bösewicht sich in allen Gesellschaften seiner eigenen Schwester näherte, wie er sie vor allen übrigen jungen Mädchen auszeichnete und ihr Herz durch sein angenehmes Aeußere zu gewinnen anfing.
ord Ruthwen, dieser seltsame, geheimnißvolle Mann, der unter dem äußern Scheine von Biederkeit und Liebenswürdigkeit die abscheulichsten Eigenschaften verbarg, hatte eine günstige Gelegenheit zu benutzen gewußt, um dem unglücklichen jungen Aubrey, der ihn eine Zeit lang auf seinen Reisen begleitet und dabei einen großen Theil seiner Verbrechen kennen gelernt hatte, einen Schwur darauf abzunehmen, daß er ein Jahr lang über alles, was er von ihm gesehen und erfahren hätte, schweigen wolle. Weil er den Lord mit dem Tode kämpfen sah, hatte Aubrey diesen Eid geleistet und er glaubte ihn ohne Nachtheil halten zu können, da jener vor seinen Augen verschied. So kehrte er mit dem in seiner Brust verschlossenen Geheimnisse nach London, seiner Vaterstadt, zurück. Aber wer schildert sein Erschrecken, als hier, bald nach ihm, auch der todt geglaubte Ruthwen erschien und ihn an seinen Schwur mahnte. Mit Zittern sah Aubrey, wie der Bösewicht sich in allen Gesellschaften seiner eigenen Schwester näherte, wie er sie vor allen übrigen jungen Mädchen auszeichnete und ihr Herz durch sein angenehmes Aeußere zu gewinnen anfing.
Umsonst warnte er seine Schwester vor ihm; umsonst bat er sie, den Mann zu fliehen, der ihr Herz bestochen hatte. Sie glaubte, ihr Bruder hege nur eine persönliche Abneigung gegen Lord Ruthwen, da er, vermöge seines Eides, seine Warnungen durch keine Gründe zu unterstützen vermochte, und so überließ sie sich ganz ihrer Zuneigung zu dem Manne, mit dem sie ihren Bruder bei näherer Bekanntschaft zu versöhnen hoffte.
Aubrey verfiel darüber in eine tiefe Schwermuth, die, als nun gar der Verräther sich mit seiner Schwester verbinden wollte und ihn aufs Neue an die Erfüllung seines Eides mahnte, in die fürchterlichste Wuth überging. Mit Gewalt wollte er die Verbindung hindern, da der Eid seine Zunge band; allein die Verwandten seiner Schwester waren eben so sehr für Lord Ruthwen eingenommen, als diese selbst und daher der verabredeten Verbindung sehr geneigt. Man hielt seine Wuth gegen Lord Ruthwen für Wahnsinn, man gewährte ihm deshalb auch die einzige Bitte nicht, die Verbindung seiner Schwester nur noch einen Tag aufzuschieben, sondern man gab ihm Wächter, um seine Wuth in Schranken zu halten und ihn an fernern Versuchen, jener Verbindung in den Weg zu treten, zu hindern.
Und so wurde denn derselbe Tag, den Aubrey sich, als Frist erbeten hatte, der letzte von dem Jahre, für welches der Eid ihm Schweigen auferlegte, der Hochzeitstag seiner Schwester. Aber dieser Tag, von dem Georgina hoffte, daß er sie einem neuen Leben zuführen werde, raubte ihr das Lebens denn ihr Verräther hatte ihr das Blut aus.gesogen und war darauf verschwunden.
Lange Zeit war Aubrey vor Schmerz seiner selbst nicht mächtig und man fürchtete auch für sein Leben. Allein die Natur kämpfte mit Glück gegen seine Krankheit und er kehrte zum Leben zurück. Rache war das erste Gefühl, dessen er sich wieder bewußt wurde und kaum wieder hergestelt, verließ er London, um Lord Ruthwen zu verfolgen: Er erinnerte sich, daß Italien für die meisten Menschen, denen es ihre Lage erlaubt zu reisen, das Land ihrer Wünsche sey und da ein dunkles Gefühl in überdieß aufforderte, seine Nachforschungen hieher zu richten; so beschloß er zum zweiten Male die Gegenden zu besuchen, die er unter glücklichern Umständen schon einmal durchwandert hatte. Er kam nach Venedig und forschte zuerst überall nach Lord Ruthwen; doch umsonst er konnte keine Spur desselben entdecken. So führte ihn die Schwermuth an abgelegene Orte, wo keines Menschen Anblick ihn in den Gefühlen seines Schmerzes störte, und eines Tages auch an das Gestade des adriatischen Meeres. Hier setzte er sich, von den Reizen der herrlichen Aussicht überrascht, nieder, um sie zu zeichnen und hier war es, wo ihn Leonti fand. Von gleichen Gefühlen beseelt, mit gleichen Zwecken, reiseten sie zusammen von Venedig ab und schwuren sich, einander nie mehr zu verlassen.
Indem sie einen Feind aufsuchten, der ihnen immer noch schneller enfloh, als sie ihn verfolgen konnten, durchirrten sie fast ganz Italien, ohne sich irgendwo aufzuhalten. Wenn der Mensch in einer glücklichen Lage ist, so nimmt vor seinen Augen alles, was ihm umgiebt, eine lachende Gestalt an; aber dem Unglücklichen scheint die ganze Erde .ein Ort der Verdammniß zu seyn und selbst die heitersten Bilder vermögen keinen angenehmen Eindruck auf seine Seele zu machen. In dieser Stimmung reiseten auch Leonti und sein Freund. Die Wunder der Natur hatten keine Reize für sie und wenn der Zufall sie bei fröhlichen Festen oder nur bei zufriedenen, glücklichen Menschen vorüber führte; so wurde dadurch Leontis Traurigkeit nur noch vermehrt.
Aubrey indeß wünschte sich nach Florenz zu begeben, wo ihn ein Banquier aus Neapel erwartete, den er auf seiner ersten Reise durch Italien kennen gelernt hatte. Nur noch wenige Stunden von dieser Stadt entfernt beschleunigten Beide ihre Reise, als sie durch einen sonderbaren Vorfall in dem nächsten Dorfe aufgehalten wurden. Als sie sich nämlich dem Dorfe Roveredo näherten, wurden sie durch ein helles Licht überrascht. Es war noch nicht spät und dennoch war das ganze Dorf durch Fäckeln die am Wege standen, erleuchtet. Sie vermutheten deshalb, daß irgend ein Fest gefeiert werde und dennoch vernahmen sie keine Musik, kein fröhliches Geschrei und nichts, was darauf hindeuten konnte. Im höchsten Grade verwundert und neugierig traten Leonti und Aubrey jetzt in das Dorf; aber wenn sie vorher über die Todtenstille, die zu herrschen schien, höchst erstaunt waren; so wurden sie jetzt noch mehr überrascht durch ein Lärmgeschrei, welches sich bei ihrem Erscheinen oben aus einem Fenster hören ließ.
„Es sind ihrer zwei!“ rief eine Stimme zu wiederholten Malen, und diese Worte verbreiteten in allen Häusern Schrecken und Verwirrung. Man antwortete durch Schluchzen und Seufzen darauf. Aubrey blieb stehen, um zu erfahren, wodurch ihre Gegenwart solchen Schrecken verbreiten könne; Leonti dagegen klopfte an die Thür eines Hauses, das größer und ansehnlicher war, als die übrigen; allein man öffnete nicht. Nach mehreren fruchtlosen Versuchen dieser Art nahm er seine Zuflucht zum Bitten und sagte: „Wir sind zwei verirrte Reisende, die das Unglück aus ihrem Vaterlande getrieben hat; gewährt uns, ein Nachtlager unter eurem gastfreundlichen Dache! Ich bin aus Venedig und wenn euch das Unglück an unsere Küsten geführt hätte, wahrhaftig, ich würde euch beistehen. Wollt ihr weniger hülfreich seyn? Oeffnet, ihr Einwohner von Roveredo!“
Nach langem Schweigen erschien endlich eine menschliche Gestalt am Fenster und erwiderte mit schwacher Stimme: „Ach, habt Mitleiden mit uns! Ein einziger Vampyr ist hinreichend, um das ganze Dorf in Furcht und Schrecken zu versetzen und eurer sind gar zwei. Entfernt euch von hier, sonst werden alle unsere Weiber und Mädchen noch vor Angst sterben!“
„Wir wären Blutsauger“ rief Aubrey erstaunt. Kommt von diesem Irrthume zurück; denn weit entfernt, solchen Ungeheuern zu gleichen, fürchten wir sie eben so sehr, als ihr, und gerade die Absicht, die Welt von ihnen zu befreien, hat uns hieher geführt.“
Auf diese Versicherung kam Rodogni eilig herab, um die beiden Reisenden in seine Wohnung einzulassen. Hier waren in einem großen, schön verzierten Zimmer eine Menge von Frauenzimmern versammelt, welche bei der Ankunft der beiden Fremden zitterten; doch bald, durch die Gespräche derselben ermuthigt, kamen sie von ihrer Furcht zurück und Rodogni erzählte nun auf Aubrey’s Bitten die Veranlassung der allgemeinen Besorgniß. „Seit zwei Tagen,“ sagte er, „hat sich ein Vampyr in unserm Dorfe sehen lassen.“ — „Ist es ein Ausländer?“ fragte Aubrey. — „Nein,“ erwiederte sein Wirth, „er ist aus unserm Lande und uns wohl bekannt, Ich will euch seine Geschichte mittheilen.“
„Roberti, ein armer Landmann aus unserm Dorfe, hatte von einem reichen Florentiner ein Gut in Pacht. Eine schlechte Erndte richtete ihn zu Grunde und er begab sich deshalb nach Florenz, um Hülfe und Unterstützung zu suchen; allein seine Bitte wurde ihm abgeschlagen. Die Verzweiflung hierüber griff seine Gesundheit schon bedeutend an und da man ihm nun auch das kleine, von seinen Eltern ererbte Feld verkaufte, da es er in kurzer Zeit seine Gattin und seine einzige Tochter verlor; so verschlimmerte sich hierdurch sein Zustand so sehr, daß er in wenig Tagen ein Raub des Todes wurde. Nun folgt ein Wunder, worüber ich noch ganz entsetzt bin. Vor drei Tagen nemlich sollte Roberti beerdigt werden; schon war das Grab geöffnet, das seine sterbliche Hülle aufnehmen sollte, da stürzte er plötzlich ganz lebendig aus dem Sarge hervor und verschwand auf dem Felde. Diese seltsame Begebenheit gab zu tausend Vermuthungen Anlaß. Als Richter des Ortes versammelte ich die angesehensten Einwohner um mich mit ihnen zu berathen und nach allem, was man je von ähnlichen Vorfällen gehört und gesehen hat, kamen wir Alle einstimmig darin überein, daß Roberti ein Vampyr sey, vor dem man sich zu hüten habe. Die Gefahr war nahe und groß, denn man hatte ihn in unserer Gegend umherstreifen sehen die Männer mußten sie deshalb schleunigst bewaffnen und die Weiber wurden in die Häuser eingeschlossen. Doch unsere Vorsichtsmaßregeln halfen nichts, indem dessen ungeachtet gestern Abend um zehn Uhr der Blutsauger durch unser Dorf gelaufen ist. Sein Erscheinen hat Allen den Muth benommen und mit Zittern sehen wir der verhängnisvollen Stunde entgegen, wo er wahrscheinlich wieder erscheinen wird.“
Wirklich hatte Rodogni kaum ausgeredet, als sich auf der Straße ein großer Lärm erhob. Leonti und Aubrey eilten zum Hause hinaus und verfolgten eine Gestalt, die ihnen zu entfliehen suchte, doch da sie zu schnell waren, so blieb der geheimnißvolle Mensch jetzt stehen und indem er seinen schwarzen Mantel zurückschlug, antwortete er auf ihre ernstlichen Drohungen mit unmäßigem Lachen. Sie beeilten sich, den vermeinten Blutsauger in Rodognis Haus zu führen, wo Jedermann, als er in’s Zimmer getreten war, rief: „Es ist Antonio, der närrische Antonio“ Und sogleich trat die größte Fröhlichkeit an die Stelle der Furcht.
Die beiden Reisenden konnten den Zusammenhang dessen, was man ihnen erzählt hatte, nicht begreifen, deshalb baten sie Antonio selbst um Aufschluß, der ihnen folgende Erzählung von seinem Vampyrismus mittheilte:
„Jeder bringt einen Character mit auf die Welt, der gewöhnlich seiner Physiognomie entspricht. Die meinige ist nicht traurig und in der That bin ich auch bis zur Narrheit lustig. Wahrscheinlich, um mich dafür zu bestrafen, hat man mich in ein verwünschtes Haus eingeschlossen, wo ich lauter Menschen fand, die wüthend wurden, wenn ich sprach, und weinten, wenn ich lachte. Sie sind Alle wahnsinnig, das weiß ich und bedaure sie von ganzem Herzen; aber ihre Gesellschaft war nicht nach meinem Geschmacke. Mein Gefängniß mißfiel mir so sehr, daß ich zum Erstaunen ernsthaft wurde. Ich sah im Voraus ein, daß ich ein geschlagener Mensch wäre, wenn mich die Langeweile ergriffe; deshalb suchte ich Gelegenheit zu entwischen.
Sie bot sich mir endlich dar. Man vergaß eines Tages eine geheime Thür zuzuschließen; ich bemerkte es und entschlüpfte, und so bin ich wieder frei. Aber das ist noch nicht alles. Als meine Flucht bekannt wurde, setzte man mir nach. Was war nun zu thun? Ich verließ mich auf mein Glück und floh in dies Dorf. Auf meinem Wege traf ich eine Kapelle; sie war offen und ich trat hinein. Ich war allein und näherte mich dem Altare. Hier fand ich einen Sarg und in dem Sarge lag — rathet einmal, wer? — mein Freund Roberti. Er war ein rechtschaffener Mann und ich freuete mich, ihn wieder zu sehen.
Aber während ich ihn betrachtete, knarrte die Thür und ich sah, daß sich mehrere Fackeln näherten. Man wollte die Leiche abholen. Meine Verlegenheit war groß, denn wie sollte ich unbemerkt wieder hinauskommen? Doch ein Geist, wie der meinige, findet immer einen Ausweg. Ich kam auf einen einzigen, herrlichen Gedanken. Ich legte mich auf den Todten und ließ mich, so versteckt, mit ihm hinaus tragen. Doch seht ihr wohl ein, daß ich keine Lust haben konnte, mich lebendig begraben zu lassen; als daher der Sarg an dem Grabe niedergesetzt wurde, sagte ich meinem Freunde Lebewohl, wickelte mich in diesen schwarzen Mantel, womit er zugedeckt war, und entfloh, schnell wie der Blitz. Offenbar glaubten die Leute, welche der Leiche gefolgt waren, daß der Verstorbene wieder aufgestanden wäre, denn ich sah, wie sie erblaßten, die Augen verkehrten und mit lautem Geschrei, davon liefen.
Wahrhaftig, es kann nichts Spaßhafteres geben. Ich beschloß deshalb, mein Abentheuer zu verfolgen und alle Abend zu derselben Stunde hier im Dorfe zu erscheinen, um die guten Leute auf die Probe zu stellen, die, wie ihr wißt, sehr muthig sind und mich, ich weiß nicht wofür, gehalten haben. Heute komme ich zum zweiten Male und nun habt ihr mich fest gehalten. Aber jetzt sagt einmal, ob ich närrisch bin. Ihr habt mich gehört und gesehen, nun urtheilt!“
So sprach Antonio. Seine Rückkehr und sein närrischer Streich wurden bald im ganzen Orte bekannt und was die Veranlassung des allgemeinen Schreckens gewesen war, wurde nun ein Gegenstand des Lachens. Man führte den Narren mit Musik auf einem andern Wege in das Haus zurück, aus welchem er entflohen war und pries den Muth der beiden Fremdlinge, welche am folgenden Tag ihre Reise nach Florenz fortsetzten.
In dieser Stadt fand Aubrey den Banquier aus Neapel, den er von seiner Reise nach Italien unterrichtet hatte. Alberti, so hieß er, freuete sich wie ein wahrer Freund, den jungen Aubrey wieder zu sehen und nahm auch Leonti sehr zuvorkommend auf. Er nöthigte sie, bei ihm zu wohnen und sagte dann zu. Aubrey: „Ich reise noch in dieser Nacht nach Neapel, wohin mich eine dringende Angelegenheit ruft. Die Tochter meines Freundes Ganem-Ali, eines Kaufmannes zu Bassora, die unglückliche Palmira, welche mir anvertrauet war, ist gestern hier in Florenz gestorben. Noch vor wenigen Tagen hatte ich große Hoffnung, sie wieder gesund und auch ganz glücklich zu sehen; denn um dies letztere zu bewirken, war ein Engländer, den ich bei Ihrer ersten Reise in Ihrer Gesellschaft kennen gelernt habe, nach Neapel gereiset, von wo er Palmira’s Geliebten hieher holen sollte. Nun aber ist dies unnöthig und ich wünsche deshalb, früh genug nach Neapel zu kommen, um dem edlen Lord Ruthwen die unnöthige Reise zu ersparen.“ —
Bei dem Namen des Lord Ruthwen erbleichte Aubrey, und Alberti, der seine Bewegung bemerkte, fragte ihn um die Ursache derselben. Als er alle Verbrechen des abscheulichen Blutsaugers erfahren hatte, drang er selbst in die beiden Freunde, mit ihm zu reisen, und diese waren so begierig, sich des Lord Ruthwen zu bemächtigen, daß sie mit Vergnügen dieser Aufforderung folgten. Sobald sie zu Neapel angekommen waren, stellten sie die eifrigsten Nachforschungen nach ihrem Feinde an; allein umsonst. Niemand hatte einen Menschen, wie sie ihn beschrieben, gesehen und Alberti zweifelte nun nicht mehr, daß auch Palmira ein Opfer dieses Ungeheuers geworden wäre, welches überall seinen Weg mit Blut bezeichnete und dennoch stets der Rache entging. Aubrey und Leonti wünschten die Geschichte der Geliebten Salems zu hören und Alberti versprach, ihnen dieselbe auf seinem Landhause zu erzählen, wohin er sie einlud.
Der Weg dahin führte sie an der Meeresküste vorbei und hier fesselte ein seltsamer Auftritt ihre Aufmerksamkeit. Ein junges Mädchen wurde nämlich von einer großen Menge Volks verfolgt und ein Schiffer versicherte den Leuten, daß sie eine Hexe wäre, der man nicht trauen dürfe. Er beklagte sich zugleich, von ihr die Bezahlung für die Ueberfahrt noch nicht bekommen zu haben und Aubrey berichtigte dies, um das arme Mädchen von ihrem Verfolger zu befreien;
allein das Volk hörte dennoch nicht auf der unglücklichen nachzulaufen. Leonti eilte um so mehr, sie in Schutz zu nehmen, da die Kleidung des Mädchens an die Bewohnerinnen von Venedig erinnerte. Aber wie erstaunte er, als er sich jetzt durch den Haufen von Menschen drängte, da eine bekannte Stimme ihn beim Namen rief. Er sah sich um und glaubte in dem verfolgten jungen Mädchen seine Bettina zu erkennen. Er rief sie, er ereilte sie zu erreichen; doch die Menschenmenge hatte sie von ihm getrennt und sie war verschwunden.
Das Volk, über seine Verwirrung und seinen Schmerz erstaunt, umringte und befragte ihn; Aubrey aber, der es sah und seinen Freund in Gefahr glaubte, eilte herbei und führte ihn endlich ins Freie, wo sie sich ungestört unterhalten konnten. „Ja, ich habe sie gesehen; es war Bettina“ rief Leonti und vergebens bemühete sich Aubrey ihn zu überzeugen, daß es eine Täuschung seiner Phantasie gewesen sey. Leonti verangte den Schiffer zu sprechen und um ihn zu beruhigen, schickte sein Freund nach diesem; allein er war nicht mehr zu finden und die Boten berichteten nur, daß er aus Aberglauben oder aus Bosheit dem Volke erzählt habe, daß das junge Mädchen vor einiger Zeit gestorben und dann plötzlich wieder erschienen sey, um ihren Geliebten zu verfolgen.
Aubrey lächelte bei dieser Nachricht, indem er hierin den Grund fand, der dem jungen Mädchen die Verfolgungen des Volkes zugezogen habe. „Gewiß,“ sagte er, „ist sie eine Unglückliche, die eine Beute des Elendes oder ein Opfer der Verführung geworden ist. Alberti stimmte dieser Meinung bei und äußerte sich so, daß dadurch die Neugierde seiner beiden Freunde sehr gespannt wurde. „Die Bewohner unserer warmen Erdstriche,“ sagte er, „haben eine so lebendige, ungezügelte Phantasie, daß sie den verworrensten, wunderbarsten Und unwahrscheinlichsten Meinungen lieber Glauben beimessen, als den Aufklärungen, welche ein ruhiges Nachdenken, und der kalte Verstand giebt. Der ganze Auftritt, den wir erlebt haben, ist gewiß bloß durch eine sehr rührende, hier in Neapel allgemein bekannte Geschichte, nämlich die Geschichte von der weißen Frau, veranlaßt, die ich euch erzählen will.
Die weiße Frau
 in neapolitanischer Großer, den eine plötzliche Ungnade des Königs vom Hofe entfernt hatte, zog sich auf ein Schloß, unweit der Stadt, zurück. Hier vergaß er die eitlen Freuden der Welt und die Ungerechtigkeit der Menschen, die er so oft erfahren hatte und widmete die ganze Muße seiner Einsamkeit der Erziehung eines Sohnes, welcher der einzige Erbe eines berühmten Namens und eines großen Vermögens war. Der junge Mancini theilte anfangs seine Zeit unter ernste Studien und die Belustigungen des Landlebens; bald aber, als er in das Alter trat, wo die Phantasie lebendiger und das Blut wärmer wird, wo das Herz dem Verstande zuvor eilt, nahmen seine Ideen eine andere Richtung.
in neapolitanischer Großer, den eine plötzliche Ungnade des Königs vom Hofe entfernt hatte, zog sich auf ein Schloß, unweit der Stadt, zurück. Hier vergaß er die eitlen Freuden der Welt und die Ungerechtigkeit der Menschen, die er so oft erfahren hatte und widmete die ganze Muße seiner Einsamkeit der Erziehung eines Sohnes, welcher der einzige Erbe eines berühmten Namens und eines großen Vermögens war. Der junge Mancini theilte anfangs seine Zeit unter ernste Studien und die Belustigungen des Landlebens; bald aber, als er in das Alter trat, wo die Phantasie lebendiger und das Blut wärmer wird, wo das Herz dem Verstande zuvor eilt, nahmen seine Ideen eine andere Richtung.
Eine Sehnsucht nach Wechsel und Veränderung, die ihn zu beleben anfing, bewirkte, daß er jetzt die Jagd allen übrigen ruhigern Vergnügungen vorzog. Sobald es tagte, verließ er das Schloß, um die entlegensten Felder zu durchstreifen. Auf einer dieser Wanderungen traf er einst ein junges Mädchen von überraschender Schönheit. Maria war so einfach, von so zarter Frische und so blühend, wie eine ländlich geschmückte Schäferin im schönsten jungfräulichen Alter es nur seyn kann. Ihre Verlegenheit, das Stammeln ihrer Stimme, ihre Verwirrung bei Mancini’s Anblicke, alles dies gab ihr einen unwiderstehlichen Reiz, der ihre Schönheit noch übertraf und Mancini fühlte im ersten Augenblicke, daß er ohne sie nicht mehr würde leben können. Leicht erhielt er von der ländlichen Unschuld die Erlaubniß, täglich zu bestimmten Stunden wieder zu kommen und sie zu sehen.
Wie schnell entflohen dem feurigen Mancini diese seligen Stunden und mit welcher Ungeduld harrte er täglich dem Glockenschlage entgegen, der ihm die Zeit ankündigte, für welche er allein noch lebte. Fast ohne Widerstand gelang es ihm, dies sorglose, der Liebe geöffnete Herz zu verführen. Maria wurde Mutter und von diesem Augenblicke an war der Geliebte ihr Alles. Sie sah in ihm ihren ersten Freund und ihre letzte Zuflucht. Ach! die Unglückliche wußte nicht, daß von der Jungfrau, welche auch die letzten Forderungen der Liebe nicht unbefriedigt gelassen hat, das Glück in demselben Augenblicke entfliehet, wo es durch die festesten Bande an sie geknüpft scheint!“
„Mancinis Vater, durch die täglichen Wanderungen seines Sohnes beunruhigt, hatte seine Schritte verfolgen lassen und auf diesem Wege bald das Geheimniß seiner Liebe zu Maria entdeckt. Aufgebracht über eine Verbindung, welche mit seinen Wünschen wohl nicht übereinstimmen konnte, beeilte er sich, seinen Sohn aus der Einsamkeit zu reißen, die ihm so verderblich geworden war. Mancini kam nach Neapel und wurde hier so sorgfältig bewacht, daß es ihm anfangs wirklich unmöglich war, sich nur auf einen Tag zu entfernen, um das unglückliche Opfer seiner Verführung zu sehen. Dann umringte man ihn mit Festen und Zerstreuungen, und indem er begierig nach diesen für ihn ganz neuen Vergnügungen haschte, vergaß er die arme Maria; ja, kaum waren wenige Monate seit seiner Entfernung vom Schlosse verflossen, als er schon mit der Tochter des Herzogs Orlandi feierlich verlobt war.“
„Während der undankbare Mancini jetzt ganz seiner neuen Geliebten angehörte, seufzte die unglückliche Maria in der Einsamkeit. Obgleich sie sein Ausbleiben nicht erklären konnte, so war ihr Herz doch sehr bereitwillig, den Geliebten zu entschuldigen und erschöpfte alle Vermuthungen und Möglichkeiten, ehe es ihn schuldig glaubte. Endlich aber bemächtigte sich ihrer eine solche Unruhe, daß sie sich entschloß auf Mancini’s Schloß zu gehen, ohne indes zu sagen, was sie herführte. Mit Ungestüm klopfte sie an die Pforte. „Macht auf,“ rief sie, „ich bin eine verirrte Unglückliche!“ — Doch keine Antwort. Sie klopfte noch einmal und bat so dringend, so rührend; doch ihr Flehen verhalte in den Lüften und die Pforte blieb verschlossen. Nun war das Schloß in der That verödet, und verlassen, was sie nicht wissen konnte; indeß sie rief auch nicht mehr und kehrte weinend nach Hause zurück. Aber am folgenden Tage kam sie bei Einbruch er Nacht wieder, „Dies Mal,“ sagte sie, „soll er mich wohl hören; denn er schläft ja noch nicht! Ach, wie könnte er auch schlafen, wenn ich leide, wenn ich ihn bitte, ihn rufe! Nein, er wird, er muß mich hören!“ Nun ergriff sie ihre Guitarre und sang zu den melancholichen Tönen derselben ein Lied, welches sie von Mancini gelernt hatte.“
„Das Lied war zu Ende, die Guitarre schwieg, aber die Unglückliche harte und horchte vergebens. Die Thür blieb erschlossen und Niemand antwortete auf ihre Klagen. So war denn auch die letzte Hoffnung für sie verschwunden; mit voller Gewalt ergriff sie der Schmerz, so daß sie bewußtlos zur Erde sank. Die Guitarre fiel ihr aus der Hand und wurde auf einem Steine zerschellt. Das Geräusch, welches hierdurch hervorgebracht wurde, zog einen Fremden herbei, der seinen Wagen verlassen und den Weg neben dem Schlosse vorbei genommen hatte. Allein seine Hülfe war vergebens. Der seltsame Tod des jungen Mädchens machte allgemeines Aufsehen und kam auch Mancini zu Ohren, der den Zusammenhang leicht errieth und das Geheimniß entdeckte. Von aufrichtiger Reue bewegt eilte er zur Stadt hinaus und fand die unglückliche Maria todt unter einem Baume liegen. Umsonst benetzte er sie mit seinen Thränen, umsonst rief er sie mit den zärtlichsten Namen sie kehrte nicht ins Leben zurück und war auf ewig für ihn verloren.“
„Voll Verzweiflung über seine Schuld überließ er sich dem Troste seiner jungen Gemahlin. Emilie that alles, um ihn zu beruhigen und billigte besonders seinen Entschluß, das Schloß wieder zu beziehen, von welchem ihn sein Vater zu Maria’s Unglücke weggeführt hatte. „O Mancini“ sagte sie, „beweine Deine Freundin und liebe mich, wie Du sie geliebt hast! Laß Dein Kind zu uns kommen und wenn es auch unserer Liebe fremd ist; so werde ich doch gewiß ein Lächeln für dasselbe haben.“
„Seit dieser Zeit nun bewohnen sie das Schloß und man sagt, daß jährlich zu derselben Stunde, wo Maria starb, eine weiße Frau vor dem Schlosse erscheine. Sobald es zehn Uhr schlägt, hört man an das Thor klopfen; allein, obgleich man öfter Wachen ausgestellt hat, so haben diese doch nie die Erscheinung gesehen, wenn sie auch das Klopfen hörten. Es sind übrigens mancherlei Gerüchte über diese Begebenheit im Umlaufe. Einige behaupten Maria erkannt, Andere gehört zu haben, wie sie flehentlich um ihr Kind bäte; kurz, die Leichtgläubigkeit des Volkes hält die Geschichte für wahr, und gewiß ist dies die Ursache gewesen, warum man heute früh dem Schiffer Glauben beimaß und das junge Mädchen verfolgte. Dies ist aber die Erzählung von der weißen Frau, wie sie mir mitgetheilt ist.“
„Die Geschichte der Maria,“ sagte Aubrey, „erinnert mich an eine ähnliche Begebenheit, die in Mähren vorgefallen ist. Glaubwürdige Personen haben mir versichert, daß ein junges mährisches Mädchen nach ihrem Tode wiedergekommen sey, um ihren treulosen Geliebten zu verfolgen. Wenn man dieser Sage glauben darf, so wäre dies das erste Beispiel von einem weiblichen Vampyr“ — „Ach,“ unterbrach ihn Leonti, „wenn meine Bettina durch ein Wunder ins Leben zurückgekehrt wäre, so würde sie meine Schritte nur verfolgen, um mich zu beschützen, um sich mit mir wieder zu vereinigen und meine Qualen zu endigen.“
„Ich sehe wohl“, entgegnete ihm sein Freund, „daß die Scene, von der wir heute Zeugen gewesen sind, noch immer Eure Gedanken beschäftigt; laßt uns deshalb eilen, einen Ort zu verlassen, der irgend schmerzliche Erinnerungen in Euch erwecken kann. Morgen wollen wir nach Rom abreisen, wo die anziehendsten Gegenstände der Natur, wie der Kunst uns gewiß am ersten zerstreuen und unsern Kummer lindern werden.“
Am folgenden Tage verabschiedeten sie sich nun auch wirklich von Alberti, der sich vergebens bemühete, sie länger zurückzuhalten. Was oft selbst der Liebe nicht gelingt, das gelang Aubrey, indem er durch sein Zureden während der Reise seinen Freund wirklich tröstete. Man sprach damals zu Rom viel von einem jungen Araber, den ein unbekannter Unglücksfall aus seinem Vaterlande vertrieben hatte. Mit diesem wurden Leonti und Aubrey bekannt, indem der Zufall ihnen dasselbe Haus, wie Jenem, zur Wohnung anwies; und wie gleiche Gesinnungen oder eine gleiche Lage im Leben immer sehr leicht die Menschen zusammenführen, so kamen auch sie bald in eine Verbindung mit Nadur-Heli, die sich von Tage zu Tage fester knüpfte.
Nadur-Heli stand noch in der Blüthe seines Lebens und war von ausgezeichneter Schönheit; aber der Ernst, welcher in seinen Zügen ruhete, bestätigte die Bemerkung, welche seine neuen Freunde machten, daß ihn, wie sie, die Erinnerung eines großen Unglücks begleite. Bald aber wurden sie so vertraut, daß auch Nadur-Heli dies eingestand. Er erwähnte einer jungen Griechin und versprach, seinen Freunden die Geschichte seines Unglücks mitzutheilen; allein, es verstrichen mehrere Tage, ohne daß er sein Versprechen erfüllte.
Als sie eines Tages die großen Meisterwerke der Malerei betrachteten, bemerkten sie unter der Menge derer, welche zugegen waren, eine Römerin, deren glänzendes Aeußere einen hohen Rang ankündigte. Diese Dame hatte ihre Augen auf Nadur-Heli geheftet und wandte keinen Blick von ihm. Aubrey sah es mit Verwunderung; noch mehr aber erstaunte er darüber, daß sein Freund es ganz gleichgültig aufnahm und seine ganze Aufmerksamkeit auf die Gemälde richtete, welche die Gallerie schmückten. Indeß war die Zeit verstrichen und sie mußten sich entfernen. Auch die Unbekannte bestieg eine Sänfte und entfernte sich mit ihrem glänzenden Gefolge. Dieser Auftritt erweckte in Aubrey die Vermuthung, daß Nadur-Heli irgend ein Liebesabentheuer zu Rom habe; allein da dieser darüber schwieg, so wollte auch er des Vorfalls nicht erwähnen.
Als sie in der Kühle der Abendstunden an dem, mit erhabenen Denkmälern des Alterthums übersäeten, Ufer der Tiber sich ergingen und mit staunender Bewunderung auf diese, von den letzten Strahlen der untergehenden Sonne beleuchteten Ueberbleibsel einer längst vergangenen Zeit blickten, rief Nadur-Heli plötzlich, wie begeistert, aus: „O Cymodora! noch sehe ich Dich, wie Du mitten unter den Ruinen von Athen das Brausen der Meereswogen durch die Accorde Deiner Leyer begleitest!“ Er rief’s und hielt dann schnell, inne, erschrocken darüber, daß er mit dem Namen Cymodora auch sein Geheimniß verrathen hatte. Aber mit Herzlichkeit trat Aubrey zu ihm und bat ihn, sein Herz der Freundschaft zu öffnen. Nadur-Heli schien einen Augenblick unentschlossen, dann aber setzte er sich in der Mitte seiner Freunde nieder und wollte eben seine Erzählung beginnen, als er durch die Ankunft eines Boten unterbrochen wurde, welcher in diesem Augenblicke erschien, dem Nadur-Heli einen Brief übergab und sich sogleich wieder stillschweigend entfernte.
„Ich muß euch von meiner Lage unterrichten,“ sagte Nadur-Heli, „die in der That seltsam ist. Ihr seyd besser als ich mit den Sitten des Landes bekannt und werdet mir vielleicht einen guten Rath geben können, den ich gern blindlings befolgen will; aber vor allen Dingen muß ich euch von dem benachrichtigen, was dem heutigen Ereignisse vorangegangen ist. Ich gehöre einer der berühmtesten Familien meines Vaterlandes an, und nur ein sehr großes Unglück konnte mich aus dem mir ewig theuren Vaterlande entfernen. Zu Rom angekommen, ward es mir unmöglich, mich allen Gesellschaften zu entziehen; ich war gezwungen, einigen Festen beizuwohnen, von denen mein Kummer mich hätte entfernen sollen. In einer dieser Gesellschaften war ich besonders der Gegenstand der allgemeinen Neugierde, und vorzüglich bewies mir eine angesehene Dame in der Gesellschaft eine sehr schmeichelhafte Aufmerksamkeit. Der Zufall hatte mir einen Platz neben ihr angewiesen; meine Traurigkeit interessirte sie und sie fing deshalb an, mich über mein Unglück zu befragen. Ich war nicht unempfindlich gegen die Beweise ihres Wohlwollens; allein ich vermied es, ihr Geheimnisse mitzuteilen, die ich verschweigen mußte. Ehe ich von ihr schied, nannte sie mir ihre Wohnung und nahm mir das Versprechen ab, daß sie mich wiedersehen sollte. Ich zog mich früher als alle Uebrigen von dem geräuschvollen Orte zurück, wo ich ihre Bekanntschaft gemacht hatte; da hielt mich ein Mensch an und in einer Wuth, deren Grund ich zu spät erfuhr, zwang er mich, mein Leben zu verteidigen. Ich blieb in diesem unglücklichen Kampfe Sieger und mein Feind gestand mir, in meinen Armen sterbend, daß er der Geliebte der Herzogin von A... sey.“
„Dieser Vorfall bestärkte mich noch mehr in dem schon gefaßten Entschlusse, die schöne Römerin nicht wieder zu sehen. Der Tod ihres Geliebten machte großes Aufsehen in der Stadt; seine mächtige Familie wollte ihn rächen, aber man kannte weder die Hand, die ihn getödtet hatte, noch die nähern Umstände seines Todes, die ich sorgfältig verheimlichte. Die geringste Unvorsichtigkeit hätte mich unfehlbar ins Verderben gestürzt; um deshalb meine Sicherheit nicht zu gefährden und den Verdacht meiner Feinde nicht auf mich zu ziehen, lebte ich seit dieser Zeit ganz im Verborgenen, ohne mich irgend Jemanden anzuvertrauen.“
„Ich hörte, das die Eltern des Gebliebenen ihre Nachforschungen immer noch fortsetzten; die Herzogin indeß, welche doch höchst wahrscheinlich den Mörder errathen hatte, weit entfernt, mich verdächtig zu machen, gab mir im Gegentheile noch fortwährend Beweise einer sehr lebhaften Theilnahme. Ich sehe den Grund davon nicht ein und ich weiß überhaupt nicht, was ich von alledem, was sich mit mir zuträgt, denken soll. Noch gestern, als wir die Gemälde bewunderten, war sie wieder ganz in meiner Nähe.“
Nadur-Heli erbrach darauf den Brief und Aubrey las ihn. Der junge Fremde wurde darin gebeten, sich Nachts um ein Uhr an einen bestimmten Ort zu begeben, von wo ein vertrauter Diener ihn in den Palast führen würde, wo man ihn erwarte.
Die Freunde geriethen über diesen Brief in Streit; Aubrey und Leonti nämlich behaupteten, daß dies Stelldichein, dessen Zweck gar nicht angegeben war, ein verabredeter Plan von Nadur-Heli’s Feinden sey, um diesen in ihre Schlingen zu locken. „Immerhin!“ sagte dieser, „wenn man mein Leben angreifen will, so werde ich es auch gegen die Waffen feiler Mörder zu vertheidigen wissen.“ —
„Freund,“ erwiederte ihm Aubrey, „folgt unserm Rathe und laßt uns mit Vorsicht Euren Feinden entgegen gehen. Ich werde mich diese Nacht statt Eurer an dem bezeichneten Platze einfinden.“ — „Nein,“ sagte Leonti, „ich werde es statt Eurer übernehmen, denn ich bin mit der Landessprache bekannt und kann also der Bosheit Eurer Feinde am leichtesten zuvorkommen.“ — „Ich kann es unmöglich zugeben, daß ihr euch Gefahren aussetzt, die mir bereitet sind.“ entgegnete Nadur-Heli und da er hiebei beharrte, so forderte Aubrey wenigstens die Erlaubnis von ihm, daß er ihn begleiten dürfe. Heimlich aber kam er dann mit Leonti überein, daß dieser früher, als sie, an dem bezeichneten Orte sich einfinden und dem Abentheuer entgegen gehen sollte. Dieser Verabredung gemäß geschah es. Leonti ging allein, aber bewaffnet, an den bestimmten Ort und als die festgesetzte Stunde schlug, erschien ein Sclav und nannte Nadur-Helis Namen. Hierauf ergriff Leonti seine Hand und indem sein Führer eine geheime Thür öffnete, führte er ihn in einen großen Garten.
Leonti ging nun in einem dichten Gehölze vorwärts; da hörte er leise Tritte und blieb stehen und eine zarte weibliche Hand ergriff die seinige und drückte sie mit Innigkeit. Schon machte sich Leonti-Vorwürfe darüber, seinen Freund eines Glückes beraubt zu haben, an welchem sein Herz doch keinen Theil nehmen konnte. Er folgte der Dame, die ihn führte, in eine dichte Laube. „O Du,“ sagte eine leidenschaftlich bewegte Stimme, „Du, den meine Blicke ausgezeichnet haben, den mein Herz gewählt hat, sag mir, ob das Deinige die Gefühle theilt, die ich seit dem ersten Augenblicke für Dich empfunden habe; sprich nur ein Wort und ich fliege in Deine Arme!“
Leonti war in der größten Verlegenheit und wußte nicht, was er hierauf erwiedern sollte. Da ließ sich ganz in der Nähe ein leises Rauschen, wie von Gewändern, hören und erschreckt drückte sich die unbekannte Schöne nun fest an Leonti und verschloß ihm, zum Zeichen des Schweigens, mit ihrer Hand den Mund. Sie selbst wagte kaum zu athmen; und noch einmal rauschte es und deutlicher unterschied man die Tritte in dem trockenen Laube, so daß nun kein Zweifel mehr übrig war, daß sich Jemand nähere. Jetzt aber rief ganz nahe bei dem gespannten Paare eine zarte Stimme: „Leonti, Leonti! Kannst Du deine Bettina vergessen?“ —
„Großer Gott!“ rief Leonti außer sich, „was höre ich? Das war ihre Stimme! Sie ist es! Bettina, theure Bettina, wo bist Du?“ — Durch dies unvorsichtige Rufen aber wurde man im Schlosse aufmerksam. Der Garten wurde lebendig, man näherte sich mit Fackeln und Leonti, der plötzlich ganz allein war, wußte nicht, wohin er fliehen sollte. Er suchte, den Weg auf welchem er hereingekommen war und hatte schon die verborgene Thür gefunden, als die bewaffneten Diener aus dem Schlosse ihn erreichten und über ihn herfielen. Er vertheidigte sich wüthend gegen die Uebermacht, da kamen Aubrey und Nadur-Heli ihm zu Hülfe und die drei Freunde entkamen nun glücklich nach ihrer Wohnung, nachdem zwei ihrer Gegner in dem Kampfe das Leben verloren hatten.
Jetzt aber war ihre Lage wirklich bedenklich, denn von der Rache der getäuschten Herzogin mußten sie alles fürchten. Sie vertraueten sich deshalb ihrem Wirthe, einem zuverlässigen Manne an und stimmten ihm vollkommen bei, als er zur schleunigen Flucht aus Rom rieth. Noch bedeckte die Nacht Roms Gefilde, als sie schon auf dem Wege nach Modena waren. Ein Bote brachte sie auf das Land zu einem Freunde ihres römischen Wirthes und hier in der Verborgenheit ruheten sie aus, bis Leonti’s Wunde, die man anfangs nicht bemerkt hatte, geheilt seyn würde.
Dies gemeinschaftlich bestandene Abentheuer hatte indeß die Bande der Freundschaft noch fester unter ihnen geknüpft und Leonti allein schien eine schmerzliche Erinnerung daran zu bewahren. Aubrey erhielt von ihm leicht das Geständniß seiner neuen Unruhe, Bettina’s Erscheinen kam ihm nicht aus dem Sinne; Tag und Nacht dachte er nur an sie und nichts konnte ihm den Gedanken rauben, daß Bettina noch lebe; allein je mehr er hierüber nachdachte, desto undurchdringlicher wurde ihm das Geheimniß. Endlich, um seine Zweifel zu lösen, bat er Aubrey, ihm die Geschichte der jungen Mährin zu erzählen, die nach ihrem Tode wiedergekommen sey und ihren Geliebten überall begleitet habe. — „Beruhigt Euch, theurer Leonti,“ sagte Aubrey; „ich habe jene Erzählung aufgeschrieben und will sie euch mittheilen,“
Geschichte der jungen Mährin
 en ersten Rang unter dem mährischen Adel behauptete die Familie der Fürsten von Alberg, welche jetzt noch aus zwei Brüdern und ihrer Schwester, einer durch Schönheit und Liebreiz gleich ausgezeichneten Prinzessin, bestand. Während ihre Brüder nach Ruhm strebten und im Kriege Gefahren und große Thaten suchten, lebte Elzina einsam auf dem Schlosse ihrer Ahnen. Seit einiger Zeit jedoch waren auch die beiden Brüder hieher zurückgekehrt und suchten durch Feste und glänzende Gelage, zu welchen sie die Edelsten aus der Ritterschaft versammelten, die Langweile einer ihnen unerträglichen Ruhe zu vertreiben, bis aufs neue der sehnlichst erwartete Aufruf sie ins Feld führen würde. Elzina dagegen war diesen Festen höchst abhold und suchte die Einsamkeit. Da, von den Huldigungen, welche sie als Dame des Hauses erfuhr, erlöst und allein in der Gesellschaft ihrer Herzensfreundin Athalise, überließ sie sich ganz den Gefühlen ihres Herzens und vergoß sie Thränen, welche sie vor dem argwöhnischen Stolze ihrer Brüder verbergen mußte.“
en ersten Rang unter dem mährischen Adel behauptete die Familie der Fürsten von Alberg, welche jetzt noch aus zwei Brüdern und ihrer Schwester, einer durch Schönheit und Liebreiz gleich ausgezeichneten Prinzessin, bestand. Während ihre Brüder nach Ruhm strebten und im Kriege Gefahren und große Thaten suchten, lebte Elzina einsam auf dem Schlosse ihrer Ahnen. Seit einiger Zeit jedoch waren auch die beiden Brüder hieher zurückgekehrt und suchten durch Feste und glänzende Gelage, zu welchen sie die Edelsten aus der Ritterschaft versammelten, die Langweile einer ihnen unerträglichen Ruhe zu vertreiben, bis aufs neue der sehnlichst erwartete Aufruf sie ins Feld führen würde. Elzina dagegen war diesen Festen höchst abhold und suchte die Einsamkeit. Da, von den Huldigungen, welche sie als Dame des Hauses erfuhr, erlöst und allein in der Gesellschaft ihrer Herzensfreundin Athalise, überließ sie sich ganz den Gefühlen ihres Herzens und vergoß sie Thränen, welche sie vor dem argwöhnischen Stolze ihrer Brüder verbergen mußte.“
„Bald aber brach von neuem der Krieg aus und indem auch Elzinens Brüder daran Theil nehmen wollten, sagten sie ihr beim Abschiede: „Es ist Deine Pflicht eben sowohl, Schwester, als die unsrige, den Ruhm unsres Hauses zu erhalten; lebe deshalb, während unserer Abwesenheit, ganz abgeschieden, damit auch nicht einmal die Möglichkeit existiren kann, Deinen Ruf anzugreifen. Wenn das Geschick unsern Waffen günstig ist, so sollst Du sehen, daß unsere Bruderliebe für alles gesorgt hat, was zu Deinem Glücke und zu Deiner Zufriedenheit dienen kann. Adieu, theure Schwester“ — „Adieu,“ wiederholte leise ein junger Ritter aus ihrem Gefolge, „adieu, Elzina! Sey unserer stillen Liebe eingedenk“. Sie entfernten sich und Elzina sank, vom Schmerze überwältigt, in die Arme ihrer theuren Athalise.“
„Auf ihrem Zimmer wollte Elzina sich den Augen Aller entziehen und nur Athalise durfte bei ihr bleiben. Hier ließ sie ihren Thränen freien Lauf und benetzte durch sie ihr Lager und den Busen ihrer Freundin, welche mit ihr weinte, sie tröstete und sie mit den zärtlichsten Liebkosungen überhäufte, um ihr Herz zu beruhigen. Allein alles war vergebens; Elzinens Zustand wurde fieberhaft und wirklich bedenklich. So waren mehrere Wochen verstrichen und ein entscheidender Augenblick stand der Leidenden noch bevor, Athalise, die ihrer Freundin alles gewesen war, half ihr auch hier eine Gefahr überstehen, deren langsame Annäherung das Schreckliche derselben vermehrt hatte. Die Mitternachtsstunde schlug. Der Flügel des Schlosses, auf welchem ihr Zimmer lag, war unbewohnt und die Nacht begünstigte ein kühnes Unternehmen. Athalise verließ deshalb unbemerkt das Schloß und obgleich sie zitterte, in der Dunkelheit der Nacht so ganz im zu gehen, so ermuthigte sie doch der Gedanke, daß ihre heimliche Entfernung vielleicht die Freundin retten könne. So ist das weibliche Herz, zu schwach für seine eigenen Leiden, von himmlischem Muthe, von hingehender Aufopferung beseelt, wenn es denen dienen kann, die es liebt.“
„Am Morgen nach dieser Nacht war Athalise noch immer nicht auf dem Schlosse zurück. Mit Ungeduld und großer Unruhe zählte Elzina die Stunden, ja die Augenblicke; denn das ganze Glück ihres Lebens, vielleicht dies Leben selbst hing von dem Geheimnisse jenes Unternehmens ihrer Freundin ab, das nothwendig verheimlicht werden mußte und doch durch eine Kleinigkeit verrathen werden konnte. Endlich hörte sie Jemanden sich mit raschen Schritten ihrem Zimmer nähern; die Thür öffnete sich und Athalise trat herein. Ihr ruhiger Blick, ihr sanftes Lächeln verhießen eine fröhliche Botschaft. Ihr Zweck war erreicht und Elzina nahm sie in ihre Arme und bezeigte dem Herzen ihrer Freundin durch ihr Stillschweigen ihren Dank.“
„Mehrere Monate waren indeß verflossen und Elzina beklagte sich, noch immer keine Nachricht vom Heere erhalten zu haben, als eines Tages ein Eilbote auf dem Schlosse erschien und ihr einen Brief zustellte. „Eilt zu Elzinens Brüdern zurück,“ sagte Athalise zu dem Boten, „und sagt ihnen, daß ihr langes Schweigen und die Gefahren des Krieges Elzinen sehr besorgt gemacht haben und daß nur die schleunige Rückkehr ihrer Brüder sie wieder wird beruhigen können.“
„Der Bote entfernte sich, Elzina öffnete den Brief und las:
„Theure Elzina!
Der Sieg hat unsere Waffen gekrönt und obgleich wir Krieger verloren haben, die uns sehr theuer waren; so sind unsere Thaten doch durch einen ruhmvollen Frieden belohnt. Morgen werden wir auf dem Schlosse bei Dir anlangen und mit uns wird der Gouverneur von Mähren kommen, der Deine Bekanntschaft zu machen wünscht. Bereite alles, ihn so zu empfangen, wie die Ehre, welche er uns erzeiget, es erheischt. Bis morgen lebe wohl
Erich von Alberg“
„Hast Du es wohl gehört, Athalise, was mein Bruder schreibt: Wir haben Krieger verloren, die uns sehr theuer waren. Da, lies selbst, ich kann nicht mehr.“ — „Ermanne Dich“ erwiederte Athalise, „der Krieg raubt die Krieger; aber deshalb verschont das Schicksal doch wohl ein Leben, an welchem noch ein zweites Leben hängt; beruhige Dich und quäle Dich nicht im voraus durch Kummer und Sorgen.“ — „Ach, wie werde ich meinen Schmerz vor den Augen meiner Brüder verbergen können?“ — „Das wirst Du müssen, darum fasse Muth.“ — „Und was wird der Prinz Adalbert hier wollen?“ — „Er wünscht Dich zu sehen.“ — „Mich zu sehen? Wozu? Ach, Athalise, ich weiß nicht, wie es zugeht, aber alles ängstigt mich und macht mich besorgt.“
„Am folgenden Tage wurde es auf dem Schlosse sehr lebendig. Noch früher, als der Gouverneur, kam eine Menge seiner Ritter an. Elzina hatte alle ihre Kräfte zusammengenommen, um ihren Schmerz vor ihren Brüdern zu verbergen, die jetzt auch anlangten und in ihre Arme eilten. Aber umsonst blickten ihre Augen in dem Kreise der Männer umher; der Ritter, nach welchem ihr Herz sich sehnte, war nicht zu finden. „Lieber Bruder,“ sagte sie endlich zu Erich, „ich war sehr besorgt für Dein Leben. Ihr habt gesiegt und dafür danke ich dem Himmel; aber wenn es wahr ist, was Du mir schriebst, so hat Deine Freundschaft diesen Sieg heuer bezahlen müssen.“ — „Ja, liebe Schwester,“ erwiederte Alberg, „der Sieg kostet oft den Siegern mehr Thränen, als den Besiegten.“ —
„Was ist denn aus Ferdinand, Deinem steten Waffengefährten, geworden? ... Ach! — Er hatte Dir einst in der Schlacht das Leben gerettet.“ — „Er war mein treuester Freund und dennoch kann ich ihn jetzt nur noch beweinen!“ — „Er ist todt?“ fragte Elzina zitternd, indem sie sich auf ihre Freundin stützte. — „Er ist ruhmvoll gestorben und Dein Name war das letzte Wort, das seine Lippen bewegte — so sehr war er unserm Hause ergeben.“ — „Ferdinand ist nicht mehr“, wiederholte Elzina seufzend. „Das ist das Loos des Kriegers“ sagte Alberg,“
„In diesem Augenblicke trat der Gouverneur ins Zimmer. „Liebe Schwester,“ rief Erich, „da ist der Prinz Adalbert!“ und zu diesem sich wendend, sagte er: „Entschuldigen Sie meine Schwester; die Sorge um ihre Brüder hat sie sehr angegriffen, obgleich sie durch diesen Beweis ihrer Zärtlichkeit uns nur noch werther geworden ist.“ — „Und noch schöner“ sagte Adalbert, indem er Elzinen betrachtete.“
„Elzina zog sich in ihr Zimmer zurück, da selbst ihre Brüder, durch die Blässe der Schwester beunruhigt, verlangten, daß sie sich dem ermüdenden Feste entziehen möchte. Der Gouverneur sah mit Bedauern, daß sie sich entfernte und er sprach dies mit einer so zärtlichen Theilnahme aus, daß Elzina sehr verlegen darüber wurde. Und nicht ohne Grund war sie deshalb besorgt; denn ihre Brüder dachten schon seit längerer Zeit daran, ihr einen Gemahl zu geben, welcher der Schwester und ihres eigenen Ehrgeizes würdig wäre, und der Besuch des Prinzen, ihres Freundes, hatte keinen andern Zweck, als diesen Wunsch der Brüder zu erfüllen.“
„Adalbert hatte oft Elzinens Schönheit loben hören; aber als er die Holde selbst sah, fand er, daß der Ruf noch verkleinert habe und noch an demselben Tage erklärte er seinen beiden Freunden, daß er ihre Schwester zur Gemahlin zu haben wünsche. Diese gaben ihm gern ihr Wort und benachrichtigten ihre Schwester davon, damit sie sich zu einer Verbindung anschicke, welche allen ihren Wünschen entsprach. Was sollte Elzina den ehrgeizigen Brüdern erwiedern? Wie sollte sie sich dem Begehren derselben widersetzen? Womit konnte sie ihren Widerstand entschuldigen? — Gehorsam war das einzige, was ihr übrig blieb und die Brust voll Seufzer, die Augen mit Thränen gefüllt, trat sie an den Altar, um ein Herz zu verschenken, für welches kein Glück mehr blühete.“
„Aber ihre Betrübniß an einem Tage, wo sie sich ganz der Freude hätte hingeben sollen, beunruhigte Adalberts Liebe und im Begriff, sie zu seiner Residenz nach Olmütz zu führen, verschwendete er die größte Zärtlichkeit, um die Traurigkeit seiner jungen Gemahlin zu verscheuchen, welche er als eine Folge der Zurückgezogenheit ansah, in der Elzina erzogen war. Seine Sorgfalt mißlang auch nicht ganz und sein Glück wurde noch erhöhet, als Elzina ihm einen Sohn schenkte, den man Oscar nannte.“
„Athalise war ihrer Freundin gefolgt; aber umsonst bat Adalbert sie, an seinem Hofe zu leben. Sie konnte sich nicht entschließen, eine einsame Wohnung zu verlassen, welche sie in der Nähe der Stadt bezogen hatte und welche Elzinens Freundschaft täglich verschönerte. Hier lebte sie glücklich und widmete sich ganz der Erziehung der jungen Thelemy, die sie auch stets begleitete, wenn sie ihre Freundin besuchte. Thelemy war fast von gleichem Alter mit Oscar, ihrem einzigen Gespielen, und indem Beide die Jahre der sich selbst noch unbewußten Kindheit zusammen verlebten, gelangte Thelemy zu dem Zeitpunkte unsers Lebens, wo sich alles in unsern Augen plötzlich verschönert. Auch an ihr weckte jeder neue Frühling neue Reize und neue Gefühle und die unbefangene, kindliche Freundschaft, welche sie bis dahin mit Oscar vereinigt hatte, wurde von Tage zu Tage ein zärtlicheres Gefühl; aber mit dem Bewußtseyn dieses Gefühls, erwachte in ihr auch die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit, dasselbe zu verbergen.“
„Oscar, der jetzt furchtsamer in Thelemy’s Nähe war, konnte sich seine Verwirrung nicht erklären. Beide waren befangener und zurückhaltender, als sonst. Wenn sie einander nicht sahen, so dachten sie auf tausend Dinge, die sie sich fragen wollten und -kamen sie dann zusammen, so wagten sie kaum zu sprechen. Doch nur zu bald lernte Oscar den Grund hiervon kennen; nur zu bald kam auch er zum Bewußtseyn seiner Gefühle.“
„Athalise indeß, welche schon seit einiger Zeit unwohl gewesen war, wurde jetzt so krank, daß sie ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Elzina besuchte sie oft, um die geliebte Freundin zu trösten und aufzuheitern; Oscar dagegen sah die theure Thelemy nun gar nicht mehr, bis er seiner Unruhe hierüber nicht mehr widerstehen konnte und sich von seiner Mutter die Erlaubniß erbat, selbst nach Athalisens Wohnung gehen zu dürfen.“
„Hier fand er endlich Thelemy wieder, die eben beschäftigt war, eine Schärpe zu sticken. Verwundert über Oscars unerwartetes Erscheinen, gerieth sie in sichtbare Verwirrung, und diese Verwirrung, welche doch das sicherste Zeichen ihrer Liebe war, weckte in Oscars Brust einen Verdacht, den er nicht laut werden zu lassen wagte, den aber seine Blicke deutlich genug verriethen.
„Ich störe Dich,“ sagte er nach einiger Zeit, „das sehe ich wohl; es ist wahr, ich bin unbescheiden!“ — „Wie so?“ erwiederte Thelemy. — „Du bist so eifrig beschäftigt, die Schärpe zu vollenden, die gewiß für einen edlen Ritter bestimmt ist.“ — „Ja, Oscar, sie ist für einen edlen Ritter bestimmt.“ — „Der Dich liebt?“ — „Ich glaube es.“ — „Und Du liebst ihn wieder?“ — Hierauf konnte Thelemy nur mit einem Seufzer antworten, — „Ach,“ sagte Oscar mir einer zornigen Bewegung, „wenn ich wüßte! ...“ — „Halten Sie ein, Prinz und beleidigen Sie ihre Freundin nicht durch eine Eifersucht, die unserer Beider unwürdig ist.“ — „Ach, Thelemy, verzeihe mir! Ich fürchtete, daß Du mich nicht mehr liebtest.“— „Vergißt man je wohl seinen ersten Freund?“ — „Aber wird die Freundschaft hinreichen, um meine Gefühle zu befriedigen? Theure Thelemy“ — „Geliebter Oscar“
„Thelemy,“ fuhr Oscar fort, „ich muß noch in dieser Nacht, auf Befehl meines Vaters, zur Armee abreisen.“ — „O Gott, zur Armee! Du willst also Dein mir so theures Leben in so große Gefahr sehen!“ — „Sorge nicht; denn in drei Tagen werde ich schon wieder zurück seyn“ — „Gewiß?“ — „Wahrhaftig!“ — „Nun, so nimm diese Schärpe, die ich für Dich gearbeitet habe. Sie sey Dein Schmuck. Hier, in dieser Falte steht der Name des Ritters, dem ich sie bestimmt hatte; da, lies: „Für Oscar.“ —
Oscar wollte sie in seiner Freude umarmen, aber Thelemy entzog sich ihm und sagte weggehend: „Vergiß Thelemy nicht!“ — „Ich,“ erwiederte Oscar, „ich Dich vergessen? Nie, nie!“
„Stolz darauf, diese Schärpe zu tragen, besuchte Oscar, als er schon die Befehle seines Vaters vernommen hatte und vollkommen zur Abreise gerüstet war, noch einmal alle die Orte, welche seiner Jugend und seiner Liebe so theuer waren und dann erst begab er sich auf den Weg zur Armee, aber auch jetzt schon von dem Gedanken der Rückkehr erfüllt.“
„Athalise indeß wurde nicht besser. Thelemy begab sich auf das Schloß, weil Elzina mit ihr reden wollte; langsam ging sie durch die weiten Gärten, die sonst der Schauplatz ihrer Spiele mit Oscar gewesen waren und jetzt ganz verödet schienen. Da trat sie zu dem Baume, in dessen Schatten sie so oft mit dem Geliebten geruhet hatte, und siehe! von diesem flatterte ihr ein Papier entgegen, welches das zärtlichste Geständniß von Oscars Liebe enthielt.“
„Tausend Mal las sie das Billet, welches alles enthielt, was Oscar noch nicht gewagt hatte, ihr mündlich zu sagen und freudig lächelte ihr Antlitz, als sie zu Elzinen kam. „Du bringst mir gewiß eine frohe Botschaft,“ sagte diese. — „Ach, leider nicht!“ erwiederte Thelemy erröthend. „Aber so oft ich diesen Pallast betrete, wo ich die schönsten Tage meines Lebens verlebt habe, kann ich ein lebendiges Gefühl der Freude nicht unterdrücken, welches von selbst in mir erwacht. Jeder Gegenstand erinnert mich an etwas Angenehmes; hier gefällt mir Alles; hier liebe ich Alles, selbst die Luft, die ich einathme.“ —
„Fahre fort, liebe Thelemy, ich höre Dich gern. Aber sage mir, fühlst Du, unter allen den reizenden Gegenständen, die Dich hier umgeben, bei der Erinnerung an schöne Stunden, welche hier in Dir erweckt wird, gar nichts, was Dich zu mir hinzöge?“ — „Ich bin Athalisens Tochter und Sie sind die Freundin meiner Mutter, wie könnte ich daher anders als die aufrichtigste Verehrung und wärmste Dankbarkeit für Sie empfinden!“ — „Mehr also nicht?“ — „Mehr kann ich nur für meine Mutter fühlen.“ — „Für Deine Mutter, Thelemy und für mich?“ — „Ich kann Sie unmöglich eben so sehr lieben, als meine Mutter.“ — „Halt ein, Thelemy, Du thust mir wehe!“ „Verzeihen Sie ...“ — „Liebe Tochter,“ fuhr Elzina bewegt fort, „Du hast also Athalisen sehr lieb?“ —
„Wer sollte seine Mutter nicht lieben? Die Mutter giebt uns das Leben, bewacht unsere ersten Schritte, trocknet unsere ersten Thränen, freuet sich mehr über unser, als über ihr eigenes Wohl! Ihre Liebe verläßt uns nie, begleitet uns überall. — Mein Gott, was fehlt Ihnen, Sie werden blaß und weinen?“ — „Nichts, liebe Thelemy; fahre nur fort, ich höre Dich gern. Ach, ich liebe Dich auch und gewiß mehr noch, als ich es Dir sagen kann. Aber Athalise?“ — „Ach, ihr Zustand beunruhigt mich sehr!“ — „Der Himmel verhüte ein solches Unglück, aber wenn Du sie dennoch verlörest?“ — „O, wecken Sie in mir keine solche Furcht.“ — „Wenn sie sich aber von Dir entfernte?“ — „Sie sich von mir trennen. Das wird sie nicht, das kann sie nicht; ich würde ihr überall folgen. Eine Mutter kann ja ihr Kind nicht verlassen!“ —
„Grausame Thelemy entgegnete Elzina, Du weißt nicht, und wirst es vielleicht nie erfahren, wie wehe Du meinem Herzen thust. Aber oft wird eine Mutter gezwungen, sich von ihrem Kinde zu trennen. Es giebt im Leben schreckliche Lagen, die Dir noch fremd sind. Eine Mutter scheint oft ihr Kind zu verlassen, während sie ihre Thränen verbirgt, ihre Seufzer unterdrückt und ein Opfer der harten Pflicht, muß sie, selbst wenn die Tochter neben ihr steht, wenn alle ihre Gefühle erwachen und sie das geliebte Kind so gern umarmen möchte, selbst das leiseste Lächeln unterdrücken und eine Gleichgültigkeit heucheln, die sie nicht fühlen kann. Liebe Thelemy, beweine, beklage eine Mutter, die in dieser grausamen Lage ist. Zwar ist sie schuldig, aber doch noch mehr unglücklich. Sie seufzt und schmachtet umsonst; sie ist für das Leben abgestorben. Ach, liebe Tochter ...“ —
„Sie haben viel Kummer, gnädige Frau, ich weiß zwar die Ursache nicht; allein ich sehe es an ihren Thränen, daß Sie zu beklagen sind.“ — „Ja wohl bin ich sehr zu beklagen; doch Dein Mitleid tröstet mich.“ — „Das soll Sie immer trösten.“ — „Immer?“ — „Ja, wenigstens hoffe ich es. Wenn Sie wollten, wenn Sie auch an mir Mutterstelle vertreten, meine zweite Mutter seyn könnten!“ — „Rede, was willst Du sagen!“ — „Ich liebe Oscar.“ — „Ich weiß es, die Freundschaft hat euch von Jugend auf vereinigt.“ — „Nein, es ist mehr als Freundschaft; Oscar und ich fühlen wahre Liebe für einander.“ — „Unglückliche!“ — „Großer Gott! Sie erschrecken mich, gnädige Frau. Hören Sie mich an, ich bin nicht schuldig. Oscar hat es so gewollt und ich liebe ihn, so sehr, als mein Herz es nur kann. Meine Wünsche sind die seinigen und wenn ich seine Geliebte bleiben und einst seine Gattin werden dürfte ...“ — „Du Oscars Gattin! Unmöglich! Niemals, nie!“ — „Ach, ich weiß leider wohl, Oscar ist ein Prinz und seine Mutter herrscht, während die meinige nur von ihren Wohlthaten lebt ...“ —
„Verlaß mich jetzt, Thelemy, ich muß allein seyn. Das Geheimniß, welches Du mir entdeckt hast, bleibe unter uns; aber entsage Deiner Liebe und komm nicht wieder hieher. Einst sollst Du den Grund von allem erfahren. Sey nicht traurig darüber, denn glaube mir, es muß so seyn, Umarme mich, meine Tochter, und kehre zu Athalisen zurück, dort werde ich Dich wieder sehen und Dich trösten. Leb wohl, leb wohl!“ Die Thränen unterbrachen die unglückliche Mutter; sie drückte Thelemy fest an ihren Busen und gab ihr dann ein Zeichen, sich zu entfernen. „Wie unglücklich bin ich! Erbarme Dich, Gott, erbarme Dich meiner!“ rief sie, während Thelemy sich, bestürzt und verwirrt, weinend entfernte.“
„Aber schon war Oscar von seiner Reise zurück; schon durcheilte er mit raschen Schritten den Garten, der ihn nur noch von seinem väterlichen Schlosse trennte, als er hier auf Thelemy stieß. — „Halt,“ sagte er, „warum diese Thränen? Warum fließen sie heftiger in meiner Nähe? Du antwortest mir nicht? Sprich, eile, rede!“ — „Oscar, wir sehen uns zum letzten Male!“ — „Welche Sprache!“ — „Deine Mutter ...“ — „Nun!“ — „verbietet mir, Dich zu lieben. Unsere Verbindung ist unmöglich; der Abstand zwischen Deinem und meinem Stande ist zu groß.“ — „Verscheuche Deine Furcht und baue auf mein Wort. Ich werde sehen, ich will mit meiner Mutter reden und sie gewiß umstimmen; sie wird meinen Bitten gewiß nicht widerstehen können. Sie wird auf das Flehen eines Sohnes, den sie liebt, und eines Liebenden, der Dich anbetet, hören und uns gewiß vereinigen, Siehst Du sie dort am Fenster? Sieh, wie zärtlich ihr Auge auf uns ruhet. Mit liebevollen Blicken betrachtet sie uns; sie weint, sie erkennt mich; sie ruft meinen Namen. Komm, Thelemy, wir wollen uns ihr zu Füßen werfen!“
„Er sprach’s und riß Thelemy, trotz ihres Widerstandes, gewaltsam mit sich fort. „O, beste Mutter,“ rief er, indem er sich zu Elzinens Füßen warf, „sieh, dies ist die Gespielin meiner Kindheit, die Gefährtin meines ganzen Lebens und die Gattin, welche mein Herz gewählt hat. Willige in unser Glück.“ — „Oscar, bester Sohn laß von diesen Bitten ab.“ — „Verbinde uns auf ewig!“ — „Es kann nicht seyn, nie dürft ihr zusammen verbunden werden!“ — „Wohlan! so fürchte die Folgen meiner Verzweiflung. Noch eine Weigerung und ich nehme mir das Leben!“ — „Halt ein, Oscar! Vernimm das unübersteigliche Hinderniß, was Deinen Wünschen im Wege steht; aber erschrick, denn Du zwingst mich zu einem fürchterlichen Geständnisse. Thelemy ist Deine Schwester!“ — „Ich bin Oscars Schwester?“ — „Ich Thelemy’s Bruder?“ — „Ja, ihr seyd Beide meine Kinder. Ich habe mein Geheimniß euch anvertrauet, weil ich es mußte, um ein abscheuliches Verbrechen zu verhüten, aber bewahrt es wohl denn mein Leben, wie das eurige, hängt davon ab, daß ihr es verschweigt. Athalise, meine großmüthige Freundin, ist die einzige ... Doch, wer ist da im Nebenzimmer? ... O Himmel! mein Gemahl. Nun ist Alles verloren!“
„Wachen,“ rief der Gouverneur, „bringt dies junge Mädchen fort und Ihr, Harald, bewacht meinen Sohn auf seinem Zimmer. Mit Eurem Leben bürgt Ihr für ihn!“ — „Wachen“ rief Oscar, „schont die junge Dame, oder fürchtet meinen Zorn!“
„Elzina wurde bewußtlos auf ihr Bett gelegt und Adalbert entfernte sich. Von der Ankunft seines Sohnes unterrichtet, war er gekommen, ihn aufzusuchen, als er durch das lebhafte Gespräch in Elzinens Zimmer bewogen wurde, demselben im Nebenzimmer zuzuhören und das Ende desselben abzuwarten. So entdeckte ihm der Zufall ein Geheimniß, was die nothwendige Klugheit so viele Jahre vor ihm verborgen hatte. Was sollte er jetzt thun? Der Stolz auf seinen Rang, der Verdruß über sein getäuschtes Vertrauen, der Aerger, sich durch ein Geheimniß so viele Jahre hindurch betrogen zu sehen, unterdrückten in seiner Seele jedes großmüthige Gefühl. In sein Kabinett zurückgezogen, entwarf er die Pläne zur schrecklichsten Rache. Er gab die strengsten Befehle und schlug selbst seiner Gemahlin, die ihn vor ihrem Ende noch einmal zu sehen und zu sprechen wünschte, ihre letzte Bitte ab.“
„Oscar hörte von der Gefahr, in welcher seine Mutter schwebte, und umsonst waren die strengen Befehle, durch welche sein Vater den Wachen befohlen hatte, ihn nicht von seinem Zimmer zu lassen. Er entriß einem Soldaten, der sich ihm widersetzen wollte, das Gewehr und sogleich hörte aller Widerstand auf. Nun eilte er in das Zimmer seiner Mutter, aber welcher traurige Anblick wartete seiner hier! Von weinenden Frauen umgeben, lag Elzins sterbend auf ihrem Bette. „Lieber Oscar,“ sagte sie leise, „wir werden uns in einer andern Welt wiedersehen. Ich muß sterben. Dein Vater hat meine Rechtfertigung nicht mehr hören wollen; nun mußt Du dich meiner Sache annehmen. Umarme mich zum letzten Male, mein Sohn; sorge für Athalise und Thelemy und vergiß Deine Mutter nicht! Leb wohl, Oscar, leb wohl!“ Bei diesen Worten schlossen sich ihre Augen und nachdem sie dies gesprochen hatte, standen ihre Lippen auf ewig still.“
„Oscar war in Verzweiflung, und nur mit Gewalt konnte man ihn von der theuren Leiche entfernen. Er eilte nur zu Athalisens Wohnung, um sich hier von seiner Schwester und von der zärtlichen Freundin seiner Mutter Trost zu holen; aber nicht die Wohnung mehr, sondern nur die Trümmern derselben fand er noch. Erstaunt über diesen Anblick, fragte er, was hier vorgefallen sey und erfuhr, daß der Gouverneur das Haus habe niederreißen und seine Bewohnerinnen auf immer aus Mähren vertreiben lassen. Nun stand er unentschlossen da und wußte nicht, wohin er sich jetzt wenden solle. Endlich verfolgte er auf’s Gerathewohl einen Weg, in der Absicht, die beiden Vertriebenen aufzusuchen.“
Athalis und Thelemy, aus ihrer Wohnung vertrieben, waren indeß den Soldaten des Gouverneurs, welche sie verfolgten, entflohen. Von aller Welt verlassen, ohne Zufluchtsort, ohne Freund, schleppten sie sich auf dem Wege zum Exile vorwärts. Athalise, kaum etwas von einer schweren Krankheit genesen, fühlte, wie ihre Kräfte abnahmen, und ihr Geist allein erhielt sie bei ihrem Unglücke aufrecht. Für ihre Freundin duldete sie, dieser Gedanke gab ihr Standhaftigkeit und Muth. Aber Thelemy, in Verzweiflung über ihren Zustand, rief weinend: „O Gott, die ganze Welt verläßt uns. Sieh nur, Jeder wendet seine Blicke von uns ab und fliehet uns. Selbst Oscar. Weiß er nicht, was ich dulden muß?“ — „Vergiß Alles!“ entgegnete Athalise. — „Ihn vergessen, wenn die Liebe mich verzehrt!“ — „Thelemy, er ist ja Dein Bruder.“ — „Nur seit wenigen Tagen ist er mein Bruder; mein Freund, mein Geliebter aber ist er gewesen, so lange ich lebe!“ — „Habe Geduld, meine Tochter, und erschwere Dir unsere grausame Lage nicht noch durch unnütze Klagen.“
„So vergingen zwei Tage und schon fühlten sie den Mangel aller Lebensbedürfnisse im höchsten Grade. „Laß uns ruhen,“ sagte Athalise, „ich kann mich nicht mehr aufrecht halten. Ich habe großen Durst; ach, nur ein wenig Wasser! ...“ Bei diesen Worten sank sie neben einem Baume nieder. Thelemy sah die Gefahr ihrer Freundin und sogleich belebten sich alle ihre erschöpften Kräfte von neuem. Sie suchte in der ganzen Gegend umher nach einer Quelle und war auch endlich so glücklich, das hellste Wasser zu finden. Schnell füllte sie ihre hohlen Hände davon an und eilte dann zu zu ihrer Freundin zurück. Aber in welchem Zustande fand sie diese. Leblos lag sie an der Erde; ihre Augen waren gebrochen, ihr Mund halb geöffnet, Thelemy glaubte, sie schliefe oder läge in Ohnmacht und rief sie deshalb laut bei’m Namen; doch Athalise schwieg. Sie nahm ihre Freundin in ihre Arme, drückte sie, rief sie noch einmal mit ihrer klagenden Stimme, doch umsonst. Athalise sollte sie nicht wiedersehen. Ihr Herz war kalt und erstarrt und ihre Augen auf ewig geschlossen.“
„Dieser Schlag war zu hart für Thelemy. Mit zerzausten Haaren lief sie auf die Landstraße und warf sich einem Wagen in den Weg, der eben vorüber fahren wollte. Der Wagen hielt und ein Fremder stieg aus. Thelemy konnte nicht reden, aber mit der Hand zeigte sie auf die Ursache ihrer Verzweiflung und zog dann den Fremden mit sich fort. Dieser untersuchte Athalisens Zustand und überzeugte sich bald, daß alle Bemühungen, sie in’s Leben zurückzurufen, vergeblich wären. Mitleidig sprach er seine Ueberzeugung aus; da zeigte sich ein schreckliches Lächeln auf Thelemy’s bleichen Lippen und hastig wiederholte sie mehrere Worte, die unbezweifelte Zeichen von Wahnsinn gaben.“
„In diesem Augenblicke bemerkte Oscar der unausgesetzt den eingeschlagenen Weg verfolgt hatte, die geliebte Schwester. „Thelemy, Thelemy“ rief er, „finde ich Dich endlich wieder! Aber, mein Gott, in welchem Zustande. Ich bin es ja, sieh mich doch an, kennst Du Oscar nicht mehr?“ Thelemy sah ihn starr an, doch ohne ihn zu erkennen und bewußtlos sank sie dann in seine Arme. Während der Fremde Athalisens Leiche forttrug, hob Oscar Thelemy in den Wagen und stieg dann selbst mit dem Fremden hinein, der nun seinen Weg fortsetzte.“
„Dieser Fremde war Oldozi, ein berühmter Arzt, der edelmüthig seine ausgezeichneten Talente besonders den Unglücklichen weihete, welche ihres Verstandes beraubt worden waren. In einem Schlosse, welches er in der reizendsten Gegend bewohnte, hatte er eine große Anzahl solcher Unglücklichen, die er für die menschliche Gesellschaft wieder zu gewinnen suchte, versammelt, und dahin wurde auch Thelemy gebracht.“
„Oscar war untröstlich und wollte sich durchaus nicht wieder von Thelemy trennen. Er bediente sie mit der größten Aufmerksamkeit; er folgte ihr überall; er erinnerte sie tausend Mal an ihr enges Verhältniß; er nannte ihrem Ohre die Namen Bruder und Schwester, doch Thelemy blieb unempfindlich gegen alles, was er ihr sagte, nichts konnte sie aus ihrem tiefen, schmerzlichen Schweigen wecken.“
„So vergingen mehrere Tage und Oscars Verzweiflung ließ fürchten, daß er jede Hoffnung verloren habe. Oldozi wünschte ihn zu trösten. „Kommen Sie mit mir, Prinz,“ sagte er eines Tages zu ihm, „um Zeuge eines interessanten Auftrittes zu seyn, der vielleicht ihrer beklagenswerthen Freundin, wenigstens auf eine kurze Zeit, den Verstand wiedergeben wird. Nur wenige Menschen sind von der Natur so stiefmütterlich behandelt, daß die Musik keinen Eindruck auf sie machen kann; mehr aber als alle übrigen, sind traurende Herzen für die Reize derselben empfänglich, und durch die sanften Töne der Musik allein ist es möglich, ihnen die verlorene Ruhe wieder zu geben. Urtheilen Sie selbst, ob der Erfolg meinen Behauptungen, entspricht.“
„Hierauf trat er mit Oscar hinaus und gab ein Zeichen, worauf sogleich eine klagende, sehnsuchtsvolle Melodie anhob, durch die selbst Oscar aus seinem dumpfen Schmerze geweckt und gerührt wurde. Bald darauf erschien auch Thelemy, die den Tönen entgegen eilte und einen Berg hinan stieg, auf dessen Gipfel sie sich niedersetzte. „Wir wollen uns ihr nähern,“ sagte nach einiger Zeit Oldozi; „aber verbergen Sie sich noch vor ihr, um den Eindruck nicht zu stören, den die Musik auf sie machen muß. Vielleicht, daß sie dann in Ihnen ihren Bruder wieder erkennt.“ In dieser Hoffnung folgte Oscar dem Rathe des Arztes und verbarg sich hinter Thelemy in dem Gebüsche. Oldozi aber trat zu ihr und fragte: „Was empfinden Sie jetzt, reizende Thelemy?“ — „Einen Schmerz, der mir gefällt. Mein Herz brennt; meine Gedanken verwirren sich. Ach, sonst war ich ihm so nahe! Damals liebte er mich und jetzt — gewiß, ich bin sehr unglücklich!“ —
„Thelemy!“ rief Oscar, der sich nicht länger zu halten vermochte. — „Still, still“, sagte Oldozi zu ihm. — „Mein Gott,“ fuhr Thelemy fort, „war das nicht seine Stimme — aber nein; ich irre mich. Für mich giebt es kein Glück mehr. Ich möchte wohl sterben, wenn ich nur könnte!“ — „Wollen Sie denn immer weinen?“ — „Immer!“ erwiederte sie — „Beruhigen Sie sich hier werden Sie von Jedermann geliebt.“ — „Nein, nein! er liebt mich nicht mehr er darf mich nicht mehr lieben.“ — „Warum diese Furcht?“ — „Sie können noch fragen? Man sieht, daß Sie mein Unglück nicht kennen; doch Sie sollen alles erfahren, Hören Sie mich an!“
„Nun sang Thelemy selbst eine Romanze in welcher sie ihr Schicksal erzählte und besonders darüber, klagte, daß ein schreckliches Geheimniß Oscar verbiete, sie noch zu lieben. Als sie ihren Gesang geendet hatte, trat auch dieser aus dem Gebüsche zu ihr und bedeckte ihre Hand mit Küssen und mit Thränen. „Theure Thelemy,“ rief er, „erkennst Du deinen Bruder nicht?“ — „Du, mein Bruder? Ach, wenn es wahr wäre! Doch, was sagst Du, Unglücklicher? Mein Bruder? ... ich habe keinen, ich habe nie einen gehabt.“ Darauf setzte sie mit leiser Stimme hinzu: „Schweig und bewahre dies schreckliche Geheimniß. Wenn es Jemand hörte, so wäre ja Alles verloren. Um die Ehre meiner Mutter zu retten, darf Niemand erfahren, daß ich ihre Tochter bin. Und Du weißt es dennoch?“ — „Theure Freundin, geliebte Schwester Du, die ich noch immer anbete, die ich ewig liebe, erkenne doch Deines Oscars Stimme!“ — „Du, Oscar? — Ja, ja, er ist es!“ rief sie laut und sprang dann eilig von ihrem Sitze auf und entfloh in das Thal hinab, so daß sie bald Oscars Augen entschwunden war.“
„Folgen Sie ihr nicht, Prinz,“ sagte Oldozi; „sie ist zu schwach, um so viele Eindrücke auf ein Mal zu fassen. Ich werde ihr Boten nachsenden und, verlassen Sie sich auf mein Wort, man wird sie wohlbehalten ins Schloß zurückbringen.“
„Indes wurde es Abend und schon seit einer Stunde waren mehrere Boten aus der Residenz eingetroffen. Prinz Adalbert hatte nämlich den Aufenthalt seines Sohnes entdeckt und Harald, dem Wächter desselben, befohlen, ihn mit Oldozi zu holen. Alles war schon in Bereitschaft gesetzt, um diesem Befehle des Gouverneurs nachzukommen; aber noch immer war Thelemy nicht auf das Schloß zurückgekehrt und umsonst wurde der Wald nach allen Richtungen durchsucht. Endlich, gegen Morgen, kamen die hierzu ausgesandten Diener an einen Strom, wo sie Thelemys Schleier fanden, der an einer wilden Weide hängen geblieben war. Sogleich brachten sie diese Nachricht auf das Schloß; Oldozi aber befahl hierüber zu schweigen und daraus noch keinen Verdacht zu schöpfen, worüber erst die Zeit und weitere Nachforschungen richtige Aufschlüsse geben könnten. Auf seinen Rath benutzte man den tiefen Schlaf, in welchen Prinz Oscar begraben lag, um ihn in den zur Reise bereit stehenden Wagen zu heben, auch Oldozi stieg hinein und pfeilschnell eilten die Rosse des Gouverneurs auf dem Wege nach Olmütz vorwärts.“
Hier hielt Aubrey in seiner Erzählung inne. „Freund,“ sagte darauf Leonti, „warum wollt Ihr eure Erzählung in dem Augenblicke unterbrechen, wo wir am meisten auf den Ausgang derselben gespannt sind? Sagt uns, was ist aus Thelemy geworden? Alle Bande, die sie an das Leben fesselten, waren zerrissen, in ihren Hoffnungen getäuscht, des Lebens, überdrüssig, blieb ihr nichts übrig, als der Tod. Aber wenn es nun wahr ist, was wir bis jetzt vermuthen, daß sie in dem Waldstrome ihren Tod gefunden habe; so sehe ich noch nicht ein, welche Aehnlichkeit sie mit dem furchtbaren Menschen haben könne, den wir verfolgen. Das aber habt Ihr uns doch vorher gesagt und hierüber wünschte ich vor allen Dingen Aufschluß zu haben. Ein weiblicher Vampyr, der seinen Geliebten verfolgt! Ich kann mir dies nicht als möglich denken.“ Aubrey fuhr um dieser Bitten willen so fort:
„Als Oscar auf dem Schlosses seines Vaters angelangt war, erkundigte er sich wiederholt nach dem Ende, welches Thelemy’s Flucht genommen habe und man fand jetzt für gut, ihm auch nicht länger zu verhehlen, daß man an dem Flusse ihren Schleier gefunden habe. Auch er zweifelte keinen Augenblick daran, daß die unerbittlichen Fluthen das Grab seiner heiß geliebten Schwester geworden wären und weder die glänzenden Feste des Hofes, noch der Glanz seines fürstlichen Standes, noch die verführerischen Reize des Ruhmes konnten ihn trösten und zerstreuen. Alle Freuden führte die Zeit spurlos an ihm vorüber; aber die schmerzliche Erinnerung an das, was er erlebt hatte, blieb ihm und wenn sie auch an ihrer Lebhaftigkeit verlor, so ließ sie in seiner Seele doch einen Eindruck zurück, der unauslöschlich war.“
„So verflossen mehrere Jahre und Oscar blieb gleich unempfindlich gegen die Bemühungen der schönsten Jungfrauen ihm zu gefallen; aber Stolz und Ehrgeiz bestimmten endlich seinen Vater, ihm eine Gemahlin zu wählen. Er mußte gehorchen. Schon war ein königliches Fest zugerichtet, um seine Vermählung zu feiern; der Brautkranz schmückte die Prinzessin Amalie; Oscar wollte eben den ehelichen Eid schwören, als sich plötzlich die Thür der Kapelle öffnete. Eine Harfe erklang und zu ihren Tönen sang eine weibliche Stimme die Worte aus, Thelemy’s Liede:
„Ich leb’ und sage jeder Stunde:
Ewig weinen, sterben nie!“
und es erschien ... — „O Himmel!“ rief Leonti. — „Was fällt Euch ein“ — „Sie ist es!“ — „Wer?“ — „Bettina!“ — „Ja,“ sagte Bettina, die unbemerkt in’s Zimmer getreten war, „ich bin es selbst ich war es, die Du in Neapel gesehen und zu Rom gehört hast und ich erscheine jetzt abermals vor Dir, um Dir zu sagen, daß der abscheuliche Fremde, den Du verfolgst, hier ist und als ein sehr mächtiger und angesehener Mann am Hofe des Herzogs von Modena lebt.“ — „Unser Feind ist zu Modena?“ fragte Aubrey. — „Ja, er ist erster Minister und nennt sich Lord Seymour.“ — „Nun, so laßt uns zur Rache eilen!“ —
„Geduld!“ erwiederte Bettina. „Die Unternehmung ist nicht leicht und bedarf aller Klugheit. Noch ist der Augenblick nicht gekommen, wo unsere Rache handeln darf. Ein eben so hoher Staatsbeamter haßt den unverschämten Minister, der das Vertrauen seines Herrn mißbraucht; ich habe ihn von unserm Geheimnisse unterrichtet und erwarte seine Befehle.“ — „Theure Bettina,“ sagte Leonti bewegt, „sehe ich Dich wirklich wieder? Ach, wenn es kein Traum ist, so verlaß Deinen liebten nicht wieder, so bleib nun bei mir!“ — „Ein heiliges Gelübde verbietet mir dies, bis auf den Tag, wo der verruchte Vampyr stirbt.“ — „Nun, so reiß mich wenigstens aus der Ungewißheit, worin ich schwebe und sage mir, wie, wo und durch welche höhere Macht Du wieder ins Leben gekommen bist?“ Bettina nickte ihm lächelnd Gewährung und fing so zu erzählen an:
„Als Du mich in jener verhängnißvollen Nacht mit dem Fremden allein ließest, ach da wußten wir Beide nicht, daß das Verbrechen sich oft selbst unter der Sprache der Tugend verbirgt. Dieser Fremde war der Blutsauger, vor dem uns Elmoda’s Prophezeiungen warnten. Als sein Opfer sank ich sterbend zu Boden; aber der Wunsch, Dich noch einmal zu sehen, ehe ich Dich auf immer verließe, belebte meine abnehmenden Kräfte und ich schleppte mich mühsam bis zu dem Orte, wo ich Deine Stimme hörte. Ich sahe Dich und weniger unglücklich sagte Dir mein brechendes Auge Lebewohl. Aber dann, soll ich sagen, daß es eine höhere Eingebung war, oder daß meine heiße Liebe zu Dir diese Hoffnung in mir erweckte, als ich vor Deinen Augen verschied, glaubte ich nicht auf ewig zu sterben; mein entfliehender Geist gab mir die Versicherung, daß ich Dich noch wiedersehen sollte. Schon fing mein Grab an zu grünen, als sich plötzlich auf eine unbegreifliche Weise Alles um mich her zu bewegen schien. In meinen Adern brannte ein verzehrendes Feuer, meine Augen glänzten in der finstersten Nacht, meine brennenden Lippen zitterten, die erschütterte Erde öffnete sich und eine überirdische Stimme rief in mein Grab: „Vampyr, steig aus Deinem Grabe!“
„Nun stand ich zu einem neuen Leben auf; aber meine Sinne waren noch verwirrt, ich wußte nicht, was ich nun thun sollte. Nur des Wunsches, mich zu rächen, wurde ich mir bewußt. Aber wer sollte der Gegenstand meiner Rache seyn? Von Allen, die ich in meinem frühern Leben gekannt hatte, erinnerte ich mich nur Deiner noch Leonti, und dies Herz, das Dich so sehr geliebt hatte, faßte, wer sollte es glauben, den Entschluß, Dich zu verfolgen; ein blindes Spielwerk einer höhern Bestimmung hatte Bettina ihren angebeteten Geliebten sich zum Opfer ausersehen. Ohne Ziel machte ich mich auf den Weg und gelangte an das Ufer, wo ich einen Nachen fand, den ich bestieg. Eben stieg die Sonne glänzend am Horizonte auf und vergoldete mit ihren ersten Strahlen die ganze Natur, als die Wellen mich an ein Gehölz trieben, in welchem eine einsame Kapelle stand. Meine ganze Seele war von frommen Gefühlen erfüllt, dem Herrn des Lebens zu danken für meine Errettung, war mein dringendstes Bedürfniß, deshalb stieg ich aus und trat in die Kapelle. Am Altare sank ich in Andacht auf die Knie, aber in dem Augenblicke, wo mein Gebet sich zum Himmel er heben wollte, wurden meine Augen geschlossen und ich unterlag einem plötzlichen Schlafe. Im Traume trat ein Engel als Bote des Allmächtigen zu mir und sprach:
„Der Allgütige hat Dich in ein neues Leben zurückgerufen, aber Deine Seele wird ihre Unschuld auch in diesem Leben bewahren. Du sollst kein Schrecken, keine Geißel der Menschheit seyn, wie jene Ungeheuer, die Jeder verabscheuet, weil sie nur auf die Erde zurückgekommen sind, um ihren Blutdurst zu stillen; sondern ein Schreckniß der Bosheit, ein Beistand der Tugend sollst Du seyn, so will es die Gottheit. Bettina! Du sollst den Gegenstand Deiner reinen Liebe beschützen, darum erhebe Dich und wandere nach Osten zu. Der Himmel wird Dich leiten; aber nicht eher kannst Du mit dem Geliebten auf immer vereinigt werden, als bis der Vampyr, dessen Opfer Du gewesen bist, dem Grabe zurückgegeben ist, das ihn dann auf ewig einschließen wird. Versprich mir nun, dem göttlichen Willen zu gehorchen!“ — „Ich schwöre es!“ rief ich und ... erwachte. Noch ganz erstaunt über meinen Traum, eilte ich ans Ufer, wo auf meinen Wink sogleich ein Schiffer herbeikam, dem ich nun befahl, mich weiter zu führen und augenblicklich segelte sein Fahrzeug dem Osten entgegen.“
„Auf dieser Reise, deren Ziel mir selbst unbekannt war, folgte der Schiffer mir überall und führte mich durch Länder und Städte. Als wir aber uns der Spitze von Italien näherten, da erkaltete der Eifer, mit welchem er mich begleitet hatte. Er befragte mich über den Zweck meiner Reise und meine dunkeln Antworten erweckten in ihm einen Verdacht, der meine Lage immer peinlicher machte. Wußte ich selbst doch nicht, wohin die himmlischen Mächte mich führen würden! In dieser Ungewißheit war ich nach Neapel gekommen und hier ...“ —
Bei diesen Worten wurde Bettina durch ein Klopfen an der Thür unterbrochen. Ein Bote trat ein und überbrachte ihr von Hofe einen Brief. Bettina las ihn und sagte zu dem Boten: „Ich folge Euch!“ Darauf wandte sie sich zu Leonti und sagte: „Morgen erwarte ich Dich im Pallaste des Herzogs,“ — „Im Palaste?“ fragte Aubrey. — „Ja“ antwortete Bettina. „Herzog Albini, der Gouverneur des Pallastes, wird euch die Mittel an die Hand geben, um unsern Feind zu stürzen“ — „O bleib noch, Bettina!“ sagte Leonti. — „Ich kann, ich darf nicht!“ erwiederte sie und verschwand wie ein leichter Schatten.
Das Erscheinen und die Erzählung Bettina’s hatten auf Nadur-Heli einen solchen Eindruck gemacht, daß er mehrere Male sich nicht enthalten konnte, seine Verwunderung laut zu äußern. „Ich begreife die geheimen Verbrechen eures Feindes, noch nicht,“ sagte er, als jene wieder verschwunden war, „und dennoch werde ich dadurch an einen Bösewicht erinnert, den ich für die Ursache aller meiner Leiden halten muß.“ — „Und woher war dieser Treulose?“ fragte Aubrey. „War er ein Landsmann von Euch?“ — „Nein, er war ein Engländer.“ — „Sein Name?“ — „Den weiß ich nicht.“ — „Mir ahnet fast, daß wir alle Drei uns an demselben Feinde zu rächen haben. Und wenn ich mich hierin nicht irre, so laßt uns unsere Kräfte vereinigen und morgen gemeinschaftlich zum Pallaste des Herzogs gehen. Aber bis der Tag anbricht, bleibt uns noch Zeit genug, theurer Nadur-Heli, Deine Geschichte zu hören und gewiß wirst Du uns, nicht länger die Ursache Deines Kummers verbergen.“
Lange schwieg Nadur-Heli; endlich aber sammelte er sich und sagte: „Ihr wollt es, meine Freunde, und so will ich euch denn mein kostbarstes Geheimniß anvertrauen.“ — Hierauf begann er folgende Erzählung.
Nadur-Heli und Cymodora
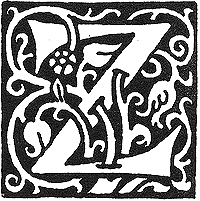 u gehorchen und zu zittern ist die Bestimmung des Volkes in meinem Vaterlande. Dieselbe Hand, welche willkührlich einen Günstling aus dem Staube zum Nächsten am Throne erhebt, giebt auch das Zeichen zum Tode, sobald der Minister das Unglück hat, nicht mehr zu gefallen. Dies war auch das Loos meines Vaters. Er war zu mächtig und bei dem Volke zu beliebt geworden, deshalb erklärte sein Fürst ihn für schuldig und ließ ihn umbringen. In dem Augenblicke, der mich meines Vaters und mit ihm des Letzten meiner Familie beraubte, befand ich mich bei dem Heere, um die ersten Proben meines jugendlichen Muthes abzulegen. Ein treuer Sclav, der bei der Ermordung meines Vaters entflohen war, brachte mir die Nachricht von dem für mich so schrecklichen Ereignisse. Durch die Ungnade meines Vaters in meiner Laufbahn gehemmt, beschloß ich, mich in den dicksten Haufen der Feinde zu werfen und in ihren Schwerdtern den Tod zu suchen, der meiner Verzweiflung am erwünschtesten schien; aber der treue Azem brachte mich von diesem Vorsatze zurück und führte mich weit von dem Orte weg, wo mein Leben auf zwiefache Weise, durch die Waffen der Feinde und durch die Tyrannei eines Fürsten, gefährdet war.“
u gehorchen und zu zittern ist die Bestimmung des Volkes in meinem Vaterlande. Dieselbe Hand, welche willkührlich einen Günstling aus dem Staube zum Nächsten am Throne erhebt, giebt auch das Zeichen zum Tode, sobald der Minister das Unglück hat, nicht mehr zu gefallen. Dies war auch das Loos meines Vaters. Er war zu mächtig und bei dem Volke zu beliebt geworden, deshalb erklärte sein Fürst ihn für schuldig und ließ ihn umbringen. In dem Augenblicke, der mich meines Vaters und mit ihm des Letzten meiner Familie beraubte, befand ich mich bei dem Heere, um die ersten Proben meines jugendlichen Muthes abzulegen. Ein treuer Sclav, der bei der Ermordung meines Vaters entflohen war, brachte mir die Nachricht von dem für mich so schrecklichen Ereignisse. Durch die Ungnade meines Vaters in meiner Laufbahn gehemmt, beschloß ich, mich in den dicksten Haufen der Feinde zu werfen und in ihren Schwerdtern den Tod zu suchen, der meiner Verzweiflung am erwünschtesten schien; aber der treue Azem brachte mich von diesem Vorsatze zurück und führte mich weit von dem Orte weg, wo mein Leben auf zwiefache Weise, durch die Waffen der Feinde und durch die Tyrannei eines Fürsten, gefährdet war.“
„Gezwungen, mein Vaterland zu verlassen, irrte ich lange Zeit flüchtig umher, mein Geschick beklagend und mein Leben verachtend, allein das Andenken an meinen ruhmwürdigen Vater ermuthigte mich wieder und erweckte in mir den festen Entschluß, mich seines Namens würdig zu zeigen. Ich nahm meinen Weg zu den Ufern des Ganges. Hier hatten die Maratten die Staaten des Raja von Benares überfallen und die größte Verwirrung unter einem Volke angerichtet, das mehr an weichliche Unthätigkeit in seinen Harems, als an das Getümmel der Waffen gewöhnt war. In der größten Eile rafften die Indier alle ihre Schätze zusammen, um mit diesen einer Gefahr zu entfliehen, die durch ihre Reichthümer selbst herbeigeführt war. Ungeduldig und nach Gelegenheit mich auszuzeichnen begierig, drang ich nach der Hauptstadt Benares vor und suchte den Pallast des Fürsten auf. Hier fand ich den Raja selbst im Begriff zu entfliehen.
„Großer Fürst,“ sagte ich zu ihm, „erlaube, daß ich Dir in der Noth, worin Dich die List Deiner Feinde und die Feigheit Deines Volkes versetzt haben, meine Hülfe und meinen Beistand anbiete. — Flucht ist das letzte, schimpflichste Mittel der Schwäche!“ rief ich seiner Wache zu. „Soldaten könnt ihr dulden, daß ich ein Fremdling, allein für euren Fürsten kämpfe? Greift zu den Waffen! Die Maratten werden, durch einen unerwarteten Angriff erschreckt, die Flucht ergreifen und der Sieg wird unsern Muth krönen. Ermannt euch! Folgt mir, Nadur-Heli geht euch voran!“
„Bei diesen Worten, was auch die Ursache davon gewesen seyn mag, fühlten alle Krieger die Nothwendigkeit, ihre Feigheit zu unterdrücken und einen ruhmvollen Tod der Schande vorzuziehen. Sie schlossen sich sogleich an mich an und schwuren, zu siegen oder zu sterben. Nun führte ich sie augenblicklich gegen den Feind, auf welchen sie wüthend losstürzten und der glücklichste Erfolg rechtfertigte meine Erwartungen. Die Maratten wurden in die Flucht geschlagen und aus dem Lande vertrieben, dem Raja aber führte ich seine Soldaten als Sieger zurück.“
„Ganz außer sich vor Freude über ein so unerwartetes Glück, wußte der Fürst nicht, auf wie mannichfache Weise er mir seine Dankbarkeit beweisen wollte. Die Reichthümer, welche er mir bot, wies ich zurück; dagegen aber nahm ich den Oberbefehl über seine Truppen an und indem ich nun an seinem Hofe blieb, wurde ich sein vertrautester Rathgeber und sein Freund.“
„Ein langer Frieden führte in Benares bald jene weichliche Ruhe zurück, die Asiens Völkern so erwünscht ist und die nur durch glänzende Feste unterbrochen wurde. Bei einem dieser Feste sah ich zum ersten Male die Tochter des Raja. Von einem Haufen junger Sclavinnen umgeben, die dem entzückten Auge die Reize aller Himmelsstriche darboten, war Azalida doch noch anziehender und schöner als sie alle, und wäre sie nicht auf dem Throne geboren gewesen, so hätte wenigstens Jeder eingestehen müssen, daß sie von der Natur für denselben bestimmt scheine. Seit dieser Zeit traf ich öfter mit ihr zusammen und ich durfte mir schmeicheln, einigen Eindruck auf ihr Herz gemacht zu haben.“
„Unterdes drang auch bis zu uns der Ruhm eines Königs und eines Volks, dessen ritterliche Landsleute einst selbst in der Nähe von Arabien gewesen waren; ich war begierig, ein so ausgezeichnetes Volk kennen zu lernen und verhieß dem Raja, dort für sein Land nützliche Kenntnisse der europäischen Staats- und Kriegskunst zu sammeln. Er willigte gern in diese höchst vortheilhafte Reise, aber er hat mich inständigst, die Dauer derselben abzukürzen und auch in Azalida’s Augen zitterte eine Thräne, die mich um baldige Rückkehr bat.“
„Ich komme nun an einen Zeitpunkt meines Lebens, wobei weitem härtere Unglücksfälle, als alle früher erlittene, mich trafen und meinem Herzen Wunden beibrachten, die nie heilen werden. Nur kurze Zeit erst befand ich mich in Europa, als ein Befehl des Raja mich an seinen Hof nach Benares zurück rief. Ich gehorchte aber ich konnte dem Wunsche nicht widerstehen, meine Rückreise über Athen zu machen, wo ich die ehrwürdigsten Denkmähler des Alterthums besuchte. Als ich eines Tages am Ufer des Aegäischen Meeres saß und mit Wohlgefallen auf die zählreichen Inseln desselben hinabschauete, hörte ich neben mir das Rauschen eines Gewandes. Ich blickte auf und sah eine hohe, schöne, jungfräuliche Gestalt, mit einer Leier in der Hand und Pfeil und Bogen auf dem Rücken, stolzen Schrittes vorüber eilen. Unbemerkt folgte ich ihr und hörte, im Gebüsche versteckt, dem Liede zu, welches sie zu den wilden Akkorden ihrer Leier sang. Stolz und Kraft sprach aus demselben und die Freiheit war sein Gegenstand. Begierig, dies ungewöhnliche Mädchen kennen zu lernen, erhob ich mich und trat zu ihr. So wie sie mich erblickte, ergriff sie Pfeil und Bogen und zielte auf mich. Ich bückte mich indeß und bat sie, mich anzuhören. Mein stehender Blick entwaffnete und überraschte sie und ich wollte nun näher zu ihr treten; aber sogleich eilte sie im schnellsten Laufe über den Hügel und verschwand.“
„Ich kann die Gefühle nicht mit Worten beschreiben, welche Cymodora’s Schönheit, ihr Gesang und ihr Entfliehen in mir erweckten. Lange Zeit blickte ich starr nach der Gegend hin, wohin sie geflohen war; dann irrte ich am Ufer umher und glaubte in dem leichten Sande ihre Spur zu erkennen, und mehr als je wünschte mein Herz sie zurück.“
„Abwechselnd von dem Vergnügen, welches mir ihr Anblick gewährt hatte und von der Besorgniß, daß ich sie nicht wieder sehen würde, bewegt, wollte ich die Gegend verlassen. Ich ging und überließ dem Zufalle die Wahl meines Weges; aber wider meinen Willen führte mich ein ganz eigener Reiz immer wieder an den Platz zurück, wo sie gegen mich zu den Waffen gegriffen hatte. Als ich hier meine Blicke unwillkührlich auf den Boden heftete, erblickte ich eine Schrift an der Erde, die mit dürrem Laube bedeckt war. Ich hob sie auf und erkannte darin die Gesänge jener griechischen Dichterin, welcher unbefriedigte Liebe auf einem Felsen zu Lesbos den Tod gab. Ich konnte nicht begreifen, wie Cymodora, die schon den bloßen Anblick eines Mannes verabscheute, diese Ausbrüche des zärtlichsten Gefühls habe lesen können; aber bald sah ich, daß sie den unsterblichen Gesängen der Sappho ihre Bemerkungen in frischen Schriftzügen beigefügt hatte. Begierig, die Gedanken des Atheniensischen Mädchens kennen zu lernen, las ich sie mit Aufmerksamkeit durch und fand in ihnen die sichersten Beweise, daß sie die Männer und die Liebe als Feinde der Freiheit hasse und fliehe.“
„Von der Hoffnung Cymodora wiederzusehen erfüllt, kam ich nach einiger Zeit wieder an den Ort zurück, wo ich sie zuerst gesehen hatte und ich wurde nicht getäuscht, denn bald ließ sie sich hören. Indem ich sie zu überraschen und doch zugleich zu fesseln wünschte, griff ich nun in die Saiten der Leier, welche ich mitgebracht hatte und sah mit Vergnügen, wie sie umsonst dem Eindrucke dieser für sie neuen und hinreißenden Melodie zu widerstehen suchte und wie sie endlich sich meinem Verstecke näherte, um noch besser hören zu können. Sobald sie mir nun nahe genug war, hörte ich plötzlich auf zu spielen und trat zu ihr.“
„Schöne Griechin,“ sagte ich, „fürchte Dich nicht, ich will Dich weder in Deiner Unschuld stören, noch Dir Deine Freiheit rauben. Nein, ich schwöre es Dir und Du darfst einem Fremden, der Dich bewundert und Dich inständig bittet, glauben, ich wünsche nur das Glück zu haben, aus Deinem Munde eine Erzählung des Unglücks zu hören, welches Dein Vaterland betroffen hat. Obgleich ich zum Herrschen geboren bin, will ich doch Dein Sclave seyn, Befehl, ich werde gehorchen!“
„Diese ungewohnte Sprache benahm ihr jede Furcht. Verwundert und ohne ihre Bewegung verbergen zu können, sah sie mich an und sagte: „Erkläre mir, Fremdling, auf welche Weise Du so reine und so rührende Töne hervorbringst. Deine Kunst ist gefährlich und sehr reizend; aber eigentlich so doch die Muse durch ihre Töne den Muth, nicht aber jene betäubende Sinnenlust erwecken. Weißt Du nicht, daß in den glücklichen Zeiten Athens ein Grieche angeklagt wurde, weil er eine siebente Saite für die Leier erfunden hatte?“ — „Ja,“ erwiederte ich, „aber als Timotheus, um den Tod dafür zu leiden, über einen öffentlichen Platz geführt wurde, bemerkte er eine Statue des Apollo, welche eine der seinigen ähnliche Leier in der Hand hielt. Ueber diese unerwartete Erscheinung erfreut, zeigte er dem Volke das göttliche Instrument, welches, wie er sagte, ihm zum Muster gedient hätte und seine Richter wagten nun nicht, ihn um einer Erfindung willen zu verdammen, die durch das Attribut einer Gottheit geheiligt war.“
Durch die Antwort wurde Cymodora überrascht, sie erröthete, schwieg einen Augenblick und sagte dann: „Ich muß gestehen, der männliche Stolz in Deinem Gesichte und die Sanftmuth in Deinem Gespräche haben mir ein Zutrauen eingeflößt, wie ich es zu keinem Manne fassen zu können glaubte. Aber sage mir, was suchst Du hier? In welcher Absicht bist Du in diese verlassene Gegend gekommen? Bist Du gekommen, um die alten Denkmäler des Ruhms der Griechen zu bewundern? Du siehst, sie sind nicht mehr, Barbaren haben den Boden Athens betreten und das alte Athen ist dahin. Sie haben unsre Felder verwüstet, unsre Kunstwerke zertrümmert und unsere Heiligthümer entweiht. Die entarteten Griechen sind vor ihnen geflohen und ich selbst zog mich in die Trümmern eines christlichen Tempels zurück, wo der weise Alcidamas, ein ehrwürdiger Priester, mich an Kindes Statt annahm und erzog. Hier habe ich einsam im Walde und von aller menschlichen Gesellschaft entfernt, bis jetzt gelebt. Und nun ist Alcidamas gestorben. Ich habe gesehen, wie das Leben von ihm wich; ich habe ihm mit meinen Händen ein Grab bereitet und noch in diesem Augenblicke, wo ich mit Dir von meinem väterlichen Freunde rede, glaube ich die letzten Worte desselben zu hören, mit welchen er mir zurief: „Cymodora, fliehe die Menschen, so wirst du frei seyn!“ — Ich habe es dir geschworen, ehrwürdiger Vater, und ich werde es halten! Frei und rein will ich seyn, wie du selbst es warst!“ —
So sprach Cymodora und der Ton, in welchem sie dies alles sagte, gab ihren Worten einen Ausdruck und ein Gewicht, wodurch ich wie bezaubert wurde. Ich konnte nicht müde werden, sie zu sehen und zu hören, und auch sie, über mein langes Schweigen verwundert, sah mich jetzt an. Ach, und mit welchem Blicke! Mein Herz war entflammt und wurde unwillkührlich zu ihr hingezogen; meine Kniee beugten sich und ich sank zu ihren Füßen. Sie erröthete und wollte zornig entfliehen. „O, Cymodora,“ sagte ich darauf, „verzeihe mir! Ich kann dem Zauber nicht widerstehen, welchen Deine Schönheit und Deine Stimme für mich haben. Kannst Du vor mir erschrecken, daß Du fliehst? Du selbst bist die Ursache des Zaubers, in dem ich befangen bin, für Dich allein empfinde ich jene heiße Liebe, die Du verdammst, die aber auch Dich verdammen kann, wenn Du selbst sie einflößest. Und wenn Du dem Nadur-Heli verbietest, seine Wünsche bis zu Dir zu erheben, so nimm wenigstens die Hülfe an, welche sein Arm Dir anzubieten vermag. Von neuem kann ein Krieg dies Land verwüsten und Räuber können dasselbe überfallen, von denen Du alles fürchten mußt; darum beschwöre ich Dich bei dem Andenken an Alcidamas, bei dem Namen der Götter, die Du verehrst, erlaube mir, Dich gegen die Gefahren zu vertheidigen, die Dir drohen!“ —
„Du mich vertheidigen? Mich beschützen? Habe ich nicht meine wohlerprobten Pfeile? Wehe dem, der es wagte, ihnen zu trotzen!“ — „Verlaß eine Gegend, wo Deine Freiheit in Gefahr ist.“ — „Ich bin und bleibe frei!“ rief sie stolz, und ich überzeugte mich, daß die Zeit allein im Stande seyn werde, sie auf Gefahren aufmerksam zu machen, die ihr bis jetzt noch fremd waren. — „Nun,“ sagte ich darauf zu ihr, „so gewähre mir wenigstens die Bitte und erzähle mir die Leiden des Alcidamas und die Ursachen, welche Athens Tochter zur einsamen Bewohnerin des Waldes gemacht haben!“ — „Morgen!“ sagte sie; „denn für heute müssen wir uns trennen, da der Abend herannaht. Leb wohl!“ — Bei diesen Worten verließ sie mich, aber weniger eilig als sonst, ja, indem sie sich sogar mehrere Male nach mir umsah.“
„Welche frohen Gefühle erweckte in mir die Hoffnung, sie am folgenden Tage wieder zu sehen! Morgen! sagte Cymodora, die sonst alle Menschen haßt. Meine Gesellschaft ist ihr also nicht mehr zuwider; sie erzählt mir, sie hört mir zu. Morgen werde ich sie wieder sehen, mich vielleicht eines Lächelns von ihr erfreuen, oder ein freundliches Wort von ihr hören! So dachte ich bei mir in freudiger Erwartung des kommenden Tages. Dieser Tag war sehr schwül, ich erwartete daher die kühleren Abendstunden und eilte dann an den Ort, wo ich Cymodora’s Ankunft erwarten wollte. Aber, wer schildert mein Entsetzen und meine Verzweiflung, als ich, an dem gedachten Orte angekommen, ein Boot auf den Wellen des Meeres enteilen sah, in welchem Cymodora als Gefangene von Räubern weggeführt wurde und vergebens die Hände nach mir ausstreckte, um mich um Hülfe zu bitten. Ich versuchte alle Zeichen unsers Landes und zeigte den Räubern unter andern einen Dolch, reich mit Edelsteinen besetzt, als Zeichen meines hohen Standes; aber umsonst drang selbst meine Stimme zu ihnen. Ihre feilen Seelen haben nur Gehör für den Klang des Goldes, um dessen willen sie die jungen Mädchen von den Küsten rauben und in die Asiatischen Harems führen. Bald waren das Boot und Cymodora mir aus den Augen entrückt.“
„Da Cymodora mir entrissen und jede Hoffnung, sie wieder zu sehen, verschwunden war, hatten die Schönheiten ihres Vaterlands auch keinen Reiz mehr für mich. Deshalb bestieg ich zu Corinth ein Schiff und reisete mit demselben nach Benares ab.“
„Meine Reise ging schnell zu Ende. Mit großem Jubel wurde ich empfangen, da meine Rückkehr zu Benares bekannt geworden war. Der Raja selbst war mir entgegengekommen und Azolida begleitete ihn. Als diese ihren Schleier hob, wurde ich durch ihre Schönheit und durch die Freude, welche aus allen ihren Zügen sprach, sichtbar verwirrt; ich ließ mich vor ihr auf ein Knie nieder und sie reichte mir die Hand, die ich in der meinigen zittern fühlte. Ich mußte mich nun zu ihr auf den Palankin setzen und so war mein Einzug in die Stadt einem Triumphzuge gleich. In der Stadt war Alles festlich und glänzend. Der Raja hatte ein großes Fest veranstaltet, zu welchem sein ganzer Hof eingeladen war. Ich mußte neben seiner Tochter Platz nehmen und darauf sagte er in Gegenwart aller Hofleute zu mir: „Höre, Nadur-Heli, den Grund, der mich bewogen hat, Deine Rückkehr zu uns zu beschleunigen. Azolida konnte Deine längere Abwesenheit nicht ertragen; sie hat mir ihre Liebe zu Dir gestanden und ihr Kummer beunruhigte meine Zärtlichkeit für sie so sehr, daß ich mich entschloß, Dich zurück zu rufen. Noch immer bin ich Dir meinen Dank für die großen Dienste, welche Du mir und meinem Volke geleistet hast, schuldig; deshalb habe ich Dich zur Stütze und zum Erben meines Thrones erwählt und schon morgen sollst Du mit meiner geliebten Tochter verbunden werden.“
„Wer vom Blitze getroffen wird, kann nicht mehr überrascht seyn, als ich es bei dieser Nachricht war. Azolida blickte mich mit süßer Hoffnung an und schien eine Antwort zu erwarten. Ich bemerkte es und indem ich mich aus meiner Verwirrung zu sammeln suchte, erzwang ich ein Lächeln und verneigte mich vor dem Raja zum Beweise meiner Dankbarkeit, aber mein Herz, das mit einer andern Liebe beschäftigt war, als der, wovon ich jetzt den Lohn empfing, zitterte in voraus vor den Leiden, die mir ohne Zweifel bevorstanden.“
„Der Raja bat mich nun, ihm von meinen Reisen zu erzählen; ich that es und beschrieb ihm die Reize der Schweizergegenden, die glückliche Lage Frankreichs, die Kunstschätze Italiens und die Trümmern von Athen. Ach, mit welchen Empfindungen sprach ich gerade jetzt von diesem Gegenstande! Nichts, was ich in dieser Gegend, wo mir das Leben aufgegangen war, gesehen und erlebt hatte, war meinem Gedächtnisse entfallen und auch der kleinste Umstand schien mir der Mittheilung werth. So beschrieb ich auch die Gefühle, welche mich an der Küste des Aegäischen Meeres ergriffen hatten, als ich hier eines Tags durch die Töne einer Leier und durch den stolzen Gesang eines griechischen Mädchens überrascht wurde. —
„O,“ unterbrach mich der Raja, „was Dich dort so entzückt hat, kannst Du auch hier hören. Selim!“ rief er, „führe die neue Sclavin herein!“ — Sogleich trat ein junges Mädchen mit einer Leier herein und fing das Vorspiel an. Jetzt lüftete sie den Schleier, ich sah sie an — Gott! es war Cymodora!“
„Ihr seht die Scene voraus, welche erfolgte, als Cymodora auch mich erkannte. Wir flogen einander in die Arme; der Raja aber, aufgebracht darüber, daß ich seiner Tochter in ihrer und seiner Gegenwart eine Andere vorzog, ließ mir Cymodora mit Gewalt entreißen. In Rücksicht auf meine Verdienste und auf die Liebe des Volks zu mir, wurde ich augenblicklich aus dem Lande verwiesen, da mir sonst der Tod gewiß gewesen wäre. Cymodora aber, die umgebracht werden sollte, wurde auf seinen Wunsch einem Engländer überlassen, der von den Englischen Besitzungen nach Benares gekommen war, um mit dem Raja zu unterhandeln, und bei diesem ist sie, da es mir ganz unmöglich war, sie zu befreien, nach sehr kurzer Zeit auf unbegreifliche Weise gestorben.“
Hier wurde Nadur-Heli durch ein lautes Klopfen an der Thür des Hauses, in welches die drei Freunde sich zurückgezogen hatten, unterbrochen. Man öffnete und fand einen Boten des Herzogs Albini, welcher hereintrat und sagte: „Ich habe Befehl, euch auf einem geheimen Wege in den herzoglichen Palast zu führen, wo euch der Gouverneur Albini erwartet.“ — „Was denkt er zu beginnen?“ fragte Aubrey. — „Das weiß ich nicht.“ — „Und wann sollen wir den Minister sehen?“ — „Bei dem Feste, welches der Hof heute Abend giebt und wobei auch ihr zugegen seyn werdet. Doch, laßt uns eilig aufbrechen!“
Es war indessen Tag geworden und Nadur-Heli, Aubrey und Leonti folgten ihrem Führer, der ihnen die größte Sorgfalt empfahl und sie in kurzer Zeit in den Pallast des Herzogs von Modena brachte.
III
Der Minister des Herzogs von Modena
 lfons der Zweite, Herzog von Ferrara, der im Jahre 1597 ohne Kinder gestorben war, hatte in seinem Testamente den Herzog Cäsar von Este zum Universalerben ernannt. Der neue Herzog zeigte dem Papste Clemens dem Achten seine Thronbesteigung an; aber der römische Hof erklärte aus nichtssagenden Gründen, daß das Herzogthum Ferrara dem heiligen Stuhle anheim gefallen wäre und gab eine Bulle aus, worin er, weit entfernt, Cäsar als rechtmäßigen Nachfolger Alfons des Dritten anzuerkennen, ihn vielmehr der Thronfolge unfähig erklärte und sammt Allen, die seine Parthei ergreifen würden, excommunicirte und die Stadt Ferrara mit dem Interdict belegte.
lfons der Zweite, Herzog von Ferrara, der im Jahre 1597 ohne Kinder gestorben war, hatte in seinem Testamente den Herzog Cäsar von Este zum Universalerben ernannt. Der neue Herzog zeigte dem Papste Clemens dem Achten seine Thronbesteigung an; aber der römische Hof erklärte aus nichtssagenden Gründen, daß das Herzogthum Ferrara dem heiligen Stuhle anheim gefallen wäre und gab eine Bulle aus, worin er, weit entfernt, Cäsar als rechtmäßigen Nachfolger Alfons des Dritten anzuerkennen, ihn vielmehr der Thronfolge unfähig erklärte und sammt Allen, die seine Parthei ergreifen würden, excommunicirte und die Stadt Ferrara mit dem Interdict belegte.
Die Truppen des Papstes, fünf und zwanzig tausend Mann stark, rückten an das Gebiet von Ferrara und Cäsar, der bei keiner andern Macht Beistand finden konnte, war gezwungen, sich aufs Bitten zu legen und vor allen Dingen einen Waffenstillstand auszuwirken.
Es bedurfte eines sehr gewandten, erfahrenen Mannes zu dieser wichtigen Unterhandlung. Der Herzog beauftragte damit einen angesehenen Engländer, der unlängst zu Ferrara angekommen war und sein ganzes Vertrauen besaß. Als Staatsmann eben so ausgezeichnet, wie durch seine glänzenden äußern Eigenschaften und besonders durch jene Gewandtheit und Geschmeidigkeit, die am Hofe immer den Sieg davon trägt, begünstigt, war Lord Seymour der Freund und Vertraute des Fürsten geworden und mit Begierde übernahm er eine Gesandtschaft, die seinem Ehrgeize ein so reiches Feld darbot.
Der Cardinal Aldobrandini, Neffe des Papstes und Legat desselben zu Bologna, begab sich nach Faenza, welche Stadt zu den Verhandlungen ausersehen war, und hier brachte der Minister des Herzogs durch seine List ihm dahin, daß er einen Vertrag unterzeichnete, kraft dessen Cäsar vom Kirchenbanne befreiet werden sollte, wenn er auf den Besitz des Herzogthums Ferrara verzichtete und dem Papste die Hälfte von allem, was in der Stadt an Geschütz, Waffen und Munition befindlich wäre, überließe.
Der Herzog verließ die Stadt und das Gebiet von Ferrara und verlegte seinen Hof nach Modena. Er wandte alles auf, um seine neue Hauptstadt so viel als möglich zu verschönern und bald übertraf seine jetzige Residenz auch an Glanz das nun todte und verödete Ferrara, welches er dem Papste überlassen hatte.
Lord Seymour wurde zum ersten Minister ernannt und der neue Staat war anfangs glücklich, eben weil er noch neu war. Bald aber hörte man überall Klagen und Unzufriedenheit laut werden und der allgemeine Gegenstand derselben wurde Lord Seymour, weil man zu wiederholten Malen gesehen hatte, wie er das Laster auf Kosten der Tugend hob, und die Stimme der Gerechtigkeit und Ehre, so wie das Geschrei der Klage unterdrückte.
Herzog Albini, vormals der erste Minister zu Ferrara, war jetzt Gouverneur des herzoglichen Pallastes zu Modena und sein Sohn Befehlshaber der Leibwache. Durch große Verdienste und unzählige Beweise seiner treuen Ergebenheit hatte dieser ehrwürdige Greis sich das Recht erworben, selbst dem Fürsten die Wahrheit sagen zu dürfen. Mit Betrübniß hatte er es erleben müssen, daß ihn ein Fremdling von seinem ehrenvoll verwalteten Posten verdrängte aber mit Gewißheit sagte er nach den ersten Schritten des neuen Ministers die nachtheiligen Folgen seines Einflusses voraus. Er theilte selbst dem Herzoge seine Besorgnisse mit; doch man hörte nicht auf ihn und Lord Seymour erstieg den Gipfel der Ehre und Macht und sah, wie sich Alles unter seinen Willen beugte. Der Ernst in seinem Blicke und die Gemüthsbewegung, welche aus seinen Zügen sprach, hielt man für die Folgen seiner zu großen Anstrengung; wenn er dann aber bei den Hof- Festen erschien, zeigte er so viel Gewandtheit des Geistes, so viel Anmuth in seiner Unterhaltung, daß alle Frauen sich unter einander um seine Huldigungen beneideten. Und so war Lord Seymour nicht nur im Besitze der höchsten Macht, sondern er war auch die Seele der geselligen Unterhaltung am Hofe. Besonders zeigte er dies in den Zirkeln, welche sich des Abends in den Zimmern der Prinzessin, der einzigen Tochter des Herzogs, zu versammeln pflegten und geistreiche Mittheilungen und freundschaftliche Erzählungen zum Zwecke hatten. Als man hier sich eines Abends von der Hexerei und von einem Vampyr unterhielt, durch den ein junges Mädchen zu Florenz umgekommen seyn sollte, und als nun auch Lord Seymour aufgefordert wurde, seine Meinung mitzutheilen, sagte er: „Jedes Volk hat einen solchen Aberglauben, dem irgend etwas zum Grunde liegt, und wenn man von allen dem Schrecklichen, was den Leuten, die man Blutsauger nennt, zugeschrieben wird, den Schleier wegnehmen könnte; so würde man bald einsehen, daß der Schrecken, den sie einflößen, nur in einer Reihe von Unglücksfällen, die wir nicht zu erklären vermögen, seinen Grund hat. Ich erinnere mich hierbei einer morgenländischen Erzählung, die meine Meinung bestätigt und die ich jetzt mittheilen will.“
Der Vampyr von Bagdad
 icht fern von den Mauern der prächtigen Stadt Bagdad, lebte in einer kleinen Hütte, welche sich an ein Gehölz lehnte, ein armer Fischer, Namens Gia Hassan. Sein Fischergeräth und ein Paar Matten, welche seine Tochter Phaloe aus Binsen flocht, machten sein ganzes Vermögen aus; seinen Unterhalt verschaffte ihm der benachbarte Tigris. Täglich, wenn der Vater von seinem Morgen-Fange zurückkam, ging Phaloe in die Stadt, um dort die gefangenen Fische und zierliche Körbchen, die sie selbst geflochten hatte, zu verkaufen. Phaloe brauchte nie lange zu warten, um ihre Vorräthe abzusetzen. Sie war so hübsch, daß die Käufer haufenweise ihr zuströmten, und sie immer, nach kurzer Zeit mit dem Gewinne des Tages zu ihrem Vater zurückkehren konnte. Ein einfaches Mahl und ein Abendgebet beschloß dann ihren Tag, und so lebten Gia Hassan und Phaloe zwar arm, aber doch stets glücklich und zufrieden.“
icht fern von den Mauern der prächtigen Stadt Bagdad, lebte in einer kleinen Hütte, welche sich an ein Gehölz lehnte, ein armer Fischer, Namens Gia Hassan. Sein Fischergeräth und ein Paar Matten, welche seine Tochter Phaloe aus Binsen flocht, machten sein ganzes Vermögen aus; seinen Unterhalt verschaffte ihm der benachbarte Tigris. Täglich, wenn der Vater von seinem Morgen-Fange zurückkam, ging Phaloe in die Stadt, um dort die gefangenen Fische und zierliche Körbchen, die sie selbst geflochten hatte, zu verkaufen. Phaloe brauchte nie lange zu warten, um ihre Vorräthe abzusetzen. Sie war so hübsch, daß die Käufer haufenweise ihr zuströmten, und sie immer, nach kurzer Zeit mit dem Gewinne des Tages zu ihrem Vater zurückkehren konnte. Ein einfaches Mahl und ein Abendgebet beschloß dann ihren Tag, und so lebten Gia Hassan und Phaloe zwar arm, aber doch stets glücklich und zufrieden.“
„Es herrschte zu dieser Zeit der berühmte Kalif Harun al Raschid im Oriente, dessen Macht weniger durch seine Heere, als durch die unbegrenzte Liebe seiner Völker befestigt war, welche er sich dadurch erworben hatte, daß er alle Eigenschaften eines edlen und großen Fürsten in sich vereinigte. Noch ganz kürzlich hatte der Kalif die deutlichsten Beweise von der Liebe seiner Völker bekommen, indem ihn seine Unterthanen, bei der Rückkehr aus einem glorreich beendigten Kriege, nicht wie ihren Beherrscher, sondern wie einen allgeliebten Vater empfingen.“
„Unter der Leibwache des Harun al Raschid befand sich ein junger Mann, Namens Kaled, der, obgleich von seinen Vorgesetzten geliebt und ausgezeichnet, doch mehr Neigung zum Kaufmannsstande hatte und mit Sehnsucht eine günstige Gelegenheit erwartete, um von seinen Oberen das erste Erforderniß zur Befriedigung dieser Neigung, nämlich die Freiheit, zu erhalten.“
„Als dieser eines Tages vor dem Pallaste des Kalifen auf und ab ging, sah er ein junges Mädchen vorüber gehen, deren Anmuth und Schönheit, mehr aber noch deren Sittsamkeit und Bescheidenheit auf den ersten Blick sein Herz fesselten. „O heiliger Prophet,“ rief er, „wenn die Houris, die Du den Gläubigen verhießen hast, so viele Reize haben, wie diese junge Schöne, wie glücklich wirst du sie dann machen!“ und indem er dies sagte, folgte er dem jungen Mädchen nach, das leicht wie ein Reh vom Libanon zum Marktplatze eilte, wo sie ohne Zweifel ihre Bürde absetzen wollte. Ganz nahe an ihrem Ziele that die junge Schöne einen solchen Fehltritt, daß sie gewiß zur Erde gefallen seyn würde, wenn nicht Kaled, der dicht hinter ihr war, so glücklich gewesen wäre, sie in seinen Armen aufzufangen. Mehrere Körbchen voll Fische fielen ihr aus der Hand; aber einer ihrer gewöhnlichen Käufer, der sie sogleich erkannte, eilte nun auch herbei und sagte: „Wie beklage ich Dich, schöne Phaloe, daß Dir die Hülfe eines Freundes oder eines Bruders fehlt! Möchte doch unser heiligster Prophet Dir ein Muster von Ehemanne schicken, um Deine Tugend und Unschuld zu belohnen!“
„Phaloe hatte anfangs, in der Angst, daß sie fallen könnte, nicht auf den Fremden geachtet, der ihr zu Hülfe gekommen war; jetzt aber sah sie ihn an und ihre Stirn färbte sich glühend roth. Mit niedergeschlagenen Augen dankte sie schüchtern dem Fremden, der gegen ihre zu große Höflichkeit protestirte und durchaus nicht zugeben wollte, daß sie allein nach Hause zurückkehren sollte. Er rief den Kaufmann zum Bürgen für seine guten Absichten auf und sagte: „Ich bin Kaled, einer von der Leibwache des Kalifen, und Gott behüte mich, daß ich jemals ein vorwurfsfreies und von meinen Vorgesetzten gebilligtes Betragen nur im Mindesten beflecken sollte. Ich werde dies junge Mädchen begleiten und sie unversehrt in die Arme ihres Vaters zurückführen.“
„Schon hatte Phase ihre Waaren verkauft und schon war sie mit Kaled, auf dessen Arm sie sich erröthend stützte, vor die Thore der Stadt gekommen, wo sie, entfernt vom Gewühle der Menschen, nur den tausendstimmigen Gesang der Vögel und die brausenden Wogen des Tigris hörten, wo die ganze Natur aus ihren Herzen und zu ihren Herzen sprach; und dennoch sprach keiner von ihnen zu dem Andern, sondern Beide ließen ihre Umgebungen für sich reden und blickten sich auch nur zuweilen verstohlen an. In süße Gedanken versunken, erblickte Phaloe jetzt die väterliche Hütte und glaubte aus einem Traume zu erwachen. Noch zu sehr mit den Gefühlen beschäftigt, welche heute ihr Herz bewegten und ihr noch so ganz neu waren, vergaß sie das Lied zu singen, durch welches sie sonst dem Vater ihre Rückkehr zu verkündigen pflegte. Jetzt trat der Greis heraus und war, wie es schien, nicht wenig darüber beunruhigt, seine Tochter von einem Fremden begleitet zu sehen. Allein Kaled beruhigte ihn leicht, indem er ihm die Veranlassung erzählte; zugleich aber konnte er nicht unterlassen, seine Gefühle für Phaloe und die Hoffnung, mit welcher er sich schmeichelte, zu erkennen zu geben.“
„Kaled hatte eine äußerst glückliche Physiognomie und in seinen regelmäßigen Zügen lag der Ausdruck einer Sanftmuth, die selbst durch den Krieg nicht verloren hatte. Bald gewann er das Zutrauen des Greises und die Liebe der Tochter. Er kehrte öfter zu der Fischerhütte wieder und Phaloe, die ihn jedes Mal mit neuem Vergnügen sah, bemerkte kaum, daß er ihr zu ihrem Glücke unentbehrlich geworden war.“
„Eines Morgens kam Kaled früher als gewöhnlich; aber sein trauriges Gesicht ließ auch in voraus ahnden, daß etwas Ungewöhnliches geschehen sey. Phaloe zitterte, ohne zu wissen warum; Gia Hassan eilte auf die Stimme seiner Tochter so schnell als möglich herbei und Kaled sagte zu ihnen:
„Ihr wißt, weise Hoffnung ich seit einiger Zeit hegte; ihr wißt, daß ich darauf rechnete, in kurzer Zeit verabschiedet zu werden und alsdann meine Phaloe als Gattin heimführen zu können; ihr wißt, daß selbst mein Vorgesetzter mir dies versprochen hatte, und nun ist alle Hoffnung dahin! Als ich gestern Abend von ihr in die Stadt zurückkehrte, hatte sich dort schon die beunruhigende Nachricht verbreitet, daß uns ein bedeutender Krieg bevorstehe; und heute rüstet sich der Kalif schon, ins Feld zu rücken. O, Phaloe o, Hassan! ich muß ihn begleiten, ich muß euch verlassen, um euch vielleicht nie wieder zu sehen!“ — Sein Schmerz ließ ihn nicht weiter reden und auch Phaloe und Hassan vermochten kein Wort vor Betrübniß zu erwiedern. Endlich sprach Hassan tröstend zur weinenden Tochter: „Beunruhige Dich nicht zu sehr, mein Kind; vielleicht steht es für Dich noch nicht so schlimm, als Du glaubst. Der Kalif ist ja kein gefühlloser Tyrann; morgen will ich Dich zu ihm führen dann umfassen wir seine Kniee und Du bittest ihn, Dir den braven Kaled frei zu geben. Wenn der Anblick meines grauen Haares ihn nicht bewegen sollte; so wird sein edles, großmüthiges Herz doch Deiner Jugend, Deiner Schönheit und Deinen Thränen die Gewährung Deiner Bitte nicht versagen können.“
„So sprach Hassan und in die Brust der beiden Liebenden kehrte die Hoffnung, auf ihr Gesicht das Lächeln zurück, und von dieser neuen Hoffnung belebt, kehrte Kaled nach Bagdad zurück, wohin ihn sein Dienst rief, nachdem er und Phaloe sich noch einmal ewige, unerschütterliche Treue geschworen hatten. Gia Hassan freuete sich über ihre Liebe und segnete sie im Stillen, indem er auf sie die ganze Hoffnung seines Alters setzen mußte. Kaled mußte ihm versprechen, auf den Abend wieder zu kommen; Phaloe aber ging an diesem Tage nicht zur Stadt. Als ihr Geliebter sich entfernt hatte, kehrte ihre Unruhe zurück. Wenn der Kalif unerbittlich wäre. Wenn er das Flehen eines armen Fischers nicht hörte! Ach, bei diesen Gedanken empfand sie es deutlich, daß die Freuden der Liebe nicht ungestört und ungetrübt sind. In tiefes Nachdenken hierüber versunken, ging sie gegen Abend ganz unwillkührlich ihrem Geliebten entgegen. Sie war ganz allein in der weiten Ebene, als ein Fremder, in einen weiten Mantel gehüllt, sich ihr näherte und mit einer höchst gutmüthigen, mitleidigen Miene zu ihr sagte:
„Du weinst, schönes Kind? Wer kann so schöne Augen trüben? Beim Mahomed! Verderben treffe den Schändlichen, der Dich zu Thränen bringt!“ — „Ach, Herr der Kalif allein ist an meinem Kummer schuld!“ sagte Phaloe, und erzählte dem Fremden ganz unbefangen, was sie gehofft und was sie nun so erschreckt habe. Der Unbekannte bezeigte ihr, durch ihre Unschuld gerührt, seine ganze Theilnahme. Er nahm ein Stückchen Ziegelstein von der Erde auf, zeichnete ein Portrait darauf und sagte: „Nimm diese Zeichnung, liebe Phaloe, und wenn Du in den Palast des Kalifen kommst; so vergiß nicht, sie vorzuzeigen. Ich bin ein Officier von der Leibwache des Kalifen und ich werde gewiß mein Möglichstes thun, um ihn zu Deinen Gunsten zu stimmen.“ —
Darauf begleitete er die junge Schöne in die Fischerhütte und Phaloe stellte ihn ihrem Vater als den vor, der ihr beistehen und Kaled befreien wolle. Der Greis lud ihn ein, an ihrem einfachen Mahle Theil zu nehmen und der Officier nahm es dankbar an und aß und trank mit dem besten Appetite. Bald aber erhob er sich wieder und sagte: „Es thut mir leid, daß ich euch schon so früh wieder verlassen muß; aber mein Dienst ruft mich zum Fürsten. Lebt wohl, guter Freund! Leb wohl, reizende Phaloe, und vergiß nicht, was ich Dir empfohlen habe; auch erinnere Dich des Namens Nadir!“ Damit verließ er die Schwellen, indem er Phaloe’s Hand zärtlich in der seinigen drückte und verschwand.“
„Kaum hatte er die Hütte verlassen, so trat Kaled herein; der Fremde war ihm begegnet und hatte sorgfältig sein Gesicht vor ihm versteckt. Kaled liebt Phaloe von ganzem Herzen, er ist fest überzeugt, daß auch sie ihn wieder liebt; aber jung und feurig, wie er ist, kann er doch eine Regung der Eifersucht nicht bei sich unterdrücken. Seine Verwirrung, seine hastigen Fragen verrathen ihn und Phaloe erzählt ihm mit der größten Unbefangenheit den ganzen Hergang der Sache und kann die Theilnahme und das Mitleid des Fremden nicht genug rühmen.
„Hat sich denn dieser Menschenfreund nicht genannt?“ fragt Kaled. — „Mein Sohn,“ erwiedert Gia Hassan, „Nadir heißt er.“ — „Nadir?“ — „Ja, und er ist Officier bei der Leibwache des Kalifen.“ — „Er ist ein Betrüger, ein Schurke, ein Verräther. Nadir ist ja mein Chef und in diesem Augenblicke komme ich erst von ihm her, während der Fremde mir hier begegnet, Ach, beste Phaloe! ich vermuthete es wohl; Deine Thränen haben den Unbekannten angezogen, dessen Absichten mir nun schon bekannt sind. Ja, ich kenne ihn schon; er ist derselbe, den ich oft bei einbrechender Nacht auf den Straßen von Bagdad und am Ufer des Tigris habe umherschleichen sehen. Er ist ein höchst gefährliches Wesen, daran zweifle ich keinen Augenblick mehr. O, fürchtet ihn, fürchtet seine Absichten! Wißt ihr, wozu er fähig ist, welche Gefahren euch seine Gegenwart bringen kann? Glaubt mir, er ist ein Vampyr!“ —
„Ein Vampyr“ sagte Hassan. — „Ein Blutsauger?“ wiederholte die furchtsame Phaloe, indem sie ihrem Vater näher rückte. — „Ja, ein Blutsauger. Er ist eins jener Ungeheuer, die so lange Zeit ein Schrecken unsres Landes gewesen sind und deren Opfer so viele Liebende, so viele Eltern beweinen, Ach, dies Unglück fehlte mir noch, um mich vollends zur Verzweiflung zu bringen!“
„Der gute Alte und seine Tochter gaben sich alle Mühe, um Kaled zu beruhigen; aber unruhig wie alle Liebende, plagte den jungen Menschen schon wieder ein neuer Kummer. Der Kalif war nämlich am nächsten Tage nicht zu sprechen, weil er mit seinen Ministern dringende Verhandlungen vorzunehmen hatte, und so konnten also Hassan und Phaloe erst am nächst folgenden Tage zu ihm gehen.“
„Phaloe indeß zerstreuete auch diese Besorgnisse durch ihre Zuversicht; und wenn sie gleich keine Gründe für dieselbe hatte, so sagte ihr doch eine innere Ahndung, daß sie nicht fern mehr vom Ziele ihres Glücks und ihrer Wünsche sey.“
„Am folgenden Tage kam der Fremde schon früh Morgens wieder zu Hassans Hütte und Phaloe, die allein war, konnte sich eines heimlichen Schauderns nicht enthalten. — „Was fehlt Dir, schöne Phaloe? Du scheinst Dich zu fürchten.“ — „Ach, gnädiger Herr, wenn es wahr ist, was man sagt, so seyd Ihr ja ein furchtbares Wesen.“ — „Wie so?“ — „Ja, ein Ungeheuer“ „Wer hat Dir denn so schmeichelhafte Vorstellungen von mir beigebracht?“ — „Kaled.“ — „Kaled?“ — „Ja, Herr, er sagt, Ihr wäret ein Vampyr“ — „Ich, ein Vampyr Wie meint er das?“ — Mit Mühe unterdrückte der Fremde hier seinen Zorn und fuhr dann fort: „Kannst Du glauben, liebe Phaloe, daß ich Dir Leides thun werde? Mein Gesicht sieht doch nicht danach aus?“ — „Ach, dem Gesichte darf man nicht immer, trauen; die Menschen sind treulos!“ — „Nun gut, so geh zum Kalifen, Du wirst bald sehen, wie treulos ich bin; ich werde mich an Kaled rächen. Leb wohl!“ —
Damit verschwand er, wie am Abend vorher, und Phaloe fing an zu zittern, denn der Fremde sah sehr böse aus, als er den Namen Kaled aussprach. Unterdeß kehrte Gia Hassan zurück und Phaloe theilte ihm ihre Besorgniß mit, die diesmal nicht ohne Grund war. Langsam vergingen ihnen nun die Stunden des Tages; endlich wurde es Abend und Kaled erschien; aber als er eben den Fuß über die Schwelle der Hütte setzen wollte, fielen mehrere Soldaten, die im Gebüsche versteckt gewesen waren, über ihn her und entwaffneten ihn. Gia Hassan und Phaloe brachen in lautes Geschrei aus und warfen sich vergebens den Soldaten zu Füßen; man antwortet ihnen, daß Kaled auf Befehl des Kalifen verhaftet werde. Was sein Verbrechen sey, konnte Kaled nicht erfahren, die Soldaten wußten nur, daß er ins Gefängniß geführt, werten solle. Als Phaloe dies hörte, sank sie bewußtlos zu Boden; der arme Fischer bedeckte sie mit seinen Thränen und Kaled, der trotz seines Widerstrebens von den Soldaten weggeführt wurde, verlor alle Hoffnung.“
„Der folgende Tag war ein solcher, wo der Kalif, von seinen vornehmsten Officieren umgeben, im höchsten Glanze selbst zu Gericht saß, die Klagen seiner Unterthanen anhörte und Recht sprach. Man führte ihm den jungen Kaled vor, aus dessen Gesichte die Verzweiflung sprach und der mit ehrerbietigem Schweigen erwartete, daß er befragt werde. Um ihn her gab sich durch lautes, Murmeln eine lebhafte Theilnahme zu erkennen; doch er hörte nicht darauf und wagte nicht, die Augen aufzuschlagen. Ihm zur Seite stand ein junges, reich gekleidetes und verschleiertes Frauenzimmer, die kein Auge von ihm ließ; doch er dachte nur an sein Phaloe und ihre Sorgen.“
„Jetzt fragte man ihn: „Was hat Dir der Kalif zu Leide gethan, daß Du gewagt hast, Schmähungen gegen seine geheiligte Person auszustoßen? Antworte, Kaled!“
„Meine Dienste in dem Heere des Oberhauptes der Gläubigen und das Blut, welches ich für seine Sache vergossen habe, zeugen für meine treue Anhänglichkeit an seine geheiligte Person und meine Zunge hat nie anders geredet, als mein Herz fühlt; das schwöre ich beim Mahomed!“
„Du berufst Dich auf Deine Dienste und doch hast Du schon seit langer Zeit um Deine Befreiung nachgesucht.“
„Ich liebe Phaloe, die Tochter des Fischers Gia Hassan, und kann nicht ohne sie leben. Ich glaubte, daß ich meinem gnädigsten Herrn meine Schuld bezahlt hätte und nun wohl ihr allein gehören dürfte.“
„Ganz kürzlich hast Du Dir schwere Beschuldigungen gegen einen unbekannten zu Schulden kommen lassen.“
„Ein Fremder hatte sich bei meiner Geliebten eingeschlichen und ich hatte ihn in bösem Verdachte. Ich hielt ihn für einen Vampyr und das habe ich auch gesagt.“
„Nun, sieh her, hier steht der Vampyr!“
„O Himmel, der Kalif!“ rief Kaled und warf sich ihm zu Füßen.“
„Steh auf,“ sagte Harum al Raschid; „nimm tausend Beutel für Deine gute Aufführung, sey frei und heirathe Deine Phaloe.“
„Bei diesen Worten des Kalifen sah Kaleb um sich und erblickte in der jungen Schönen, die neben ihm stand und jetzt den Schleier aufgehoben hatte, seine Phaloe, die mit ihrem Vater dem Geliebten in die Arme sank. Voll dankbarer Rührung warfen sich alle drei dem Kalifen zu Füßen und das umstehende Volk gab durch laute Beifallsbezeugungen seine Freude über den Sieg der Liebe zu erkennen.“
🞯 🞯 🞯 🞯 🞯
Als der Minister seine Erzählung geendigt hatte, wurde ihm allgemeiner Beifall zu Theil und so stieg sein Ansehen und seine Gunst bei Hofe von Tage zu Tage immer höher und schon schien er am Ziele seiner Wünsche zu seyn, als ein unglückliches Ereignis eintrat, das indeß für ihn sehr günstig wurde und ihm neue Rechte auf das unumschränkte Vertrauen des Herzogs gab.
Die Prinzessin Eleonore hatte in ihren Zimmern ein Conzert gegeben, bei welchem der ganze Hof zugegen gewesen war. Spät in der Nacht erst hatte sich die Gesellschaft getrennt und zur Ruhe begeben; alle Lichter waren ausgelöscht und alle Diener lagen in tiefem Schlafe; da wurde der Herzog durch den dicken Rauch, womit sein Zimmer erfüllt war, aufgeweckt. Er konnte nicht mehr athmen und wollte seine Diener rufen und das Zimmer verlassen, deshalb stand er eiligst auf; allein kaum hatte er das Bette verlassen, als er bewußtlos zu Boden sank. Doch, in diesem Augenblicke trat ein wachsamer Diener herein, hob den Fürsten auf und brachte ihn in Sicherheit. Unterdeß brach eine schreckliche Feuersbrunst aus; ein verborgenes Feuer wurde zur verzehrenden Flamme und die Sturmglocke weckte die Schläfer zu einem schrecklichen Erwachen. Die Verwirrung war allgemein und bald lag ein glühender Aschenhaufen an der Stelle des prächtigen Palastes.
Nachdem die Unruhe vorüber war, wollte der Herzog wissen, wer ihn befreit und vom Ersticken gerettet habe. Der Minister, Lord Seymour selbst, war es gewesen. Der Fürst konnte ihm seine Sorgfalt nicht genug danken, er nahm ihn deshalb bei der Hand und führte ihn zu seiner Tochter und sagte, indem er ihn derselben vorstellte: „Dieser ist es, der mir das Leben gerettet hat; ich überlasse es Dir, seinen Lohn zu bestimmen und die Schuld Deines Vaters zu bezahlen.“ — Darauf entfernte er sich und ließ Lord Seymour mit seiner Tochter allein.
Die Prinzessin, durch die letzten Worte ihres Vaters verwirrt, stammelte einige Worte des Danks und fügte dann hinzu: „Das Andenken an den Dienst, welchen Sie meinem Vater geleistet haben, wird mir ewig heilig seyn; aber Sie müssen sich mit dem Gefühle meiner Dankbarkeit begnügen; denn welchen Lohn hätte ich für einen so allgeliebten Minister?“ — „Ach, gewiß giebt es einen Lohn, der freilich nicht zu den Ehrenbezeugungen des Hofs gehört.“ — „Und welchen?“ — „Von Ihnen allein hängt es ab, ob er mir zu Theil werden soll.“ — „Von mir?“ — „Meine Ehrerbietung, mein Eifer, mein Streben Ihnen zu gefallen, mein ängstliches Schweigen in Ihrer Nähe, das alles hätte Sie längst von meinen sehnlichsten Wünschen bekannt machen können.“ — „Mein Herr!“ — „Vielleicht werden Sie meine Wünsche verdammen und es zu kühn finden, daß ich sie bis zu Ihnen erhebe; aber verzeihen Sie mir, ich habe Ihres Vaters Leben gerettet, ich eilte dann in jener verhängnißvollen Stunde nach Ihren Zimmern, um auch Sie —“ —
„Wie? waren Sie es, der mich in jener schrecklichen Nacht dem gewissen Tode entriß?“ — „Was sagen Sie, gnädigste Prinzessin, wer hat Sie dem Tode entrissen, wann und wie? Erzählen Sie!“ — „Das Feuer machte reißende Fortschritte; Isine und Placida, meine Kammerfrauen, hatten mich verlassen, um Hülfe zu holen; von der Gefahr, die mich umgab, erschreckt, hatte ich den Gebrauch meiner Sinne verloren und glaubte mich auf immer meinem Vater entrissen, als ein Officier mich durch das Feuer rettete, mich den Armen meiner Frauen übergab und sich dann eiligst entfernte.“ — „Und wer war dieser Officier?“ — „Ich konnte ihn in der Verwirrung nicht erkennen.“ — „Hat sich denn auch kein Zeichen gefunden, wodurch man ihn entdecken könnte?“ — „Er verlor seinen Federbusch und dieser bewies mir, daß er ein Officier von der Leibwache seyn müsse; das ist aber alles, was ich von ihm weiß.“ —
„Wir müssen ihn zu entdecken suchen, Prinzessin; der Sohn des Herzogs Albini commandirt die Leibwache und wird uns dazu gewiß behülflich seyn können. Wer sein Leben für Sie wagte, kann nicht zu sehr belohnt werden; die größte Auszeichnung lohne ihm eine Gefahr, für die ich gern mein Leben, aufgeopfert hätte. Die Venetianer haben uns den Krieg erklärt; die Armee steht unter meinem Oberbefehle, und so will ich denn Ihrem kühnen Erretter das Commando in diesem Feldzuge geben. Er hat seinen Muth bewiesen und das ist für einen Feldherrn genug. Benachrichtigen Sie selbst, gnädigste Prinzessin, den jungen Albini hiervon; denn als Ihr Geschenk muß Ihr Erretter diesen Lohn empfangen. Wenn je das Zutrauen des Herzogs mir wünschenswerth gewesen ist, so wünsche ich vorzüglich jetzt, daß er mir seine Zufriedenheit nicht versagen wolle.“
Diese Großmuth des Ministers war weniger eine Folge von seinem aufrichtigen Wohlwollen und seiner Gerechtigkeitsliebe, als vielmehr davon, daß er in dem jungen Manne, der so aufmerksam über das Wohl der Prinzessin wachen konnte, einen gefährlichen Nebenbuhler vermuthete, den er aus ihrer Nähe zu entfernen wünschte. Die Prinzessin indes wurde dadurch getäuscht und war ganz von dem Edelmuthe des Ministers gerührt, als der junge Albini eintrat. Trauerflor verhüllte seine Waffen und ein heimlicher Kummer sprach aus seinen Zügen.
„Prinzessin,“ sprach er, „Sie haben mir befohlen, hier zu erscheinen; „ich bin zu Ihren Befehlen.“ — „Vor allen Dingen,“ erwiederte, die Prinzessin, „erlauben Sie mir, zu fragen, warum Ihre Waffen mit schwarzem Flor umwunden sind?“ — „Forschen Sie nicht nach einem Geheimnisse, Gnädigste, das ich nicht enthüllen darf; mir ist diese Trauer lieb und ich habe geschworen, sie nicht eher abzulegen, als bis ich einen verlorenen Federbusch wiederfinden werde.“ — „Ihren verlorenen Federbusch? Warten Sie, den kann man ja leicht durch einen andern ersetzen und ich selbst will Ihnen damit dienen.“ — „Wie, gnädigste Prinzessin“ — „Hier!“ — „O Himmel!“ — „Erkennen Sie ihn vielleicht?“ — „Gnädige Frau,“ sagte Albini verlegen, „nein — ich kann mich nicht erinnern ...“ — „Nicht?“ erwiederte Eleonore. „Und wem gehört er denn?“ — „Das sollen Sie vielleicht einst erfahren!“ —
„Albini,“ fiel der Minister ein, „der Officier, dem er gehört, steht unter Ihren Befehlen und Sie müssen ihn entdecken, denn das Heer erwartet, daß er sich der Ehre würdig zeige, welche die Prinzessin für ihn ausgewirkt hat.“ — „Hier, Albini,“ fügte die Prinzessin hinzu, „dies Papier enthält seine Belohnung, und so möge er mit Gott zu seiner Bestimmung abreisen!“ — „Sie befehlen und er wird sogleich reisen!“ — „Seinen Federbusch will ich behalten und ihm einst selbst zurückgeben. Für das Glück seiner Waffen und für sein Wohl werde ich beten.“ — „Auch für ihn wollen Sie beten!“ rief Albini sehr lehhaft, „so leben Sie denn wohl! Er wird für Sie sterben, oder einst als Sieger zurückkehren.“
Noch ehe der Tag zu Ende ging, erfuhr die Prinzessin, daß Albini zur Armee abgereiset wäre. Er war es also gewesen, der ihr das Leben gerettet hatte; doch warum verschwieg er es so geheimnisvoll? Seine Verwirrung, als er mit der Prinzessin sprach; auch wohl die Furcht, sich vor einem so bedeutenden Zeugen zu erklären, alles dies ließ seine Liebe zur Prinzessin vermuthen Und sein Schweigen gab den Gefühlen, die er nicht zu offenbaren wagte, noch einen höhern Werth.
Die Prinzessin aber war auch ein würdiger Gegenstand seiner Liebe; denn die vollendetste Schönheit erblickte man an ihr mit Grazie und Herzensgüte vereinigt. In tiefe Träume, deren Gegenstand Albini war, versunken, saß sie auf ihrem Zimmer, als der Herzog zu ihr trat und sie bat, dem Minister ihre Liebe zu schenken, dem er sie zur Gemahlin bestimmt habe. Der Wille des Vaters war für sie Befehl und da sie nichts einzuwenden wußte, versprach sie zu gehorchen. Der Minister, entzückt über ihre Einwilligung, gab die glänzendsten Feste und that alles, um ihr zu gefallen; und wirklich gelang es ihm, bei Eleonoren Interesse für sich zu erwecken, so daß ihre Verbindung ganz entschieden war.
Albini indeß zauderte nicht, seinen Muth zu beweisen und täglich erhielt der Hof die erfreulichsten Nachrichten über die Fortschritte des Heeres, welches er befehligte; aber, weit entfernt, seine braven Officiere zu belohnen, verschwendete man vielmehr, aus unbegreiflichen Ursachen, Ehrenbezeugungen aller Art an Aufrührer und Feinde des jungen Prinzen Albini, welche der Minister sehr in seinen Schutz nahm. Der Gouverneur des Pallastes hatte schon seit längerer Zeit umsonst versucht, das Ansehn und den Einfluß des Ministers bei dem Herzoge zu schwächen; dieser sah alles durch die Augen seines Ministers an und so blieb es, wie es war. Der Tag, welcher Lord Seymour mit der Prinzessin verbinden sollte, war indeß auch herangerückt; die glänzendsten Feste waren vorbereitet und mit einer Jagdparthie sollten die Feierlichkeiten der Vermählung beginnen.
Der Tag war schwül und die Pferde eilten eben so begierig, als die Jäger, dem nahen Walde entgegen, wo die Gesellschaft sich verteilte. Die Prinzessin entfernte sich von ihrem zahlreichen Gefolge und ruhete unter einem schattigen Gebüsche aus, wo sie sich Gedanken und Erinnerungen überließ, die sie noch nicht hatte verbannen können. Eine große Unruhe bewegte ihr Inneres; denn in wenig Stunden sollte sie nun mit Lord Seymour verbunden werden. Sie empfand zwar keinen Widerwillen gegen diese Verbindung; aber dennoch erweckte ein zärtliches Gefühl ihr Mitleid für den edlen Albini. Indem ihr Geist sich so wechselnden Gedanken und Gefühlen überließ, trat eine unbekannte zu ihr.
„Ich komme,“ sagte sie zu Eleonoren, „um Euch, schöne Prinzessin, das Leben zu retten. Fürchtet die Verbindung, welche Ihr schließen wollt, denn Euer Hochzeitstag wird auch Euer Todestag seyn. Der Gemahl, den Ihr gewählt habt, ist ein Ungeheuer, welches Euch in der ersten Umarmung das Leben rauben wird. Ihr erstaunt über meine Worte? Ach, es ist nur zu wahr, was ich Euch sage; ich selbst bin ja eins seiner unglücklichen Opfer. Folgt meiner Warnung und fliehet ein Unglück, das Euch schon zu erreichen droht; die Zeit wird Euch das Uebrige lehren.“
Eleonore, über das, was sie gehört hatte, höchst verwundert, wollte die Fremde, welche sich schnell entfernte, noch einmal zurückrufen; aber kaum war sie aus ihrem ersten Erstaunen zurückgekommen, als der ganze Hof sich um sie her versammelte und sie zur Rückkehr einlud.
In der Residenz nun folgten alle möglichen Lustbarkeiten auf einander; die Prinzessin aber, von einer unerklärlichen Furcht beseelt, vermied die Huldigungen des Hofes und verbarg sich in einer Maske, in welcher sie nicht fürchten durfte, erkannt zu werden. In dieser Verkleidung wurde sie dennoch von einer andern Maske angeredet, welche zu ihr sagte: „Vergebens, o angebetete Prinzessin, verbirgt Sie ein undurchdringlicher Schleier unsern Augen. Die meinigen haben Sie erkannt, und wie könnte man auch an diesem edlen Gange, dieser Grazie, dieser bezaubernden Leichtigkeit die schöne Eleonore verkennen? Verzeihen Sie einem Menschen, der Sie anbetet, ein Geständniß, das ihm das Leben kosten kann. Ach, als ich in Ihrer Nähe war, da unterdrückte ich das Geständniß meiner Liebe und zwang mich zum Schweigen; aber jetzt, wo Ihr Auge den Kühnen nicht erkennen kann, jetzt bewahrt meine Brust nicht länger das heiligste Geheimniß, um das Vergnügen zu haben, es Ihnen offenbaren zu können. Ach Eleonore! ...“ —
Bei diesen Worten nahm die Prinzessin, höchst erzürnt, dem Unbekannten die Maske vom Gesicht und entlarvt stand vor ihr und der ganzen Gesellschaft der junge Albini da. „Junger Mann,“ sagte der Herzog sehr ernst, „warum haben Sie ohne meinen Befehl die Armee verlassen?“ — „Gnädigster Herr,“ erwiederte Albini, „schon oft habe ich mein Leben für Sie gewagt. Der Muth, den ich durch nicht unrühmliche Thaten bewährt zu haben glaube, giebt mir ein Recht auf das Zutrauen meines Fürsten und ich bitte Sie, mir zu glauben, daß ich meine Soldaten nur verlassen habe, um Ihnen, gnädigster Herr, einen noch wichtigern Dienst zu leisten. Ich weiß zwar, daß man mich bei Ihnen verleumdet hat; ich kenne meinen Feind; aber weniger darauf bedacht, mich zu vertheidigen und vor seinen Streichen zu schützen, als vielmehr Sie selbst, gnädigster Herr, vor dem Unglücke zu warnen, dass Ihnen bevorsteht, komme ich, um hier den Minister feierlichst anzuklagen.“ —
„Wen klagen Sie an?“ fragte der Herzog. — „Lord Seymour, den Minister, der auf Verderben gegen Sie sinnt, klage ich an und Sie sollen die Zeugen seiner Verbrechen hören.“ — In diesem Augenblicke öffnete sich ein Vorhang auf dem erhöheten Sitze der Musikanten und Aubrey, Leonti und Nadur-Heli erschienen, als Troubadours gekleidet, und sangen erst Jeder eine Strophe, worin ein Jeder über das, was er verloren hatte, klagte; dann aber sangen alle Drei noch eine Strophe, in welcher sie auf den vornehmen Bösewicht, der sie Alle betrogen hatte, aufmerksam machten.
Kaum aber hatten sie diese Strophe geendigt, als Lord Seydmour wüthend auf sie zu eilte und sagte: „Schweigt, ihr unverschämten Abentheurer, die ihr nur hieher gekommen zu seyn scheint, um Zwietracht und Verleumdung in diesem Zirkel zu verbreiten!“ — „Ich erkenne in rief Aubrey laut, „Lord Seymour ist kein anderer als Lord Ruthwen, der meine Schwester gemordet hat!“ — „Er ist es,“ sagte Leonti, „der mir die geliebte Bettina geraubt hat!“ — „Ja,“ fügte Nadur-Heli hinzu, „es ist derselbe Bösewicht der Cymodora mir entführt und ums Leben gebracht hat.“ — „Er ist es,“ eine andere Stimme, „der den geheimen Befehl gegeben hat, Feuer im herzoglichen Pallaste anzulegen, weil er bei dieser Gelegenheit sich ein Verdienst um seinen Fürsten und den Schein der größten Aufmerksamkeit auf sein Wohl zu erwerben hoffte.“ — „Hütet euch vor dem Blutsauger!“ riefen viele Stimmen durch einander.
Erstaunen und Schrecken war auf allen Gesichtern verbreitet und man erwartete, daß jetzt etwas Außerordentliches geschehen werde. Der Herzog schien unruhig und unentschlossen, und schon konnte man in seinen Blicken lesen, daß er, noch nicht von den Beschuldigungen überzeugt, erst die Rechtfertigung seines Ministers hören wollte. Er befahl deshalb, das Fest nicht zu unterbrechen und alle Eingänge des Palastes zu bewachen, und hierauf begab er sich mit Lord Seymour in sein Kabinett. Wie viel Gewalt Letzterer schon über seinen Herrn erhalten habe, das zeigte sich hier ganz deutlich; denn in wenigen Augenblicken gelang es ihm nicht nur, sich selbst ganz zu rechtfertigen, sondern auch Jenen ganz nach seinen Wünschen zu stimmen, und so wurde denn bald nachher ein Befehl bekannt gemacht, wodurch der alte ehrwürdige Albini verbannt, Leonti, Nadur-Heli und Aubrey aber verhaftet wurden. Nun war auch der junge Albini überzeugt, daß er der Rache des Ministers aufgeopfert werden würde; sogleich eilte er daher, den Pallast zu verlassen, ehe er vielleicht noch seiner Freiheit beraubt würde, und bemerkte nicht, daß ihm Jemand eben so schnell folge.
Schon war er am Thore des Palastes, schon wollte er hinaustreten, als dieselben Soldaten, deren Anführer er so lange gewesen war, ihm den Weg vertraten und indem sie ihn umringten, zu ihm sagten: „O Ihr, unser würdiger Anführer, unser Wohlthäter, rechnet ganz auf uns; wir opfern freudig unser Leben für Euch auf, für Euch sind wir schon bewaffnet!“ — „Gegen wen?“ — „Gegen Eure Feinde.“ — „Meine Feinde sind die Feinde des Herzogs und Soldaten, wie ihr, müssen nur im Kriege für ihren Fürsten sich muthig zeigen.“ — „Euer Leben wird aber bedroht, und gern möchten wir es Euch aus Dankbarkeit retten.“ — „Das ist meiner Ehre zuwider.“ — „Wir sollten Euch arretiren.“ — „Nun, so gehorcht.“ — „Ja, der Minister hat es so befohlen —“ — „Und ich verbiete es euch, Soldaten!“ sagte die Prinzessin, welche jetzt hervortrat. — „Gnädigste Prinzessin, Sie selbst haben es ja so gewollt; was mich nur auch treffen mag, ich werde mich nicht über mein Schicksal beklagen“ — „Grausamer sind Sie noch nicht überzeugt, daß ich mich in Ihrer Person geirrt hatte? Albini, die Zeit ist kurz, fliehen Sie, ich beschwöre Sie darum!“ — „Wache, thut eure Pflicht.“ — „Unsere Pflicht ist Euch zu rächen; sagt nur, wen unsere Rache treffen soll!“ — „Ich habe euch bisher ein Beispiel der Tapferkeit gegeben; jetzt will ich euch auch ein Muster der Treue seyn. Der Befehl, den man euch gegeben hat, ist im Namen des Herzogs gegeben, deshalb gehorcht! Ich will es.“ — „O laßt Euch erbitten, gebt unserm Flehen wenigstens Gehör!“ — „Steht auf Cameraden,“ sagte Albini gerührt, „und thut, was ich fordere. Der Herzog hat befohlen, hier sind meine Waffen. Nun führt mich fort!“ —
„Vermögen auch Eleonorens Bitten den stolzen Albini nicht zu bewegen?“ — „Eleonore, ach! ...“ Nun stand er einen Augenblick still, als ob sein Entschluß noch schwankte, aber dann sagte er schnell gefaßt: „Leben Sie wohl, Prinzessin; ich fühle, daß es süß ist, durch Sie zu sterben.“
„Albini, der mich liebt, Albini, der mir das Leben gerettet hat, der auch mir so theuer ist, Albini stürzt durch meine Unvorsichtigkeit ins Verderben! An mir ist es jetzt, ihn zu retten!“ So sprach die Prinzessin und eilte auf ihre Zimmer zurück, wo sie tausend Pläne entwarf und zulegt die Hoffnung festhielt, ihren Vater durch Bitten zu bewegen. Die Nacht war vorüber, ohne daß Eleonore geschlafen hatte. Bleich und mit verweinten Augen trat sie, als der Tag angebrochen war, zu ihrem Vater und sagte:
„Lieber Vater, Albini, der Anführer Deiner Leibwache, der Befehlshaber des Heeres, dieser treue Krieger, der nur seinem Fürsten dient, ist am Thore des Palastes wie ein Verbrecher verhaftet. Ich komme, um Deine Gerechtigkeit anzuflehen für ihn.“ — „Wie kann meine Tochter an einem Schuldigen so viel Antheil nehmen?“ — „Er ist nicht schuldig“ — „Er hat seinen Posten bei dem Heere verlassen.“ — „Um uns eine wichtige Nachricht zu geben.“ — Er hat meinen Minister verleumdet.“ — „Es ist möglich, daß man ihn getäuscht hat.“ — „Er hat es gewagt, seine Liebe bis zu Dir zu erheben und sogar sie Dir zu gestehen.“ — „So ist doch wenigstens durch meine Hand der Schleier des Geheimnisses derselben gehoben.“ — „Dein Betragen macht auch Dich schuldig.“ — „Es rechtfertigt mich; denn wenn ich ihn gekannt hätte, so würde ich geschwiegen haben.“ —
„Es ist also wahr, daß Du diese unsinnige, Deiner unwürdige Liebe theilst; daß Du selbst dem Albini gestattet hast, des Nachts Dich hier im Schlosse zu sprechen; daß man seinen Federbusch in Deinem Zimmern gefunden hat?“ — „O Himmel! welche Lästerung! und Du kannst es dulden, daß Deine Tochter dergleichen erfahren muß?“ — „Die Wärme, mit welcher Du Albini vertheidigst, beweist mir hinreichend, daß er schuldig ist und mit seinem Leben soll er büßen!“ —
„Halt ein, mein Vater, und überzeuge Dich von meiner und von Albini’s Unschuld. Er war es, der bei jener Feuersbrunst mir das Leben gerettet hat; bei der Verwirrung verlor er seinen Federbusch, den ich aufhob, um daran einst meinen Erretter zu erkennen und ihn dann zu Dir zu führen. Laß Abini kommen, frage ihn selbst und Du wirst als erfahren und ihm wird Gerechtigkeit werden. Ach, erhöre das Flehen Deiner Tochter! Du bist gerührt, ich sehe es und fasse Hoffnung; ich werde sogleich den Beweis von Albinis Ergebenheit herbeiholen.“ —
Schnell eilte sie auf ihr Zimmer und fragte und suchte nach dem Federbusche; doch umsonst. In diesem Augenblicke brachte man ihr nun auch die Nachricht, daß der Minister ein Gericht versammelt habe, um Albini zu verurtheilen; hierdurch auf’s Neue erschreckt, erinnerte sie sich wieder an die Vorwürfe, welche der Herzog ihr gemacht hatte und dachte dann über den Zusammenhang dieser Umstände nach. Wer konnte es gewagt haben, ihr den Federbusch zu rauben? Nur ein einziger Mensch wußte um das Geheimniß und dieser hatte sich von der Eifersucht leicht bewegen lassen, sich desselben zu seiner Rache zu bedienen. Aber die Prinzessin war fest entschlossen, alles zu versuchen und alles zu wagen, um jene schändliche Verleumdung zu widerlegen; ihr Unwille gab ihr Kraft und schon schickte sie sich an, selbst vor die Richter zu treten, als der Minister zu ihr kam und ihr anzeigte, daß Albini verurtheilt sey.
„Was verlangen Sie denn von mir?“ — „Dieser ungerechte Spruch,“ sagte Eleonore, „wird nicht ausgeführt werden; ich selbst werde reden und Albini vertheidigen und mein Vater wird mich hören.“ — „Geben Sie diese Hoffnung auf, Prinzessin, der Herzog hat Albinis Verurtheilung schon bestätigt.“ — „Grausamer das ist Ihr Werk. Sie haben leider schon zu viel Macht an diesem Hofe; aber Sie sollen mir für Albini’s Leben haften. Sie müssen das gefällte Urtheil zurücknehmen.“ — „Sie verlangen von mir etwas, das dennoch meine Macht übersteigt.“ — „Nun, so begünstigen Sie wenigstens seine Flucht und geben Sie sogleich Befehl, daß man ihn frei lasse; oder fürchten Sie Alles von meiner Verzweiflung.“ — „Und wenn ich nun meine Pflicht sogar überträte, um Ihnen keine Bitte abzuschlagen, werden Sie auch dann noch dem Manne, der Sie liebt, keine Hoffnung geben?“ — „Daß Sie dem Willen Ihres Vaters Gehör geben, welcher uns noch heute am Altare verbunden zu sehen wünscht.“ — „Schreiben Sie den Befehl zu Albini’s Freilassung und ich willige in Alles!“ — „Sie wollen also wirklich?“ — „Ja, ich will.“ — „Gut dann, hier ist der Befehl, den Sie verlangen Heute Abend, gegen Mitternacht, werden auch Sie Ihr Versprechen in der Schloßkapelle halten!“ —
So wußte Lord Ruthwen mit der größten List alles nach seinem Willen zu leiten. Er bestimmte die Vorbereitungen zu seiner Verbindung und ordnete alles im Schlosse an, ohne den Herzog zu fragen, der in der That nur noch einen Schatten von Ansehn und Macht hatte. Aber gerade jetzt bemerkte man an dem Herzoge eine Unruhe, die nicht die beste Vorbedeutung für seinen Minister war. Er schien seine Gegenwart zu vermeiden, ihn ungern zu hören und mißtrauisch gegen seinen Rath zu werden. Mit einem einzigen Worte zwar könnte er das Joch zerbrechen, das er anfangs nicht für so drückend gehalten hatte; aber er hatte den Muth nicht, dies einzige Wort auszusprechen.
Während auf diese Weise im herzoglichen Pallaste alles auf einen entscheidenden Moment gespannt war, erwartete auch Albini, mit Ketten beladen, seine entscheidende Stunde. Ohne Furcht war er vor seinen Richtern erschienen; stolz auf seine Unschuld und auf seine Verdienste, war er begierig, sich zu rechtfertigen; als man ihm aber, nachdem man ihm schon seine Entfernung von der Armee zum Verbrechen gemacht hatte, nun auch seinen Federbusch, als einen Beweis seiner verbrecherischen Absichten auf die Prinzessin zeigte, da glaubte er, daß Eleonore sich gegen ihn erklärt habe und leistete auf jede Vertheidigung Verzicht.
Verurtheilt und ohne Hoffnung verdammt, klagte er in seinem Gefängnisse nur darüber, daß Eleonore gegen ihn gezeugt, und daß sie gerade solche Beweise gegen ihn vorgebracht habe, die sie doch an alles, was er für sie gethan hatte, hätten erinnern sollen. Während er noch hierüber klagte, trat Jemand in seinen Kerker, den er in der Finsterniß nicht sogleich erkennen konnte. „O, sage mir, unbekanntes Wesen,“ sprach Albini, „was Dich in diesen schrecklichen Kerker führt? Du seufzest, Du weinst; o, sag mir, wer bist Du?“ — „Kannst Du mich noch verkennen?“ — „O, Himmel. Eleonore.“ — „Ich komme, um Deine Ketten zu zerbrechen.“ — „Du selbst! an diesem Orte, in diesen Stunde?“ - „Ach, Du weißt nicht, wie viel mich Deine Freiheit kostet!“ — „O, sprich, Du himmlisches Wesen!“ — „Ich bringe Dir ein großes, ein fürchterliches Opfer, das noch schrecklicher durch meine Liebe zu Dir wird.“ — „Was werde ich hören müssen?“ — „Wisse, daß ich für Deine Befreiung das Versprechen habe geben müssen, mich mit Deinem Feinde zu verbinden.“ — „O, beim Himmel diese abscheuliche Verbindung, kann nicht, darf nicht vollzogen werden. Bedenke, daß Du Dein Leben dabei einbüßen wirst!“ — „Ich bedenke nur Deine Rettung und nun folge mir, oder seh mich hier zu Deinen Füßen sterben.“ — „Ja, ich will Dir folgen, denn eine neue Hoffnung steigt in mir auf. Ja, himmlisches, angebetetes Wesen, ich weiß noch eine Rettung für Dich und ich eile, sie herbei zu führen.“ — „Was willst Da thun?“ — „Kehre in das Schloß zurück. Morgen, wenn die Sonne aufgeht, sind wir gerächt, Leb wohl.“
Die Prinzessin konnte ihn nicht zurückhalten. Besorgt, daß seine Heftigkeit ihn auf’s neue in’s Verderben stürzen könnte, irrte sie lange in der Finsterniß der Nacht umher und kam erst spät in das Schloß zurück, wo man sie schon erwartet hatte, indem alles zu der bevorstehenden Feierlichkeit bereit war. Ihre Dienerinnen schmückten sie wider ihren Willen und bald darauf trat sie bleich und bestürzt in die verhängnisvolle Kapelle.
Der Herzog bemerkte ihren Zustand und beunruhigte sich darüber; der Minister aber schrieb ihn einem vorübergehenden Uebel zu und beschleunigte den Augenblick, der ihn, wie er sagte, zum Glücklichsten unter den Menschen machen sollte. Eleonore gehorchte dem Willen ihres Vaters und ihr Mund sprach das unwiderrufliche Ja aus. Nun noch ein Augenblick und die edle Freundin Albini’s muß ihren Geist auf dem bräutlichen Lager aufgeben, das nur zur Freude bereitet ist!
Am folgenden Morgen herrschte die größte Unruhe im herzoglichen Palaste. Man zeigte dem Fürsten an, daß seine Tochter dem Tode nahe sey und von Mitgefühl und inniger Theilnahme bewegt, versammlete sich das Volk im Gotteshause zu einem gemeinschaftlichen Gebete. Da trat eine weibliche Gestalt an den Altar, es war Bettina.
„Freunde,“ sprach sie zu der versammleten Menge, „ich habe in dieser Nacht die bedauernswürdige Eleonore vor dem ihr bevorstehenden Schicksale gewarnt, aber meine Worte sind todt in den Lüften verhallt, und als ich mich wieder entfernen wollte, fühlte ich mich plötzlich von einem vergifteten Pfeile getroffen. Ein Vampyr hat mich und eure Prinzessin gemordet und dieser Vampyr ist der Minister des Herzogs. Eleonore stirbt, ich sterbe; rächet sie und mich!“ —
So sprach sie und sank leblos an den Stufen des Altars nieder. Sogleich stürzte ein großer Haufen und mit diesem auch Leonti, zum Tempel hinaus, um das Werk der Rache zu vollziehen. Leonti eilte voran, erreichte Lord Ruthwen und durchbohrte ihn mit seinem Schwerdte; sogleich aber zog er das blutige Schwerdt wieder zurück und stürzte sich selbst hinein.
Der Tumult war schrecklich und tausendstimmig tönte das Rachegeschrei durch die Lüfte; da trat Albini an der Spitze der Soldaten vor, beruhigte das Volk und legte dann seine Waffen zu den Füßen des Herzogs nieder, dem er ewige Treue schwur. Seine Soldaten folgten seinem Beispiele, er selbst aber rieth, vor allen Dingen der Prinzessin zu Hülfe zu kommen. Doch, es war zu spät; denn schon hatte ihr sterbender Mund zum letzten Male Albinis Namen gerufen.
Die Trauer über einen so großen Verlust wurde täglich durch neue Unglückfälle vermehrt, indem noch mehrere der schönsten Frauen auf unbegreifliche Weise starben. Vergeblich erschöpfte man sich in Vermuthungen darüber, bis endlich Aubrey von neuem Verdacht gegen den scheinbar getödteten Vampyr erweckte. Man begab sich darauf an den Ort, wo Lord Ruthwens Körper beigesetzt war und öffnete das Grab. Da lag der Körper des Schändlichen. Eine gräßliche Blässe bedeckte sein Gesicht, und dennoch erblickte man deutliche Spuren des Lebens, Seine funkelnden Augen glänzten mit einem schrecklichen Ausdrucke und seine von Blut gefärbten Lippen zuckten noch, als ob sie sich an einem schrecklichen Genusse weideten.
Beim Anblicke dieses wunderbaren Zustandes schauderten alle Anwesenden zurück. Die Abgesandten des Hofs zeichneten diese Begebenheit auf, um die Erzählung von derselben in den Annalen von Modena zu bewahren; der Herzog aber befahl, als man ihn davon unterrichtet hatte, daß man, um neuen Unglücksfällen vorzubeugen, dem Ungeheuer mit einem glühenden Eisen die Augen ausbrennen und das Herz durchbohren sollte.
Nachdem dies geschehen war, hörten die Verwüstungen des Vampyrs auf. Der Herzog war über den Verlust seiner Tochter und über so viele Unglücksfälle, die er durch sein blindes Vertrauen auf Lord Seymour veranlaßt hatte, untröstlich. Er rief, um seine Fehler wieder gut zu machen, sogleich den alten Albini zurück und ernannte den Sohn desselben zu seinem Minister. Dieser überhäufte Aubrey und Nadur-Heli mit Wohlthaten und bewog sie, ganz in Modena zu bleiben. Nach langer Anstrengung gelang es ihm endlich auch, die Ruhe und das Glück seines Vaterlandes wieder herzustellen und für immer wird nun zu Modena sein Name mit Ehrfurcht und Dankbarkeit genannt.
E. T. A. Hoffmann: Vampirismus
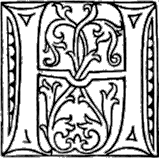 oho«, rief Lothar lachend, »ein Dichter wie du mein teurer Freund Sylvester, muß wohl bewandert sein in allen möglichen Zauber- und Hexengeschichten und andern Teufeleien, ja sich selbst was weniges auf das Zaubern und Hexen verstehen, da solches zu manchem Dichten und Trachten nützlich. Was nun insonderheit den Vampirismus betrifft, so will ich dir, damit du meine ungemeine Belesenheit in derlei Dingen erkennen mögest, gleich ein anmutiges Werklein anführen, aus dem du dich auf das vollständigste über diese dunkle Materie belehren kannst. Der vollständige Titel dieses Werkleins heißt: ›M. Michael Ranfts Diaconi zu Nebra, Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in Gräbern, worin die wahre Beschaffenheit derer Hungarischen Vampyrs und Blutsauger gezeigt, auch alle von dieser Materie bisher zum Vorschein gekommene Schriften rezensiert werden.‹ – Schon dieser Titel wird dich von der Gründlichkeit des genannten Werks überzeugen, und du wirst daraus entnehmen, daß ein Vampir nichts anders ist, als ein verfluchter Kerl, der sich als Toter einscharren läßt, und demnächst aus dem Grabe aufsteigt und den Leuten im Schlafe das Blut aussaugt, die dann auch zu Vampirs werden, so daß nach den Berichten aus Ungarn, die der Magister beibringt, sich die Bewohner ganzer Dörfer umsetzten in schändliche Vampirs. Um einen solchen Vampir unschädlich zu machen, muß er ausgegraben, ihm ein Pfahl durchs Herz geschlagen, und der Körper zu Asche verbrannt werden. Diese scheußlichen Kreaturen erscheinen oft nicht in eigner Gestalt, sondern en masque. So heißt es, wie ich mich sehr lebhaft erinnere, in einem Briefe, den ein Offizier aus Belgrad an einen berühmten Doktor nach Leipzig schrieb, um sich nach der eigentlichen Natur des Vampirismus zu erkundigen, ungefähr: ›In dem Dorfe, Kinklina genannt, hat es sich zugetragen, daß zwei Brüder von einem Vampir geplaget worden, weswegen einer um den andern gewachet, da es denn wie ein Hund die Türe geöffnet, auf Anschreien aber gleich wieder davongelaufen, bis endlich einmal beide eingeschlafen, da es denn dem einen in einem Augenblick einen roten Fleck unter dem rechten Ohr gesauget, worauf er denn in drei Tagen davon gestorben.‹ Zum Schluß sagt der Offizier: ›Weil man nun hier ein ungemeines Wunder daraus machet, als unterstehe mich Dero Partikular-Meinung mir gehorsamst auszubitten, ob solches sympathetischer, teuflischer oder astralischer Geister Wirkung sei, der ich mit vieler Hochachtung verharre etc.‹ Nimm dir ein Beispiel an diesem wißbegierigen Offizier. – Jetzt fällt mir sogar sein Name ein; es war der Fähndrich des Prinz Alexandrinischen Regiments, Sigismund Alexander Friedrich von Kottwitz. Überhaupt beschäftigte sich damals das Militär ganz ungemein mit dem Vampirismus. Eben in Magister Ranfts Werk befindet sich nämlich ein in gerichtlicher Form von Regimentsärzten in Gegenwart zweier Offiziere eben jenes Alexandrinischen Regiments aufgenommener Akt über die Auffindung und Vernichtung eines Vampirs. Unter andern heißt es in diesem Akt: ›Weil sie nun daraus ersehen, daß er ein wirklicher Vampir sei, so haben sie demselben einen Pfahl durchs Herz geschlagen, wobei er einen wohlvernehmlichen Gächzer getan und häufiges Geblüte von sich gelassen.‹ – Ist das nicht merkwürdig und lehrreich zugleich?« »Es mag«, erwiderte Sylvester, »es mag sich das alles im Magister Ranft nur abenteuerlich oder vielmehr aberwitzig ausnehmen, indessen erscheint, hält man sich an die Sache selbst, ohne den Vortrag zu beachten, der Vampirismus als eine der furchtbar grauenhaftesten Ideen, ja das furchtbar Grauenhafte dieser Idee artet aus ins Entsetzliche, scheußlich Widerwärtige.«
oho«, rief Lothar lachend, »ein Dichter wie du mein teurer Freund Sylvester, muß wohl bewandert sein in allen möglichen Zauber- und Hexengeschichten und andern Teufeleien, ja sich selbst was weniges auf das Zaubern und Hexen verstehen, da solches zu manchem Dichten und Trachten nützlich. Was nun insonderheit den Vampirismus betrifft, so will ich dir, damit du meine ungemeine Belesenheit in derlei Dingen erkennen mögest, gleich ein anmutiges Werklein anführen, aus dem du dich auf das vollständigste über diese dunkle Materie belehren kannst. Der vollständige Titel dieses Werkleins heißt: ›M. Michael Ranfts Diaconi zu Nebra, Traktat von dem Kauen und Schmatzen der Toten in Gräbern, worin die wahre Beschaffenheit derer Hungarischen Vampyrs und Blutsauger gezeigt, auch alle von dieser Materie bisher zum Vorschein gekommene Schriften rezensiert werden.‹ – Schon dieser Titel wird dich von der Gründlichkeit des genannten Werks überzeugen, und du wirst daraus entnehmen, daß ein Vampir nichts anders ist, als ein verfluchter Kerl, der sich als Toter einscharren läßt, und demnächst aus dem Grabe aufsteigt und den Leuten im Schlafe das Blut aussaugt, die dann auch zu Vampirs werden, so daß nach den Berichten aus Ungarn, die der Magister beibringt, sich die Bewohner ganzer Dörfer umsetzten in schändliche Vampirs. Um einen solchen Vampir unschädlich zu machen, muß er ausgegraben, ihm ein Pfahl durchs Herz geschlagen, und der Körper zu Asche verbrannt werden. Diese scheußlichen Kreaturen erscheinen oft nicht in eigner Gestalt, sondern en masque. So heißt es, wie ich mich sehr lebhaft erinnere, in einem Briefe, den ein Offizier aus Belgrad an einen berühmten Doktor nach Leipzig schrieb, um sich nach der eigentlichen Natur des Vampirismus zu erkundigen, ungefähr: ›In dem Dorfe, Kinklina genannt, hat es sich zugetragen, daß zwei Brüder von einem Vampir geplaget worden, weswegen einer um den andern gewachet, da es denn wie ein Hund die Türe geöffnet, auf Anschreien aber gleich wieder davongelaufen, bis endlich einmal beide eingeschlafen, da es denn dem einen in einem Augenblick einen roten Fleck unter dem rechten Ohr gesauget, worauf er denn in drei Tagen davon gestorben.‹ Zum Schluß sagt der Offizier: ›Weil man nun hier ein ungemeines Wunder daraus machet, als unterstehe mich Dero Partikular-Meinung mir gehorsamst auszubitten, ob solches sympathetischer, teuflischer oder astralischer Geister Wirkung sei, der ich mit vieler Hochachtung verharre etc.‹ Nimm dir ein Beispiel an diesem wißbegierigen Offizier. – Jetzt fällt mir sogar sein Name ein; es war der Fähndrich des Prinz Alexandrinischen Regiments, Sigismund Alexander Friedrich von Kottwitz. Überhaupt beschäftigte sich damals das Militär ganz ungemein mit dem Vampirismus. Eben in Magister Ranfts Werk befindet sich nämlich ein in gerichtlicher Form von Regimentsärzten in Gegenwart zweier Offiziere eben jenes Alexandrinischen Regiments aufgenommener Akt über die Auffindung und Vernichtung eines Vampirs. Unter andern heißt es in diesem Akt: ›Weil sie nun daraus ersehen, daß er ein wirklicher Vampir sei, so haben sie demselben einen Pfahl durchs Herz geschlagen, wobei er einen wohlvernehmlichen Gächzer getan und häufiges Geblüte von sich gelassen.‹ – Ist das nicht merkwürdig und lehrreich zugleich?« »Es mag«, erwiderte Sylvester, »es mag sich das alles im Magister Ranft nur abenteuerlich oder vielmehr aberwitzig ausnehmen, indessen erscheint, hält man sich an die Sache selbst, ohne den Vortrag zu beachten, der Vampirismus als eine der furchtbar grauenhaftesten Ideen, ja das furchtbar Grauenhafte dieser Idee artet aus ins Entsetzliche, scheußlich Widerwärtige.«
»Und«, fiel Cyprian dem Freunde ins Wort, »und demunerachtet kann aus dieser Idee ein Stoff hervorgehen, der von einem fantasiereichen Dichter, dem poetischer Takt nicht fehlt, behandelt, die tiefen Schauer jenes geheimnisvollen Grauens erregt, das in unserer eigenen Brust wohnt, und berührt von den elektrischen Schlägen einer dunkeln Geisterwelt den Sinn erschüttert, ohne ihn zu verstören. Eben der richtige poetische Takt des Dichters wird es hindern, daß das Grauenhafte nicht ausarte ins Widerwärtige und Ekelhafte; das dann aber meistenteils zugleich aberwitzig genug erscheint, um auch die leiseste Wirkung auf unser Gemüt zu verfehlen. Warum sollte es dem Dichter nicht vergönnt sein, die Hebel der Furcht, des Grauens, des Entsetzens zu bewegen? Etwa weil hie und da ein schwaches Gemüt dergleichen nicht verträgt? Soll starke Kost gar nicht aufgetragen werden, weil einige am Tische sitzen, die schwächlicher Natur sind oder sich den Magen verdorben haben.«
»Es bedarf », nahm Theodor das Wort, »es bedarf deiner Apologie des Grauenhaften gar nicht, mein lieber fantastischer Cyprianus! Wir wissen ja alle, wie wunderbar die größten Dichter vermöge jener Hebel das menschliche Gemüt in seinem tiefsten Innern zu bewegen wußten. Man darf ja nur an Shakespeare denken! – Und wer verstand sich auch darauf besser, als unser herrliche Tieck in mancher seiner Erzählungen. Ich will nur des Liebeszaubers erwähnen. Die Idee dieses Märchens muß in jeder Brust eiskalte Todesschauer, ja der Schluß das tiefste Entsetzen erregen, und doch sind die Farben so glücklich gemischt, daß trotz alles Grauens und Entsetzens uns doch der geheimnisvolle Zauberreiz des Tragischen befängt, dem wir uns willig und gern hingeben. Wie wahr ist das, was Tieck seinem Manfred in den Mund legt, um die Einwürfe der Frauen gegen das Schauerliche in der Poesie zu widerlegen. Ja wohl ist das Entsetzliche, was sich in der alltäglichen Welt begibt, eigentlich dasjenige, was die Brust mit unverwindlichen Qualen foltert, zerreißt. Ja wohl gebärt die Grausamkeit der Menschen das Elend, was große und kleine Tyrannen schonungslos mit dem teuflischen Hohn der Hölle schaffen, die echten Gespenstergeschichten. Und wie schön sagt nun der Dichter: ›In dergleichen märchenhaften Erfindungen aber kann ja dieses Elend der Welt nur wie von muntern Farben gebrochen hineinspielen, und ich dächte, auch ein nicht starkes Auge müßte es auf diese Weise ertragen!‹« – »Oft schon«, sprach Lothar, »gedachten wir des tiefen genialen Dichters, dessen Anerkennung in seiner ganzen hohen Vortrefflichkeit der Nachwelt vorbehalten bleibt, während schnell aufflackernde Irrlichter, die mit erborgtem Glanz das Auge im Augenblick zu blenden vermochten, ebenso schnell wieder verlöschen. – Übrigens meine ich, daß die Fantasie durch sehr einfache Mittel aufgeregt werden könne, und daß das Grauenhafte oft mehr im Gedanken, als in der Erscheinung beruhe. Kleists Bettelweib von Locarno trägt für mich wenigstens das Entsetzlichste in sich, was es geben mag, und doch, wie einfach ist die Erfindung! – Ein Bettelweib das man mit Härte hinter den Ofen weiset, wie einen Hund, und das gestorben, nun jeden Tag über den Boden wegtappt, und sich hinter den Ofen ins Stroh legt, ohne daß man irgend etwas erblickt! – Doch ist es auch freilich die wunderbare Färbung des Ganzen, welche so kräftig wirkt. Kleist wußte in jenen Farbentopf nicht allein einzutunken, sondern auch die Farben mit der Kraft und Genialität des vollendeten Meisters auftragend ein lebendiges Bild zu schaffen wie keiner. Er durfte keinen Vampir aus dem Grabe steigen lassen, ihm genügte ein altes Bettelweib.« – »Es ist«, nahm Cyprian das Wort, »es ist mir bei dem Gespräch über den Vampirismus eine gräßliche Geschichte eingefallen, die ich vor langer Zeit entweder las oder hörte. Doch glaube ich beinahe das letztere, denn wie ich mich erinnere, setzte der Erzähler hinzu, daß die Geschichte sich wirklich zugetragen, und nannte die gräfliche Familie und das Stammhaus, wo sich alles begeben. Sollte die Geschichte dennoch gedruckt und euch bekannt sein, so fallt mir nur gleich in die Rede, denn es gibt nichts Langweiligeres, als sich längst bekannte Dinge auftischen zu lassen.« – »Ich merke«, sprach Ottmar, »daß du wieder etwas sehr Tolles und Greuliches zu Markte bringen wirst; denke wenigstens an den heiligen Serapion, sei so kurz als du nur vermagst, um unsern Vinzenz zu Worte kommen zu lassen, der, wie ich merke, schon ungeduldig darauf harrt, uns das längst versprochene Märchen mitzuteilen.«
»Still, still«, rief Vinzenz. »Nichts Besseres kann ich mir wünschen, als daß Cyprian einen rechten schwarzen Teppich als Hintergrund aufhänge, auf dem dann die mimisch-plastische Darstellung meiner bunten, und wie ich meine, genugsam bocksspringenden Figuren sich ganz hübsch ausnehmen muß. Darum beginne, o mein Cyprianus, und sei düster, schrecklich, ja entsetzlich, trotz dem vampirischen Lord Byron, den ich nicht gelesen.«
»Graf Hyppolit«, so begann Cyprian, »war zurückgekehrt von langen weiten Reisen, um das reiche Erbe seines Vaters, der unlängst gestorben, in Besitz zu nehmen. Das Stammschloß lag in der schönsten, anmutigsten Gegend, und die Einkünfte der Güter reichten hin zu den kostspieligsten Verschönerungen. Alles, was der Art dem Grafen auf seinen Reisen, vorzüglich in England, als reizend, geschmackvoll, prächtig aufgefallen, sollte nun vor seinen Augen noch einmal entstehen. Handwerker und Künstler, wie sie gerade nötig, fanden sich auf seinen Ruf bei ihm ein, und es begann alsbald der Umbau des Schlosses, die Anlage eines weitläuftigen Parks in dem größten Stil, so daß selbst Kirche, Totenacker und Pfarrhaus eingegrenzt wurden und als Partie des künstlichen Waldes erschienen. Alle Arbeiten leitete der Graf, der die dazu nötigen Kenntnisse besaß, selbst, er widmete sich diesen Beschäftigungen mit Leib und Seele, und so war ein Jahr vergangen, ohne daß es ihm eingefallen, dem Rat eines alten Oheims gemäß in der Residenz sein Licht leuchten zu lassen vor den Augen der Jungfrauen, damit ihm die schönste, beste, edelste zufalle als Gattin. Eben saß er eines Morgens am Zeichentisch, um den Grundriß eines neuen Gebäudes zu entwerfen, als eine alte Baronesse, weitläuftige Verwandte seines Vaters, sich anmelden ließ. Hyppolit erinnerte sich, als er den Namen der Baronesse hörte, sogleich, daß sein Vater von dieser Alten immer mit der tiefsten Indignation, ja mit Abscheu gesprochen und manchmal Personen, die sich ihr nähern wollen, gewarnt, sich von ihr fernzuhalten, ohne jemals eine Ursache der Gefahr anzugeben. Befragte man den Grafen näher, so pflegte er zu sagen, es gäbe gewisse Dinge, über die es besser sei zu schweigen als zu reden. So viel war gewiß, daß in der Residenz dunkle Gerüchte von einem ganz seltsamen und unerhörten Kriminalprozeß gingen, in dem die Baronesse befangen, der sie von ihrem Gemahl getrennt, aus ihrem entfernten Wohnort vertrieben, und dessen Unterdrückung sie nur der Gnade des Fürsten zu verdanken habe. Sehr unangenehm berührt fühlte sich Hyppolit durch die Annäherung einer Person, die sein Vater verabscheut, waren ihm auch die Gründe dieses Abscheus unbekannt geblieben. Das Recht der Gastfreundschaft, das vorzüglich auf dem Lande gelten mag, gebot ihm indessen, den lästigen Besuch anzunehmen. Niemals hatte eine Person, ohne im mindesten häßlich zu sein, in ihrer äußern Erscheinung solch einen widerwärtigen Eindruck auf den Grafen gemacht, als eben die Baronesse. Bei dem Eintritt durchbohrte sie den Grafen mit einem glühenden Blick, dann schlug sie die Augen nieder und entschuldigte ihren Besuch in beinahe demütigen Ausdrücken. Sie klagte, daß der Vater des Grafen, von den seltsamsten Vorurteilen befangen, die ihm gegen sie feindlich Gesinnte auf hämische Weise beizubringen gewußt, sie bis in den Tod gehaßt und ihr, unerachtet sie in der bittersten Armut beinahe verschmachtet und sich ihres Standes schämen müssen, niemals auch nur die mindeste Unterstützung zufließen lassen. Endlich, ganz unerwartet in den Besitz einer kleinen Geldsumme gekommen, sei es ihr möglich geworden, die Residenz zu verlassen und in ein entferntes Landstädtchen zu fliehen. Auf dieser Reise habe sie dem Drange nicht widerstehen können, den Sohn eines Mannes zu sehen, den sie seines ungerechten unversöhnlichen Hasses unerachtet stets hochverehrt. – Es war der rührende Ton der Wahrheit, mit dem die Baronesse sprach, und der Graf fühlte sich um so mehr bewegt, als er, weggewandt von dem widrigen Antlitz der Alten, versunken war in den Anblick des wunderbar lieblichen anmutigen Wesens, das mit der Baronesse gekommen. Die Baronesse schwieg; der Graf schien es nicht zu bemerken, er blieb stumm. Da bat die Baronesse, es ihrer Befangenheit an diesem Orte zu verzeihen, daß sie dem Grafen nicht gleich bei ihrem Eintritt ihre Tochter Aurelie vorgestellt. Nun erst gewann der Graf Worte und beschwor, rot geworden bis an die Augen, in der Verwirrung des liebeentzückten Jünglings die Baronesse, sie möge ihm vergönnen, das gutzumachen, was sein Vater nur aus Mißverstand verschulden können, und vorderhand es sich auf seinem Schlosse gefallen lassen. Seinen besten Willen beteuernd, faßte er die Hand der Baronesse, aber das Wort, der Atem stockte ihm, eiskalte Schauer durchbebten sein Innerstes. Er fühlte seine Hand von im Tode erstarrten Fingern umkrallt, und die große knochendürre Gestalt der Baronesse, die ihn anstarrte mit Augen ohne Sehkraft, schien ihm in den häßlich bunten Kleidern eine angeputzte Leiche. ›O mein Gott, welch ein Ungemach gerade in diesem Augenblick!‹ So rief Aurelie und klagte dann mit sanfter herzdurchdringender Stimme, daß ihre arme Mutter zuweilen plötzlich vom Starrkrampf ergriffen werde, daß dieser Zustand aber gewöhnlich ohne Anwendung irgendeines Mittels in ganz kurzer Zeit vorüberzugehen pflege. Mit Mühe machte sich der Graf los von der Baronesse, und alles glühende Leben süßer Liebeslust kam ihm wieder, als er Aureliens Hand faßte und feurig an die Lippen drückte. Beinahe zum Mannesalter gereift, fühlte der Graf zum erstenmal die ganze Gewalt der Leidenschaft, um so weniger war es ihm möglich, seine Gefühle zu verbergen, und die Art, wie Aurelie dies aufnahm in hoher kindlicher Liebenswürdigkeit, entzündete in ihm die schönsten Hoffnungen. Wenige Minuten waren vergangen, als die Baronesse aus dem Starrkrampf erwachte und, sich des vorübergegangenen Zustandes völlig unbewußt, den Grafen versicherte, wie sie der Antrag, einige Zeit auf dem Schlosse zu verweilen, hoch ehre und alles Unrecht, das ihr der Vater angetan, mit einemmal vergessen lasse. So hatte sich nun plötzlich der Hausstand des Grafen verändert, und er mußte glauben, daß ihm, eine besondere Gunst des Schicksals die einzige auf dem ganzen Erdenrund zugeführt, die als heißgeliebte angebetete Gattin ihm das höchste Glück des irdischen Seins gewähren könne. Das Betragen der alten Baronesse blieb sich gleich, sie war still, ernst, ja, in sich verschlossen und zeigte, wenn es die Gelegenheit gab, eine milde Gesinnung und ein jeder unschuldigen Lust erschlossenes Herz. Der Graf hatte sich an das in der Tat seltsam gefurchte totenbleiche Antlitz, an die gespenstische Gestalt der Alten gewöhnt, er schrieb alles ihrer Kränklichkeit zu, sowie dem Hange zu düstrer Schwärmerei, da sie, wie er von seinen Leuten erfahren, oft nächtliche Spaziergänge machte durch den Park nach dem Kirchhofe zu. Er schämte sich, daß das Vorurteil des Vaters ihn so habe befangen können, und die eindringlichsten Ermahnungen des alten Oheims, das Gefühl, das ihn ergriffen, zu besiegen und ein Verhältnis aufzugeben, das ihn über kurz oder lang ganz unvermeidlich ins Verderben stürzen werde, verfehlten durchaus ihre Wirkung. Von Aureliens innigster Liebe auf das lebhafteste überzeugt, bat er um ihre Hand, und man kann denken, mit welcher Freude die Baronesse, die sich, aus tiefer Dürftigkeit gerissen, im Schoße des Glücks sah, diesen Antrag aufnahm. Die Blässe und jener besondere Zug, der auf einen schweren innern unverwindlichen Gram deutet, war verschwunden aus Aureliens Antlitz, und die Seligkeit der Liebe strahlte aus ihren Augen, schimmerte rosicht auf ihren Wangen. Am Morgen des Hochzeitstages vereitelte ein erschütternder Zufall die Wünsche des Grafen. Man hatte die Baronesse im Park unfern des Kirchhofes leblos am Boden auf dem Gesicht liegend gefunden und brachte sie nach dem Schlosse, eben als der Graf aufgestanden und im Wonnegefühl des errungenen Glücks hinausschaute. Er glaubte die Baronesse nur von ihrem gewöhnlichen Übel befallen; alle Mittel, sie wieder zurückzurufen ins Leben, blieben aber vergeblich, sie war tot. Aurelie überließ sich weniger den Ausbrüchen eines heftigen Schmerzes, als daß sie verstummt, tränenlos durch den Schlag, der sie getroffen, in ihrem innersten Wesen gelähmt schien. Dem Grafen bangte für die Geliebte, und nur leise und behutsam wagte er es, sie an ihr Verhältnis als gänzlich verlassenes Kind zu erinnern, welches erfordere, das Schickliche aufzugeben, um das noch Schicklichere zu tun, nämlich des Todes der Mutter unerachtet den Hochzeitstag soviel nur möglich zu beschleunigen: Da fiel aber Aurelie dem Grafen in die Arme und rief, indem ihr ein Tränenstrom aus den Augen stürzte, mit schneidender, das Herz durchbohrender Stimme: ›Ja – Ja! – um aller Heiligen, um meiner Seligkeit willen, ja!‹ – Der Graf schrieb diesen Ausbruch innerer Gemütsbewegung dem bittern Gedanken zu, daß sie verlassen, heimatslos nun nicht wisse wohin, und auf dem Schlosse zu bleiben doch der Anstand verbiete. Er sorgte dafür, daß Aurelie eine alte würdige Matrone zur Gesellschafterin erhielt, bis nach wenigen Wochen aufs neue der Hochzeitstag herankam, den weiter kein böser Zufall unterbrach, sondern der Hyppolits und Aureliens Glück krönte. Aurelie hatte sich indessen immerwährend in einem gespannten Zustande befunden. Nicht der Schmerz über den Verlust der Mutter, nein, eine innere, namenlose, tötende Angst schien sie rastlos zu verfolgen. Mitten im süßesten Liebesgespräch fuhr sie plötzlich, wie von jähem Schreck erfaßt, zum Tode erbleicht, auf, schloß den Grafen, indem ihr Tränen aus den Augen quollen, in ihre Arme, als wolle sie sich festhalten, damit eine unsichtbare feindliche Macht sie nicht fortreiße ins Verderben, und rief: ›Nein – nimmer – nimmer!‹ – Erst jetzt, da sie verheiratet mit dem Grafen, schien der gespannte Zustand aufgehört, jene innere entsetzliche Angst sie verlassen zu haben. Es konnte nicht fehlen, daß der Graf irgendein böses Geheimnis vermutete, von dem Aureliens Inneres verstört, doch hielt er es mit Recht für unzart, Aurelien darnach zu fragen, solange ihre Spannung anhielt und sie selbst darüber schwieg. Jetzt wagte er es, leise darauf hinzudeuten, was wohl die Ursache ihrer seltsamen Gemütsstimmung gewesen sein möge. Da versicherte Aurelie, daß es ihr eine Wohltat sei, ihm, dem geliebten Gemahl, jetzt ihr ganzes Herz zu erschließen. Nicht wenig erstaunte der Graf, als er nun erfuhr, daß nur das heillose Treiben der Mutter allen sinnverstörenden Gram über Aurelien gebracht. ›Gibt es‹, rief Aurelie, ›etwas Entsetzlicheres, als die eigne Mutter hassen, verabscheuen zu müssen?‹ Also war der Vater, der Oheim von keinem falschen Vorurteil befangen, und die Baronesse hatte mit durchdachter Heuchelei den Grafen getäuscht. Für eine seiner Ruhe günstige Schickung mußte es nun der Graf halten, daß die böse Mutter an seinem Hochzeitstage gestorben. Er hatte dessen kein Hehl; Aurelie erklärte aber, daß gerade bei dem Tode der Mutter sie sich von düstern furchtbaren Ahnungen ergriffen gefühlt, daß sie die entsetzliche Angst nicht verwinden können, die Tote werde erstehn aus dem Grabe und sie hinabreißen aus den Armen des Geliebten in den Abgrund. Aurelie erinnerte sich (so erzählte sie) ganz dunkel aus ihrer früheren Jugendzeit, daß eines Morgens, da sie eben aus dem Schlafe erwacht, ein furchtbarer Tumult im Hause entstand. Die Türen wurden auf- und zugeworfen, fremde Stimmen riefen durcheinander. Endlich als es stiller geworden, nahm die Wärterin Aurelien auf den Arm und trug sie in ein großes Zimmer, wo viele Menschen versammelt, in der Mitte auf einem langen Tisch ausgestreckt lag aber der Mann, der oft mit Aurelien gespielt, sie mit Zuckerwerk gefüttert, und den sie Papa genannt. Sie streckte die Händchen nach ihm aus und wollte ihn küssen. Die sonst warmen Lippen waren aber eiskalt, und Aurelie brach, selbst wußte sie nicht warum, aus in heftiges Weinen. Die Wärterin brachte sie in ein fremdes Haus, wo sie lange Zeit verweilte, bis endlich eine Frau erschien und sie in einer Kutsche mitnahm. Das war nun ihre Mutter, die bald darauf mit Aurelien nach der Residenz reiste. Aurelie mochte ungefähr sechzehn Jahre alt sein, als ein Mann bei der Baronesse erschien, den sie mit Freude und Zutraulichkeit empfing wie einen alten geliebten Bekannten. Er kam oft und öfter, und bald veränderte sich der Hausstand der Baronesse auf sehr merkliche Weise. Statt daß sie sonst in einem Dachstübchen gewohnt und sich mit armseligen Kleidern und schlechter Kost beholfen, bezog sie jetzt ein hübsches Quartier in der schönsten Gegend der Stadt, schaffte sich prächtige Kleider an, aß und trank mit dem Fremden, der ihr täglicher Tischgast war, vortrefflich und nahm teil an allen öffentlichen Lustbarkeiten, wie sie die Residenz darbot. Nur auf Aurelien hatte diese Verbesserung der Lage ihrer Mutter, die diese offenbar dem Fremden verdankte, gar keinen Einfluß. Sie blieb eingeschlossen in ihrem Zimmer zurück, wenn die Baronesse mit dem Fremden dem Vergnügen zueilte, und mußte so armselig einhergehen als sonst. Der Fremde hatte, unerachtet er wohl beinahe vierzig Jahre alt sein mochte, ein sehr frisches jugendliches Ansehen, war von hoher schöner Gestalt, und auch sein Antlitz mochte männlich schön genannt werden. Demunerachtet war er Aurelien widrig, weil oft sein Benehmen, schien er sich auch zu einem vornehmen Anstande zwingen zu wollen, linkisch, gemein, pöbelhaft wurde. Die Blicke, womit er aber Aurelien zu betrachten begann, erfüllten sie mit unheimlichem Grauen, ja mit einem Abscheu, dessen Ursache sie sich selbst nicht zu erklären wußte. Nie hatte bisher die Baronesse es der Mühe wert geachtet, Aurelien auch nur ein Wort über den Fremden zu sagen. Jetzt nannte sie Aurelien seinen Namen mit dem Zusatz, daß der Baron steinreich und ein entfernter Verwandter sei. Sie rühmte seine Gestalt, seine Vorzüge und schloß mit der Frage, wie er Aurelien gefalle. Aurelie verschwieg nicht den innern Abscheu, den sie gegen den Fremden hegte, da blitzte sie aber die Baronesse an mit einem Blick, der ihr tiefen Schreck einjagte, und schalt sie ein dummes einfältiges Ding. Bald darauf wurde die Baronesse freundlicher gegen Aurelien, als sie es jemals gewesen. Sie erhielt schöne Kleider, reichen modischen Putz jeder Art, man ließ sie teilnehmen an den öffentlichen Vergnügungen. Der Fremde bemühte sich nun um Aureliens Gunst auf eine Weise, die ihn nur immer widerwärtiger ihr erscheinen ließ. Tödlich wurde aber ihr zarter jungfräulicher Sinn berührt, als ein böser Zufall sie geheime Zeugin sein ließ einer empörenden Abscheulichkeit des Fremden und der verderbten Mutter. Als nun einige Tage darauf der Fremde in halbtrunknem Mut sie auf eine Art in seine Arme schloß, daß die verruchte Absicht keinem Zweifel unterworfen, da gab ihr die Verzweiflung Manneskraft, sie stieß den Fremden zurück, daß er rücklings überstürzte, entfloh und schloß sich in ihr Zimmer ein. Die Baronesse erklärte Aurelien ganz kalt und bestimmt, daß, da der Fremde ihren ganzen Haushalt bestritte und sie gar nicht Lust habe, zurückzukommen in die alte Dürftigkeit, hier jede alberne Ziererei verdrießlich und unnütz sein werde; Aurelie müsse sich dem Willen des Fremden hingeben, der sonst gedroht, sie zu verlassen. Statt auf Aureliens wehmütigstes Flehen, statt auf ihre heiße Tränen zu achten, begann die Alte, in frechem Spott laut auflachend, über ein Verhältnis, das ihr alle Lust des Lebens erschließen werde, auf eine Art zu sprechen, deren zügellose Abscheulichkeit jedem sittlichen Gefühl Hohn sprach, so daß Aurelie sich davor entsetzte. Sie sah sich verloren, und das einzige Rettungsmittel schien ihr schleunige Flucht. Aurelie hatte sich den Hausschlüssel zu verschaffen gewußt, die wenigen Habseligkeiten, die dringendste Notwendigkeit erforderte, zusammengepackt und schlich nach Mitternacht, als sie die Mutter in tiefem Schlaf glaubte, über den matt erleuchteten Vorsaal. Schon wollte sie leise, leise hinaustreten, als die Haustüre rasselnd aufsprang und es die Treppe hinaufpolterte. Hinein in den Vorsaal, hin zu Aureliens Füßen stürzte die Baronesse, in einen schlechten schmutzigen Kittel gekleidet, Brust und Ärme entblößt, das greise Haar aufgelöst, wild flatternd. Und dicht hinter ihr her der Fremde, der mit dem gellenden Ruf: ›Warte, verruchter Satan, höllische Hexe, ich werd' dir dein Hochzeitmahl eintränken!‹ sie bei den Haaren mitten ins Zimmer schleifte und mit dem dicken Knüttel, den er bei sich trug, auf die grausamste Weise zu mißhandeln begann. Die Baronesse stieß ein fürchterliches Angstgeschrei aus, Aurelie, ihrer Sinne kaum mächtig, rief laut durch das geöffnete Fenster nach Hilfe. Es traf sich, daß gerade eine Patrouille bewaffneter Polizei vorüberging. Diese drang sogleich ins Haus. ›Faßt ihn‹, rief die Baronesse, sich vor Wut und Schmerz krümmend, den Polizeisoldaten entgegen, ›faßt ihn – haltet ihn fest! – schaut seinen bloßen Rücken an! – es ist –‹ Sowie die Baronesse den Namen nannte, jauchzte der Polizei-Sergeant, der die Patrouille führte, laut auf: ›Hoho – haben wir dich endlich, Urian!‹ Und damit packten sie den Fremden fest und schleppten ihn, so sehr er sich sträuben mochte, fort. Dem allem, was sich zugetragen, unerachtet, hatte die Baronesse Aureliens Absicht doch sehr wohl bemerkt. Sie begnügte sich damit, Aurelien ziemlich unsanft beim Arm zu fassen, sie in ihr Zimmer zu werfen und dieses dann abzuschließen, ohne weiter etwas zu sagen. Andern Morgens war die Baronesse ausgegangen und kam erst am späten Abend wieder, während Aurelie, in ihr Zimmer wie in ein Gefängnis eingeschlossen, niemanden sah und hörte, so daß sie den ganzen Tag zubringen mußte ohne Speise und Trank. Mehrere Tage hintereinander ging das so fort. Oft blickte die Baronesse sie mit zornfunkelnden Augen an, sie schien mit einem Entschluß zu ringen, bis sie an einem Abend Briefe fand, deren Inhalt ihr Freude zu machen schien. ›Aberwitzige Kreatur, du bist an allem schuld, aber es ist nun gut, und ich wünsche selbst, daß die fürchterliche Strafe dich nicht treffen mag, die der böse Geist über dich verhängt hatte.‹ So sprach die Baronesse zu Aurelien, dann wurde sie wieder freundlicher, und Aurelie, die, da nun der abscheuliche Mensch von ihr gewichen, nicht mehr an die Flucht dachte, erhielt auch wieder mehr Freiheit. – Einige Zeit war vergangen, als eines Tages, da Aurelie gerade einsam in ihrem Zimmer saß, sich auf der Straße ein großes Geräusch erhob. Das Kammermädchen sprang hinein und berichtete, daß man eben den Sohn des Scharfrichters aus – vorbeibringe, der wegen Raubmord dort gebrandmarkt und nach dem Zuchthause gebracht, seinen Wächtern auf dem Transport aber entsprungen sei. Aurelie wankte, ergriffen von banger Ahnung, an das Fenster, sie hatte sich nicht betrogen, es war der Fremde, der, umringt von zahlreichen Wachen, auf dem Leiterwagen fest angeschlossen, vorübergefahren wurde. Man brachte ihn zurück zur Abbüßung seiner Strafe. Der Ohnmacht nahe, sank Aurelie zurück in den Lehnsessel, als der furchtbar wilde Blick des Kerls sie traf, als er mit drohender Gebärde die geballte Faust aufhob gegen das Fenster. – Immer noch war die Baronesse viel außer dem Hause, Aurelien ließ sie aber jedesmal zurück, und so führte sie von manchen Betrachtungen über ihr Schicksal, über das, was Bedrohliches, ganz unerwartet, plötzlich sie treffen könne, ein trübes trauriges Leben. Von dem Kammermädchen, das übrigens erst nach jenem nächtlichen Ereignis in das Haus gekommen, und der man nun erst wohl erzählt haben mochte, wie jener Spitzbube mit der Frau Baronesse in vertraulichem Verhältnis gelebt, erfuhr Aurelie, daß man in der Residenz die Frau Baronesse gar sehr bedaure, von einem solchen niederträchtigen Verbrecher auf solche verruchte Weise getäuscht worden zu sein. Aurelie wußte nur zu gut, wie ganz anders sich die Sache verhielt, und unmöglich schien es, daß wenigstens die Polizeisoldaten, welche damals den Menschen im Hause der Baronesse ergriffen, nicht, als diese ihn nannte und den gebrandmarkten Rücken angab als gewisses Kennzeichen des Verbrechers, von der guten Bekanntschaft der Baronesse mit dem Scharfrichtersohn überzeugt worden sein sollten. Daher äußerte sich denn auch jenes Kammermädchen bisweilen auf zweideutige Weise darüber, was man so hin und her denke, und daß man auch wissen wolle, wie der Gerichtshof strenge Nachforschung gehalten und sogar die gnädige Frau Baronesse mit Arrest bedroht haben solle, weil der verruchte Scharfrichtersohn gar Seltsames erzählt. – Aufs neue mußte die arme Aurelie der Mutter verworfene Gesinnung darin erkennen, daß es ihr möglich gewesen, nach jenem entsetzlichen Ereignis auch nur noch einen Augenblick in der Residenz zu verweilen. Endlich schien sie gezwungen, den Ort, wo sie sich von schmachvollem, nur zu gegründeten Verdacht verfolgt sah, zu verlassen und in eine entfernte Gegend zu fliehen. Auf dieser Reise kam sie nun in das Schloß des Grafen, und es geschah, was erzählt worden. Aurelie mußte sich überglücklich, aller böser Sorge entronnen, fühlen; wie tief entsetzte sie sich aber, als, da sie in diesem seligen Gefühl von der gnadenreichen Schickung des Himmels zur Mutter sprach, diese, Höllenflammen in den Augen, mit gellender Stimme rief: ›Du bist mein Unglück, verworfenes heilloses Geschöpf, aber mitten in deinem geträumten Glück trifft dich die Rache, wenn mich ein schneller Tod dahingerafft. In dem Starrkrampf, den deine Geburt mich kostet, hat die List des Satans‹ – hier stockte Aurelie, sie warf sich an des Grafen Brust und flehte, ihr es zu erlassen, das ganz zu wiederholen, was die Baronesse noch ausgesprochen in wahnsinniger Wut. Sie fühlte sich im Innern zermalmt, gedenke sie der fürchterlichen, jede Ahnung des Entsetzlichsten überbietenden Drohung der von bösen Mächten erfaßten Mutter. Der Graf tröstete die Gattin, so gut er es vermochte, unerachtet er selbst sich von kaltem Todesschauer durchbebt fühlte. Gestehen mußte er es sich, auch ruhiger geworden, daß die tiefe Abscheulichkeit der Baronesse doch, war sie auch gestorben, einen schwarzen Schatten in sein Leben warf, das ihm sonnenklar gedünkt.
Kurze Zeit war vergangen, als Aurelie sich gar merklich zu ändern begann. Während die Totenblässe des Antlitzes, das ermattete Auge auf Erkrankung zu deuten schien, ließ wieder Aureliens wirres, unstetes, ja scheues Wesen auf irgendein neues Geheimnis schließen, das sie verstörte. Sie floh selbst den Gemahl, schloß sich bald in ihr Zimmer ein, suchte bald die einsamsten Plätze des Parks und ließ sie sich dann wieder blicken, so zeugten die verweinten Augen, die verzerrten Züge des Antlitzes von irgendeiner entsetzlichen Qual, die sie gelitten. Vergebens mühte sich der Graf, die Ursache von dem Zustande der Gattin zu erforschen, und aus der völligen Trostlosigkeit, in die er endlich verfiel, konnte ihn nur die Vermutung eines berühmten Arztes retten, daß bei der großen Reizbarkeit der Gräfin all die bedrohlichen Erscheinungen eines veränderten Zustandes nur auf eine frohe Hoffnung der beglückten Ehe deuten könnten. Derselbe Arzt erlaubte sich, als er einst mit dem Grafen und der Gräfin bei Tische saß, allerlei Anspielungen auf jenen vermuteten Zustand guter Hoffnung. Die Gräfin schien alles teilnahmlos zu überhören, doch plötzlich war sie ganz aufmerksam, als der Arzt von den seltsamen Gelüsten zu sprechen begann, die zuweilen Frauen in jenem Zustande fühlten, und denen sie ohne Nachteil ihrer Gesundheit, ja, ohne die schädlichste Einwirkung auf das Kind nicht widerstehen dürften. Die Gräfin überhäufte den Arzt mit Fragen, und dieser wurde nicht müde, aus seiner praktischen Erfahrung die ergötzlichsten, drolligsten Fälle mitzuteilen. ›Doch‹, sprach er, ›hat man auch Beispiele von den abnormsten Gelüsten, durch die Frauen verleitet wurden zu der entsetzlichsten Tat. So hatte die Frau eines Schmieds ein solch unwiderstehliches Gelüste nach dem Fleisch ihres Mannes, daß sie nicht eher ruhte, als bis sie ihn einst, da er betrunken nach Hause kam, unvermutet mit einem großen Messer überfiel und so grausam zerfleischte, daß er nach wenigen Stunden den Geist aufgab.‹
Kaum hatte der Arzt diese Worte gesprochen, als die Gräfin ohnmächtig in den Sessel sank und aus den Nervenzufällen, die dann eintraten, nur mit Mühe gerettet werden konnte. Der Arzt sah nun, daß er sehr unvorsichtig gehandelt, im Beisein der nervenschwachen Frau jener fürchterlichen Tat zu erwähnen.
Wohltätig schien indessen jene Krise auf den Zustand der Gräfin gewirkt zu haben, denn sie wurde ruhiger, wiewohl bald darauf ein ganz seltsames starres Wesen, ein düstres Feuer in den Augen und die immer mehr zunehmende Totenfarbe den Grafen in neue gar quälende Zweifel über den Zustand der Gattin stürzte. Das Unerklärlichste dieses Zustandes der Gräfin lag aber darin, daß sie auch nicht das mindeste an Speise zu sich nahm, vielmehr gegen alles, vorzüglich aber gegen Fleisch, den unüberwindlichsten Abscheu bewies, so daß sie sich jedesmal mit den lebhaftesten Zeichen dieses Abscheues vom Tische entfernen mußte. Die Kunst des Arztes scheiterte, denn nicht das dringendste, liebevollste Flehen des Grafen, nichts in der Welt konnte die Gräfin vermögen, auch nur einen Tropfen Medizin zu nehmen. Da nun Wochen, Monate vergangen, ohne daß die Gräfin auch nur einen Bissen genossen, da es ein unergründliches Geheimnis, wie sie ihr Leben zu fristen vermochte, so meinte der Arzt, daß hier etwas im Spiele sei, was außer dem Bereich jeder getreu menschlichen Wissenschaft liege. Er verließ das Schloß unter irgendeinem Vorwande, der Graf konnte aber wohl merken, daß der Zustand der Gattin dem bewährten Arzt zu rätselhaft, ja zu unheimlich bedünkt, um länger zu harren und Zeuge einer unergründlichen Krankheit zu sein, ohne Macht zu helfen. Man kann es sich denken, in welche Stimmung dies alles den Grafen versetzen mußte; aber es war dem noch nicht genug. – Gerade um diese Zeit nahm ein alter treuer Diener die Gelegenheit wahr, dem Grafen, als er ihn gerade allein fand, zu entdecken, daß die Gräfin jede Nacht das Schloß verlasse und erst beim Anbruch des Tages wiederkehre. Eiskalt erfaßte es den Grafen. Nun erst dachte er daran, wie ihn seit einiger Zeit jedesmal zur Mitternacht ein ganz unnatürlicher Schlaf überfallen, den er jetzt irgendeinem narkotischen Mittel zuschrieb, das die Gräfin ihm beibringe, um das Schlafzimmer, das sie, vornehmer Sitte entgegen, mit dem Gemahl teilte, unbemerkt verlassen zu können. Die schwärzesten Ahnungen kamen in seine Seele; er dachte an die teuflische Mutter, deren Sinn vielleicht erst jetzt in der Tochter erwacht, an irgendein abscheuliches ehebrecherisches Verhältnis, an den verruchten Scharfrichterknecht. – Die nächste Nacht sollte ihm das entsetzliche Geheimnis erschließen, das allein die Ursache des unerklärlichen Zustandes der Gattin sein konnte. Die Gräfin pflegte jeden Abend selbst den Tee zu bereiten, den der Graf genoß, und sich dann zu entfernen. Heute nahm er keinen Tropfen, und als er seiner Gewohnheit nach im Bette las, fühlte er keineswegs um Mitternacht die Schlafsucht, die ihn sonst überfallen. Demunerachtet sank er zurück in die Kissen und stellte sich bald, als sei er fest eingeschlafen. Leise, leise verließ nun die Gräfin ihr Lager, trat an das Bett des Grafen, leuchtete ihm ins Gesicht und schlüpfte hinaus aus dem Schlafzimmer. Das Herz bebte dem Grafen, er stand auf, warf einen Mantel um und schlich der Gattin nach. Es war eine ganz mondhelle Nacht, so daß der Graf Aureliens in ein weißes Schlafgewand gehüllte Gestalt, unerachtet sie einen beträchtlichen Vorsprung gewonnen, auf das deutlichste wahrnehmen konnte. Durch den Park nach dem Kirchhofe zu nahm die Gräfin ihren Weg, dort verschwand sie an der Mauer. Schnell rannte der Graf hinter ihr her, durch die Pforte der Kirchhofsmauer, die er offen fand. Da gewahrte er im hellsten Mondesschimmer dicht vor sich einen Kreis furchtbar gespenstischer Gestalten. Alte halbnackte Weiber mit fliegendem Haar hatten sich niedergekauert auf den Boden, und mitten in dem Kreise lag der Leichnam eines Menschen, an dem sie zehrten mit Wolfesgier. – Aurelie war unter ihnen! – Fort stürzte der Graf in wildem Grausen und rannte besinnungslos, gehetzt von der Todesangst, von dem Entsetzen der Hölle, durch die Gänge des Parks, bis er sich am hellen Morgen, im Schweiß gebadet, vor dem Tor des Schlosses wiederfand. Unwillkürlich, ohne einen deutlichen Gedanken fassen zu können, sprang er die Treppe herauf, stürzte durch die Zimmer, hinein in das Schlafgemach. Da lag die Gräfin, wie es schien, in sanftem, süßem Schlummer, und der Graf wollte sich überzeugen, daß nur ein abscheuliches Traumbild, oder, da er sich der nächtlichen Wanderung bewußt, für die auch der von dem Morgentau durchnäßte Mantel zeugte, vielmehr eine sinnetäuschende Erscheinung ihn zum Tode geängstigt. Ohne der Gräfin Erwachen abzuwarten, verließ er das Zimmer, kleidete sich an und warf sich aufs Pferd. Der Spazierritt an dem schönen Morgen durch duftendes Gesträuch, aus dem heraus muntrer Gesang der erwachten Vögel ihn begrüßte, verscheuchte die furchtbaren Bilder der Nacht; getröstet und erheitert kehrte er zurück nach dem Schlosse. Als nun aber beide, der Graf und die Gräfin, sich allein zu Tische gesetzt, und diese, da das gekochte Fleisch aufgetragen, mit den Zeichen des tiefsten Abscheus aus dem Zimmer wollte, da trat die Wahrheit dessen, was er in der Nacht geschaut, gräßlich vor die Seele des Grafen. In wildem Grimm sprang er auf und rief mit fürchterlicher Stimme: ›Verfluchte Ausgeburt der Hölle, ich kenne deinen Abscheu vor des Menschen Speise, aus den Gräbern zerrst du deine Ätzung, teuflisches Weib!‹ Doch sowie der Graf diese Worte ausstieß, stürzte die Gräfin laut heulend auf ihn zu und biß ihn mit der Wut der Hyäne in die Brust. Der Graf schleuderte die Rasende von sich zur Erde nieder, und sie gab den Geist auf unter grauenhaften Verzuckungen. – Der Graf verfiel in Wahnsinn.«
»Ei,« sprach Lothar, nachdem es einige Augenblicke still gewesen unter den Freunden, »ei, mein vortrefflicher Cyprianus, du hast vortrefflich Wort gehalten. Gegen deine Geschichte ist der Vampirismus ein wahrer Kinderspaß, ein drolliges Fastnachtsspiel zum Totlachen. Nein, alles darin ist scheußlich interessant und mit Asa foetida so überreichlich gewürzt, daß ein überreizter Gaumen, dem alle gesunde natürliche Kost nicht mehr mundet, sich daran sehr erlustieren mag.«
»Und doch«, nahm Theodor das Wort, »hat unser Freund gar manches verschleiert und ist über anderes so schnell hinweggeschlüpft, daß es nur eine vorübergehende schreckhaft schauerliche Ahnung erregt, wofür wir ihm dankbar sein wollen. Ich erinnere mich nun wirklich, die gräßlich gespenstische Geschichte in einem alten Buche gelesen zu haben. Alles darin war aber mit weitschweifiger Genauigkeit erzählt, und es wurden vorzüglich die Abscheulichkeiten der Alten recht con amore auseinandergesetzt, so daß das Ganze einen überaus widerwärtigen Eindruck zurückließ, den ich lange nicht verwinden konnte. – Ich war froh, als ich das garstige Zeug vergessen, und Cyprian hätte mich nicht wieder daran erinnern sollen, wiewohl ich gestehen muß, daß er so ziemlich an unsern Schutzpatron, den heiligen Serapion, gedacht und uns tüchtige Schauer erregt hat, wenigstens beim Schluß. Wir wurden alle ein wenig blaß, am mehrsten aber der Erzähler selbst.«
»Nicht geschwind genug«, sprach Ottmar, »können wir hinwegkommen über das entsetzliche Bild, das, da es selbst nur zu grelle Figuren darstellt, nicht mehr, wie Vinzenz meinte, zum schwarzen Hintergrunde dienen kann. Laßt mich, um gleich einen tüchtigen Seitensprung zu tun, hinweg von dem Höllenbreughel, den uns Cyprianus vor Augen gebracht, während sich Vinzenz, wie ihr hört, recht ausräuspert, damit seine Rede fein glatt dem Munde entströme, euch zwei Worte über eine ästhetische Teegesellschaft sagen, an die mich ein kleines Blättchen erinnerte, das ich heute zufällig unter meinen Papieren vorfand. – Du erlaubst das auch, Freund Vinzenz?«
»Eigentlich«, erwiderte Vinzenz, »ist es aller serapiontischen Regel entgegen, daß ihr hin und her schwatzt – ja, nicht allein das, sondern auch daß ohne sonderlichen Anlaß ganz Unziemliches vorgebracht wird von graulichen Vampiren und andern höllischen Sachen, so daß ich schweigen muß, da ich schon den Mund geöffnet. – Doch rede, mein Ottmar! Die Stunden fliehen, und ich werde euch zum Trotz das letzte Wort behalten, wie eine zänkische Frau. Darum rede, mein Ottmar, rede.«
Théophile Gautier: La Morte Amoureuse
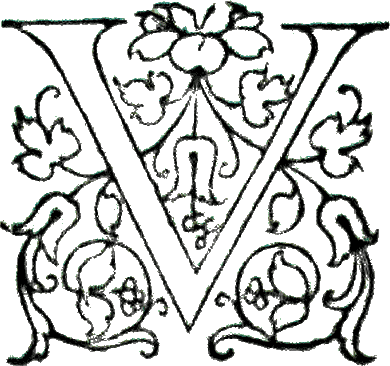 ous me demandez, frère, si j’ai aimé ; oui. C’est une histoire singulière et terrible, et, quoique j’aie soixante-six ans, j’ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferais pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges, que je ne puis croire qu’ils me soient arrivés. J’ai été pendant plus de trois ans le jouet d’une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j’ai mené en rêve toutes les nuits (Dieu veuille que ce soit un rêve !) une vie de damné, une vie de mondain et de Sardanapale. Un seul regard trop plein de complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme ; mais enfin, avec l’aide de Dieu et de mon saint patron, je suis parvenu à chasser l’esprit malin qui s’était emparé de moi. Mon existence s’était compliquée d’une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j’étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes ; la nuit, dès que j’avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant aux dés, buvant et blasphémant ; et lorsqu’au lever de l’aube je me réveillais, il me semblait au contraire que je m’endormais et que je rêvais que j’étais prêtre. De cette vie somnambulique il m’est resté des souvenirs d’objets et de mots dont je ne puis pas me défendre, et, quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt, à m’entendre, un homme ayant usé de tout et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop agités, qu’un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée, au fond d’un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle.
ous me demandez, frère, si j’ai aimé ; oui. C’est une histoire singulière et terrible, et, quoique j’aie soixante-six ans, j’ose à peine remuer la cendre de ce souvenir. Je ne veux rien vous refuser, mais je ne ferais pas à une âme moins éprouvée un pareil récit. Ce sont des événements si étranges, que je ne puis croire qu’ils me soient arrivés. J’ai été pendant plus de trois ans le jouet d’une illusion singulière et diabolique. Moi, pauvre prêtre de campagne, j’ai mené en rêve toutes les nuits (Dieu veuille que ce soit un rêve !) une vie de damné, une vie de mondain et de Sardanapale. Un seul regard trop plein de complaisance jeté sur une femme pensa causer la perte de mon âme ; mais enfin, avec l’aide de Dieu et de mon saint patron, je suis parvenu à chasser l’esprit malin qui s’était emparé de moi. Mon existence s’était compliquée d’une existence nocturne entièrement différente. Le jour, j’étais un prêtre du Seigneur, chaste, occupé de la prière et des choses saintes ; la nuit, dès que j’avais fermé les yeux, je devenais un jeune seigneur, fin connaisseur en femmes, en chiens et en chevaux, jouant aux dés, buvant et blasphémant ; et lorsqu’au lever de l’aube je me réveillais, il me semblait au contraire que je m’endormais et que je rêvais que j’étais prêtre. De cette vie somnambulique il m’est resté des souvenirs d’objets et de mots dont je ne puis pas me défendre, et, quoique je ne sois jamais sorti des murs de mon presbytère, on dirait plutôt, à m’entendre, un homme ayant usé de tout et revenu du monde, qui est entré en religion et qui veut finir dans le sein de Dieu des jours trop agités, qu’un humble séminariste qui a vieilli dans une cure ignorée, au fond d’un bois et sans aucun rapport avec les choses du siècle.
Oui, j’ai aimé comme personne au monde n’a aimé, d’un amour insensé et furieux, si violent que je suis étonné qu’il n’ait pas fait éclater mon cœur. Ah ! quelles nuits ! quelles nuits !
Dès ma plus tendre enfance, je m’étais senti vocation pour l’état de prêtre ; aussi toutes mes études furent-elles dirigées dans ce sens-là, et ma vie, jusqu’à vingt-quatre ans, ne fut-elle qu’un long noviciat. Ma théologie achevée, je passai successivement par tous les petits ordres, et mes supérieurs me jugèrent digne, malgré ma grande jeunesse, de franchir le dernier et redoutable degré. Le jour de mon ordination fut fixé à la semaine de Pâques.
Je n’étais jamais allé dans le monde ; le monde, c’était pour moi l’enclos du collège et du séminaire. Je savais vaguement qu’il y avait quelque chose que l’on appelait femme, mais je n’y arrêtais pas ma pensée ; j’étais d’une innocence parfaite. Je ne voyais ma mère vieille et infirme que deux fois l’an. C’étaient là toutes mes relations avec le dehors.
Je ne regrettais rien, je n’éprouvais pas la moindre hésitation devant cet engagement irrévocable ; j’étais plein de joie et d’impatience. Jamais jeune fiancé n’a compté les heures avec une ardeur plus fiévreuse ; je n’en dormais pas, je rêvais que je disais la messe ; être prêtre, je ne voyais rien de plus beau au monde : j’aurais refusé d’être roi ou poète. Mon ambition ne concevait pas au delà.
Ce que je dis là est pour vous montrer combien ce qui m’est arrivé ne devait pas m’arriver, et de quelle fascination inexplicable j’ai été la victime.
Le grand jour venu, je marchai à l’église d’un pas si léger, qu’il me semblait que je fusse soutenu en l’air ou que j’eusse des ailes aux épaules. Je me croyais un ange, et je m’étonnais de la physionomie sombre et préoccupée de mes compagnons ; car nous étions plusieurs. J’avais passé la nuit en prières, et j’étais dans un état qui touchait presque à l’extase. L’évêque, vieillard vénérable, me paraissait Dieu le Père penché sur son éternité, et je voyais le ciel à travers les voûtes du temple.
Vous savez les détails de cette cérémonie : la bénédiction, la communion sous les deux espèces, l’onction de la paume des mains avec l’huile des catéchumènes, et enfin le saint sacrifice offert de concert avec l’évêque. Je ne m’appesantirai pas sur cela. Oh ! que Job a raison, et que celui-là est imprudent qui ne conclut pas un pacte avec ses yeux ! Je levai par hasard ma tête, que j ’avais jusque- là tenue inclinée, et j’aperçus devant moi, si près que j’aurais pu la toucher, quoique en réalité elle fût à une assez grande distance et de l’autre côté de la balustrade, une jeune femme d’une beauté rare et vêtue avec une magnificence royale. Ce fut comme si des écailles me tombaient des prunelles. J’éprouvai la sensation d’un aveugle qui recouvrerait subitement la vue. L’évêque, si rayonnant tout à l’heure, s’éteignit tout à coup, les cierges pâlirent sur leurs chandeliers d’or comme les étoiles au matin, et il se fit par toute l’église une complète obscurité. La charmante créature se détachait sur ce fond d’ombre comme une révélation angélique ; elle semblait éclairée d’elle-même et donner le jour plutôt que le recevoir.
Je baissai la paupière, bien résolu à ne plus la relever pour me soustraire à l’influence des objets extérieurs ; car la distraction m’envahissait de plus en plus, et je savais à peine ce que je faisais.
Une minute après, je rouvris les yeux, car à travers mes cils je la voyais étincelante des couleurs du prisme, et dans une pénombre pourprée comme lorsqu’on regarde le soleil.
Oh ! comme elle était belle ! Les plus grands peintres, lorsque, poursuivant dans le ciel la beauté idéale, ils ont rapporté sur la terre le divin portrait de la Madone, n’approchent même pas de cette fabuleuse réalité. Ni les vers du poète ni la palette du peintre n’en peuvent donner une idée. Elle était assez grande, avec une taille et un port de déesse ; ses cheveux, d’un blond doux, se séparaient sur le haut de sa tête et coulaient sur ses tempes comme deux fleuves d’or ; on aurait dit une reine avec son diadème ; son front, dune blancheur bleuâtre et transparente, s’étendait large et serein sur les arcs de deux cils presque bruns, singularité qui ajoutait encore à l’effet de prunelles vert de mer d’une vivacité et d’un éclat insoutenables. Quels yeux ! avec un éclair ils décidaient de la destinée d’un homme ; ils avaient une vie, une limpidité, une ardeur, une humidité brillante que je n’ai jamais vues à un œil humain ; il s’en échappait des rayons pareils à des flèches et que je voyais distinctement aboutir à mon cœur. Je ne sais si la flamme qui les illuminait venait du ciel ou de l’enfer, mais à coup sûr elle venait de l’un ou de l’autre. Cette femme était un ange ou un démon, et peut-être tous les deux ; elle ne sortait certainement pas du flanc d’Ève, la mère commune. Des dents du plus bel orient scintillaient dans son rouge sourire, et de petites fossettes se creusaient à chaque inflexion de sa bouche dans le satin rose de ses adorables joues. Pour son nez, il était d’une finesse et d’une fierté toute royale, et décelait la plus noble origine. Des luisants d’agate jouaient sur la peau unie et lustrée de ses épaules à demi découvertes, et des rangs de grosses perles blondes, d’un ton presque semblable à son cou, lui descendaient sur la poitrine. De temps en temps elle redressait sa tête avec un mouvement onduleux de couleuvre ou de paon qui se rengorge, et imprimait un léger frisson à la haute fraise brodée à jour qui l’entourait comme un treillis d’argent.
Elle portait une robe de velours nacarat, et de ses larges manches doublées d’hermine sortaient des mains patriciennes d’une délicatesse infinie, aux doigts longs et potelés, et d’une si idéale transparence qu’ils laissaient passer le jour comme ceux de l’Aurore.
Tous ces détails me sont encore aussi présents que s’ils dataient d’hier, et, quoique je fusse dans un trouble extrême, rien ne m’échappait : la plus légère nuance, le petit point noir au coin du menton, l’imperceptible duvet aux commissures des lèvres, le velouté du front, l’ombre tremblante des cils sur les joues, je saisissais tout avec une lucidité étonnante.
A mesure que je la regardais, je sentais s’ouvrir dans moi des portes qui jusqu’alors avaient été fermées ; des soupiraux obstrués se débouchaient dans tous les sens et laissaient entrevoir des perspectives inconnues ; la vie m’apparaissait sous un aspect tout autre ; je venais de naître à un nouvel ordre d’idées. Une angoisse effroyable me tenaillait le cœur ; chaque minute qui s’écoulait me semblait une seconde et un siècle. La cérémonie avançait cependant, et j’étais emporté bien loin du monde dont mes désirs naissants assiégeaient furieusement l’entrée. Je dis oui cependant, lorsque je voulais dire non, lorsque tout en moi se révoltait et protestait contre la violence que ma langue faisait à mon âme : une force occulte m’arrachait malgré moi les mots du gosier. C’est là peut-être ce qui fait que tant de jeunes filles marchent à l’autel avec la ferme résolution de refuser d’une manière éclatante l’époux qu’on leur impose, et que pas une seule n’exécute son projet. C’est là sans doute ce qui fait que tant de pauvres novices prennent le voile, quoique bien décidées à le déchirer en pièces au moment de prononcer leurs vœux. On n’ose causer un tel scandale devant tout le monde ni tromper l’attente de tant de personnes ; toutes ces volontés, tous ces regards semblent peser sur vous comme une chape de plomb ; et puis les mesures sont si bien prises, tout est si bien réglé à l’avance, d’une façon si évidemment irrévocable, que la pensée cède au poids de la chose et s’affaisse complètement.
Le regard de la belle inconnue changeait d’expression selon le progrès de la cérémonie. De tendre et caressant qu’il était d’abord, il prit un air de dédain et de mécontentement comme de ne pas avoir été compris.
Je fis un effort suffisant pour arracher une montagne, pour m’écrier que je ne voulais pas être prêtre ; mais je ne pus en venir à bout ; ma langue resta clouée à mon palais, et il me fut impossible de traduire ma volonté par le plus léger mouvement négatif. J’étais, tout éveillé, dans un état pareil à celui du cauchemar, où l’on veut crier un mot dont votre vie dépend, sans en pouvoir venir à bout.
Elle parut sensible au martyre que j’éprouvais, et, comme pour m’encourager, elle me lança une œillade pleine de divines promesses. Ses yeux étaient un poème dont chaque regard formait un chant.
Elle me disait :
« Si tu veux être à moi, je te ferai plus heureux que Dieu lui-même dans son paradis ; les anges te jalouseront. Déchire ce funèbre linceul où tu vas t’envelopper ; je suis la beauté, je suis la jeunesse, je suis la vie ; viens à moi, nous serons l’amour. Que pourrait t’offrir Jéhovah pour compensation ? Notre existence coulera comme un rêve et ne sera qu’un baiser éternel.
Répands le vin de ce calice, et tu es libre. Je t’emmènerai vers les îles inconnues ; tu dormiras sur mon sein, dans un lit d’or massif et sous un pavillon d’argent ; car je t’aime et je veux te prendre à ton Dieu, devant qui tant de nobles cœurs répandent des flots d’amour qui n’arrivent pas jusqu’à lui. »
Il me semblait entendre ces paroles sur un rythme d’une douceur infinie, car son regard avait presque de la sonorité, et les phrases que ses yeux m’envoyaient retentissaient au fond de mon cœur comme si une bouche invisible les eût soufflées dans mon âme. Je me sentais prêt à renoncer à Dieu, et cependant mon cœur accomplissait machinalement les formalités de la cérémonie. La belle me jeta un second coup d’œil si suppliant, si désespéré, que des lames acérées me traversèrent le cœur, que je me sentis plus de glaives dans la poitrine que la mère de douleurs.
C’en était fait, j’étais prêtre.
Jamais physionomie humaine ne peignit une angoisse aussi poignante ; la jeune fille qui voit tomber son fiancé mort subitement a côté d’elle, la mère auprès du berceau vide de son enfant, Ève assise sur le seuil de la porte du paradis, l’avare qui trouve une pierre à la place de son trésor, le poète qui a laissé rouler dans le feu le manuscrit unique de son plus bel ouvrage, n’ont point un air plus atterré et plus inconsolable. Le sang abandonna complètement sa charmante figure, et elle devint d’une blancheur de marbre ; ses beaux bras tombèrent le long de son corps, comme si les muscles en avaient été dénoués, et elle s’appuya contre un pilier, car ses jambes fléchissaient et se dérobaient sous elle. Pour moi, livide, le front inondé d’une sueur plus sanglante que celle du Calvaire, je me dirigeai en chancelant vers la porte de l’église ; j’étouffais ; les voûtes s’aplatissaient sur mes épaules, et il me semblait que ma tête soutenait seule tout le poids de la coupole.
Comme j’allais franchir le seuil, une main s’empara brusquement de la mienne ; une main de femme ! Je n’en avais jamais touché. Elle était froide comme la peau d’un serpent, et l’empreinte m’en resta brûlante comme la marque d’un fer rouge. C’était elle. — « Malheureux ! malheureux ! qu’as-tu fait ? » me dit-elle à voix basse ; puis elle disparut dans la foule.
Le vieil évêque passa ; il me regarda d’un air sévère. Je faisais la plus étrange contenance du monde ; je pâlissais, je rougissais, j’avais des éblouissements. Un de mes camarades eut pitié de moi, il me prit et m’emmena ; j’aurais été incapable de retrouver tout seul le chemin du séminaire. Au détour d’une rue, pendant que le jeune prêtre tournait la tête d’un autre côté, un page nègre, bizarrement vêtu, s’approcha de moi, et me remit, sans s’arrêter dans sa course, un petit portefeuille à coins d’or ciselés, en me faisant signe de le cacher ; je le fis glisser dans ma manche et l’y tins jusqu’à ce que je fusse seul dans ma cellule. Je fis sauter le fermoir, il n’y avait que deux feuilles avec ces mots : « Clarimonde, au palais Concini. » J’étais alors si peu au courant des choses de la vie, que je ne connaissais pas Clarimonde, malgré sa célébrité, et que j’ignorais complètement où était situé le palais Concini. Je fis mille conjectures plus extravagantes les unes que les autres ; mais à la vérité, pourvu que je pusse la revoir, j’étais fort peu inquiet de ce qu’elle pouvait être, grande dame ou courtisane.
Cet amour né tout à l’heure s’était indestructiblement enraciné ; je ne songeai même pas à essayer de l’arracher, tant je sentais que c’était là chose impossible. Cette femme s’était complètement emparée de moi, un seul regard avait suffi pour me changer ; elle m’avait soufflé sa volonté ; je ne vivais plus dans moi, mais dans elle et par elle. Je faisais mille extravagances, je baisais sur ma main la place qu’elle avait touchée, et je répétais son nom des heures entières. Je n’avais qu’à fermer les yeux pour la voir aussi distinctement que si elle eût été présente en réalité, et je me redisais ces mots, qu’elle m’avait dits sous le portail de l’église : « Malheureux ! malheureux! qu’as-tu fait ? » Je comprenais toute l’horreur de ma situation, et les côtés funèbres et terribles de l’état que je venais d’embrasser se révélaient clairement à moi. Être prêtre ! c’est-à-dire chaste, ne pas aimer, ne distinguer ni le sexe ni l’âge, se détourner de toute beauté, se crever les yeux, ramper sous l’ombre glaciale d’un cloître ou d’une église, ne voir que des mourants, veiller auprès de cadavres inconnus et porter soi-même son deuil sur sa soutane noire, de sorte que l’on peut faire de votre habit un drap pour votre cercueil !
Et je sentais la vie monter en moi comme un lac intérieur qui s’enfle et qui déborde ; mon sang battait avec force dans mes artères ; ma jeunesse, si longtemps comprimée, éclatait tout d’un coup comme l’aloès qui met cent ans à fleurir et qui éclôt avec un coup de tonnerre.
Comment faire pour revoir Clarimonde ? Je n’avais aucun prétexte pour sortir du séminaire, ne connaissant personne dans la ville ; je n’y devais même pas rester, et j’y attendais seulement que l’on me désignât la cure que je devais occuper. J’essayai de desceller les barreaux de la fenêtre ; mais elle était à une hauteur effrayante, et n’ayant pas d’échelle, il n’y fallait pas penser. Et d’ailleurs je ne pouvais descendre que de nuit ; et comment me serais-je conduit dans l’inextricable dédale des rues ? Toutes ces difficultés, qui n’eussent rien été pour d’autres, étaient immenses pour moi, pauvre séminariste, amoureux d’hier, sans expérience, sans argent et sans habits.
Ah ! si je n’eusse pas été prêtre, j’aurais pu la voir tous les jours ; j’aurais été son amant, son époux, me disais-je dans mon aveuglement ; au lieu d’être enveloppé dans mon triste suaire, j’aurais des habits de soie et de velours, des chaînes d’or, une épée et des plumes comme les beaux jeunes cavaliers. Mes cheveux, au lieu d’être déshonorés par une large tonsure, se joueraient autour de mon cou en boucles ondoyantes. J’aurais une belle moustache cirée, je serais un vaillant. Mais une heure passée devant un autel, quelques paroles à peine articulées, me retranchaient à tout jamais du nombre des vivants, et j’avais scellé moi-même la pierre de mon tombeau, j’avais poussé de ma main le verrou de ma prison !
Je me mis à la fenêtre. Le ciel était admirablement bleu, les arbres avaient mis leur robe de printemps ; la nature faisait parade d’une joie ironique. La place était pleine de monde ; les uns allaient, les autres venaient ; de jeunes muguets et de jeunes beautés, couple par couple, se dirigeaient du côté du jardin et des tonnelles. Des compagnons passaient en chantant des refrains à boire ; c’était un mouvement, une vie, un entrain, une gaieté qui faisaient péniblement ressortir mon deuil et ma solitude. Une jeune mère, sur le pas de la porte, jouait avec son enfant ; elle baisait sa petite bouche rose, encore emperlée de gouttes de lait, et lui faisait, en l’agaçant, mille de ces divines puérilités que les mères seules savent trouver. Le père, qui se tenait debout à quelque distance, souriait doucement à ce charmant groupe, et ses bras croisés pressaient sa joie sur son cœur. Je ne pus supporter ce spectacle ; je fermai la fenêtre, et je me jetai sur mon lit avec une haine et une jalousie effroyables dans le cœur, mordant mes doigts et ma couverture comme un tigre à jeun depuis trois jours.
Je ne sais pas combien de jours je restai ainsi ; mais, en me retournant dans un mouvement de spasme furieux, j’aperçus l’abbé Sérapion qui se tenait debout au milieu de la chambre et qui me considérait attentivement. J’eus honte de moi-même, et, laissant tomber ma tête sur ma poitrine, je voilai mes yeux avec mes mains.
« Romuald, mon ami, il se passe quelque chose d’extraordinaire en vous, me dit Sérapion au bout de quelques minutes de silence ; votre conduite est vraiment inexplicable ! Vous, si pieux, si calme et si doux, vous vous agitez dans votre cellule comme une bête fauve. Prenez garde, mon frère, et n’écoutez pas les suggestions du diable ; l’esprit malin, irrité de ce que vous vous êtes à tout jamais consacré au Seigneur, rôde autour de vous comme un loup ravissant et fait un dernier effort pour vous attirer à lui. Au lieu de vous laisser abattre, mon cher Romuald, faites-vous une cuirasse de prières, un bouclier de mortifications, et combattez vaillamment l’ennemi ; vous le vaincrez. L’épreuve est nécessaire à la vertu et l’on sort plus fin de la coupelle. Ne vous effrayez ni ne vous découragez ; les âmes les mieux gardées et les plus affermies ont eu de ces moments. Priez, jeûnez, méditez, et le mauvais esprit se retirera. »
Le discours de l’abbé Sérapion me fit rentrer en moi-même, et je devins un peu plus calme. « Je venais vous annoncer votre nomination à la cure de C*** ; le prêtre qui la possédait vient de mourir, et monseigneur l’évêque m’a chargé d’aller vous y installer ; soyez prêt pour demain. » Je répondis d’un signe de tête que je le serais, et l’abbé se retira. J’ouvris mon missel et je commençai à lire des prières ; mais ces lignes se confondirent bientôt sous mes yeux ; le fil des idées s’enchevêtra dans mon cerveau, et le volume me glissa des mains sans que j’y prisse garde.
Partir demain sans l’avoir revue ! ajouter encore une impossibilité à toutes celles qui étaient déjà entre nous ! perdre à tout jamais l’espérance de la rencontrer, à moins d’un miracle ! Lui écrire ? par qui ferais-je parvenir ma lettre ? Avec le sacré caractère dont j’étais revêtu, à qui s’ouvrir, se fier ? J’éprouvais une anxiété terrible. Puis, ce que l’abbé Sérapion m’avait dit des artifices du diable me revenait en mémoire ; l’étrangeté de l’aventure la beauté surnaturelle de Clarimonde, l’éclat phosphorique de ses yeux, l’impression brûlante de sa main, le trouble où elle m’avait jeté, le changement subit qui s’était opéré en moi, ma piété évanouie en un instant, tout cela prouvait clairement la présence du diable, et cette main satinée n’était peut-être que le gant dont il avait recouvert sa griffe. Ces idées me jetèrent dans une grande frayeur, je ramassai le missel qui de mes genoux était roulé à terre, et je me remis en prières.
Le lendemain, Sérapion me vint prendre ; deux mules nous attendaient à la porte, chargées de nos maigres valises ; il monta l’une et moi l’autre tant bien que mal. Tout en parcourant les rues de la ville, je regardais à toutes les fenêtres et à tous les balcons si je ne verrais pas Clarimonde ; mais il était trop matin, et la ville n’avait pas encore ouvert les yeux. Mon regard tâchait de plonger derrière les stores et à travers les rideaux de tous les palais devant lesquels nous passions. Sérapion attribuait sans doute cette curiosité à l’admiration que me causait la beauté de l’architecture, car il ralentissait le pas de sa monture pour me donner le temps de voir. Enfin nous arrivâmes à la porte de la ville et nous commençâmes à gravir la colline. Quand je fus tout en haut, je me retournai pour regarder une fois encore les lieux où vivait Clarimonde. L’ombre d’un nuage couvrait entièrement la ville ; ses toits bleus et rouges étaient confondus dans une demi-teinte générale, où surnageaient çà et là, comme de blancs flocons d’écume, les fumées du matin. Par un singulier effet d’optique, se dessinait, blond et doré sous un rayon unique de lumière, un édifice qui surpassait en hauteur les constructions voisines, complètement noyées dans la vapeur ; quoiqu’il fût à plus d’une lieue, il paraissait tout proche. On en distinguait les moindres détails, les tourelles, les plates-formes, les croisées, et jusqu’aux girouettes en queue d’aronde.
« Quel est donc ce palais que je vois tout là-bas éclairé d’un rayon du soleil ? » demandai-je à Sérapion. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, et, ayant regardé, il me répondit : « C’est l’ancien palais que le prince Concini a donné à la courtisane Clarimonde ; il s’y passe d’épouvantables choses. »
En ce moment, je ne sais encore si c’est une réalité ou une illusion, je crus voir y glisser sur la terrasse une forme svelte et blanche qui étincela une seconde et s’éteignit. C’était Clarimonde !
Oh ! savait-elle qu’à cette heure, du haut de cet âpre chemin qui m’éloignait d’elle, et que je ne devais plus redescendre, ardent et inquiet, je couvais de l’œil le palais qu’elle habitait, et qu’un jeu dérisoire de lumière semblait rapprocher de moi, comme pour m’inviter à y entrer en maître ? Sans doute, elle le savait, car son âme était trop sympathiquement liée à la mienne pour n’en point ressentir les moindres ébranlements, et c’était ce sentiment qui l’avait poussée, encore enveloppée de ses voiles de nuit, à monter sur le haut de la terrasse, dans la glaciale rosée du matin.
L’ombre gagna le palais, et ce ne fut plus qu’un océan immobile de toits et de combles où l’on ne distinguait rien qu’une ondulation montueuse. Sérapion toucha sa mule, dont la mienne prit aussitôt l’allure, et un coude du chemin me déroba pour toujours la ville de S..., car je n’y devais pas revenir. Au bout de trois journées de route par des campagnes assez tristes, nous vîmes poindre à travers les arbres le coq du clocher de l’église que je devais desservir ; et, après avoir suivi quelques rues tortueuses bordées de chaumières et de courtils, nous nous trouvâmes devant la façade, qui n’était pas d’une grande magnificence. Un porche orné de quelques nervures et de deux ou trois piliers de grès grossièrement taillés, un toit en tuiles et des contreforts du même grès que les piliers, c’était tout : à gauche le cimetière tout plein de hautes herbes, avec une grande croix de fer au milieu ; à droite et dans l’ombre de l’église, le presbytère. C’était une maison d’une simplicité extrême et d’une propreté aride. Nous entrâmes ; quelques poules picotaient sur la terre de rares grains d’avoine ; accoutumées apparemment à l’habit noir des ecclésiastiques, elles ne s’effarouchèrent point de notre présence et se dérangèrent à peine pour nous laisser passer. Un aboi éraillé et enroué se fit entendre, et nous vîmes accourir un vieux chien.
C’était le chien de mon prédécesseur. Il avait l’œil terne, le poil gris et tous les symptômes de la plus haute vieillesse où puisse atteindre un chien. Je le flattai doucement de la main, et il se mit aussitôt à marcher à côté de moi avec un air de satisfaction inexprimable. Une femme assez âgée, et qui avait été la gouvernante de l’ancien curé, vint aussi à notre rencontre, et, après m’avoir fait entrer dans une salle basse, me demanda si mon intention était de la garder. Je lui répondis que je la garderais, elle et le chien, et aussi les poules, et tout le mobilier que son maître lui avait laissé à sa mort, ce qui la fit entrer dans un transport de joie, l’abbé Sérapion lui ayant donné sur-le-champ le prix qu’elle en voulait.
Mon installation faite, l’abbé Sérapion retourna au séminaire. Je demeurai donc seul et sans autre appui que moi-même. La pensée de Clarimonde recommença à m’obséder, et, quelques efforts que je fisse pour la chasser, je n’y parvenais pas toujours. Un soir, en me promenant dans les allées bordées de buis de mon petit jardin, il me sembla voir à travers la charmille une forme de femme qui suivait tous mes mouvements, et entre les feuilles étinceler les deux prunelles vert de mer ; mais ce n’était qu’une illusion, et, ayant passé de l’autre côté de l’allée, je n’y trouvai rien qu’une trace de pied sur le sable, si petit qu’on eût dit un pied d’enfant. Le jardin était entouré de murailles très hautes ; j’en visitai tous les coins et recoins, il n’y avait personne. Je n’ai jamais pu m’expliquer cette circonstance qui, du reste, n’était rien à côté des étranges choses qui me devaient arriver. Je vivais ainsi depuis un an, remplissant avec exactitude tous les devoirs de mon état, priant, jeûnant, exhortant et secourant les malades, faisant l’aumône jusqu’à me retrancher les nécessités les plus indispensables. Mais je sentais au dedans de moi une aridité extrême, et les sources de la grâce m’étaient fermées. Je ne jouissais pas de ce bonheur que donne l’accomplissement d’une sainte mission ; mon idée était ailleurs, et les paroles de Clarimonde me revenaient souvent sur les lèvres comme une espèce de refrain involontaire. O frère, méditez bien ceci ! Pour avoir levé une seule fois le regard sur une femme, pour une faute en apparence si légère, j’ai éprouvé pendant plusieurs années les plus misérables agitations : ma vie a été troublée à tout jamais.
Je ne vous retiendrai pas plus longtemps sur ces défaites et sur ces victoires intérieures toujours suivies de rechutes plus profondes, et je passerai sur-le-champ à une circonstance décisive. Une nuit l’on sonna violemment à ma porte. La vieille gouvernante alla ouvrir, et un homme au teint cuivré et richement vêtu, mais selon une mode étrangère, avec un long poignard, se dessina sous les rayons de la lanterne de Barbara. Son premier mouvement fut la frayeur ; mais l’homme la rassura, et lui dit qu’il avait besoin de me voir sur-le-champ pour quelque chose qui concernait mon ministère. Barbara le fit monter. J’allais me mettre au lit. L’homme me dit que sa maîtresse, une très grande dame, était à l’article de la mort et désirait un prêtre. Je répondis que j’étais prêt à le suivre ; je pris avec moi ce qu’il fallait pour l’extrême-onction et je descendis en toute hâte. A la porte piaffaient d’impatience deux chevaux noirs comme la nuit, et soufflant sur leur poitrail deux longs flots de fumée. Il me tint l’étrier et m’aida à monter sur l’un, puis il sauta sur l’autre en appuyant seulement une main sur le pommeau de la selle. Il serra les genoux et lâcha les guides à son cheval qui partit comme la flèche. Le mien, dont il tenait la bride, prit aussi le galop et se maintint dans une égalité parfaite. Nous dévorions le chemin ; la terre filait sous nous grise et rayée, et les silhouettes noires des arbres s’enfuyaient comme une armée en déroute. Nous traversâmes une forêt d’un sombre si opaque et si glacial, que je me sentis courir sur la peau un frisson de superstitieuse terreur. Les aigrettes d’étincelles que les fers de nos chevaux arrachaient aux cailloux laissaient sur notre passage comme une traînée de feu, et si quelqu’un, à cette heure de nuit, nous eût vus, mon conducteur et moi, il nous eût pris pour deux spectres à cheval sur le cauchemar. Des feux follets traversaient de temps en temps le chemin, et les choucas piaulaient piteusement dans l’épaisseur du bois où brillaient de loin en loin les yeux phosphoriques de quelques chats sauvages. La crinière des chevaux s’échevelait de plus en plus, la sueur ruisselait sur leurs flancs, et leur haleine sortait bruyante et pressée de leurs narines. Mais, quand il les voyait faiblir, l’écuyer pour les ranimer poussait un cri guttural qui n’avait rien d’humain, et la course recommençait avec furie. Enfin le tourbillon s’arrêta ; une masse noire piquée de quelques points brillants se dressa subitement devant nous ; les pas de nos montures sonnèrent plus bruyants sur un plancher ferré, et nous entrâmes sous une voûte qui ouvrait sa gueule sombre entre deux énormes tours. Une grande agitation régnait dans le château ; des domestiques avec des torches à la main traversaient les cours en tous sens, et des lumières montaient et descendaient de palier en palier. J’entrevis confusément d’immenses architectures, des colonnes, des arcades, des perrons et des rampes, un luxe de construction tout à fait royal et féerique. Un page nègre, le même qui m’avait donné les tablettes de Clarimonde et que je reconnus à l’instant, me vint aider à descendre, et un majordome, vêtu de velours noir avec une chaîne d’or au col et une canne d’ivoire à la main, s’avança au devant de moi. De grosses larmes débordaient de ses yeux et coulaient le long de ses joues sur sa barbe blanche. « Trop tard ! fit-il en hochant la tête, trop tard ! seigneur prêtre ; mais, si vous n’avez pu sauver l’âme, venez veiller le pauvre corps. » Il me prit par le bras et me conduisit à la salle funèbre ; je pleurais aussi fort que lui, car j’avais compris que la morte n’était autre que cette Clarimonde tant et si follement aimée. Un prie-Dieu était disposé à côté du lit ; une flamme bleuâtre voltigeant sur une patère de bronze jetait par toute la chambre un jour faible et douteux, et çà et là faisait papilloter dans l’ombre quelque arête saillante de meuble ou de corniche. Sur la table, dans une urne ciselée, trempait une rose blanche fanée dont les feuilles, à l’exception d’une seule qui tenait encore, étaient toutes tombées au pied du vase comme des larmes odorantes ; un masque noir brisé, un éventail, des déguisements de toute espèce, traînaient sur les fauteuils et faisaient voir que la mort était arrivée dans cette somptueuse demeure à l’improviste et sans se faire annoncer. Je m’agenouillai sans oser jeter les yeux sur le lit, et je me mis à réciter les psaumes avec une grande ferveur, remerciant Dieu qu’il eût mis la tombe entre l’idée de cette femme et moi, pour que je pusse ajouter à mes prières son nom désormais sanctifié. Mais peu à peu cet élan se ralentit, et je tombai en rêverie. Cette chambre n’avait rien d’une chambre de mort. Au lieu de l’air fétide et cadavéreux que j’étais accoutumé à respirer en ces veilles funèbres, une langoureuse fumée d’essences orientales, je ne sais quelle amoureuse odeur de femme, nageait doucement dans l’air attiédi. Cette pâle lueur avait plutôt l’air d’un demi-jour ménagé pour la volupté que de la veilleuse au reflet jaune qui tremblote près des cadavres. Je songeais au singulier hasard qui m’avait fait retrouver Clarimonde au moment où je la perdais pour toujours, et un soupir de regret s’échappa de ma poitrine. Il me sembla qu’on avait soupiré aussi derrière moi, et je me retournai involontairement. C’était l’écho. Dans ce mouvement, mes yeux tombèrent sur le lit de parade qu’ils avaient jusqu’alors évité. Les rideaux de damas rouge à grandes fleurs, relevés par des torsades d’or, laissaient voir la morte couchée tout de son long et les mains jointes sur la poitrine. Elle était couverte d’un voile de lin d’une blancheur éblouissante, que le pourpre sombre de la tenture faisait encore mieux ressortir, et d’une telle finesse qu’il ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ces belles lignes onduleuses comme le cou d’un cygne que la mort même n’avait pu roidir. On eût dit une statue d’albâtre faite par quelque sculpteur habile pour mettre sur un tombeau de reine, ou encore une jeune fille endormie sur qui il aurait neigé.
Je ne pouvais plus y tenir ; cet air d’alcôve m’enivrait, cette fébrile senteur de rose à demi fanée me montait au cerveau, et je marchais à grands pas dans la chambre, m’arrêtant à chaque tour devant l’estrade pour considérer la gracieuse trépassée sous la transparence de son linceul. D’étranges pensées me traversaient l’esprit ; je me figurais qu’elle n’était point morte réellement, et que ce n’était qu’une feinte qu’elle avait employée pour m’attirer dans son château et me conter son amour. Un instant même je crus avoir vu bouger son pied dans la blancheur des voiles, et se déranger les plis droits du suaire.
Et puis je me disais : « Est-ce bien Clarimonde ? quelle preuve en ai-je ? Ce page noir ne peut-il être passé au service d’une autre femme ? Je suis bien fou de me désoler et de m’agiter ainsi. » Mais mon cœur me répondit avec un battement : « C’est bien elle, c’est bien elle. » Je me rapprochai du lit, et je regardai avec un redoublement d’attention l’objet de mon incertitude. Vous l’avouerai-je ? cette perfection de formes, quoique purifiée et sanctifiée par l’ombre de la mort, me troublait plus voluptueusement qu’il n’aurait fallu, et ce repos ressemblait tant à un sommeil que l’on s’y serait trompé. J’oubliais que j’étais venu là pour un office funèbre, et je m’imaginais que j’étais un jeune époux entrant dans la chambre de la fiancée qui cache sa figure par pudeur et qui ne se veut point laisser voir. Navré de douleur, éperdu de joie, frissonnant de crainte et de plaisir, je me penchai vers elle et je pris le coin du drap ; je le soulevai lentement en retenant mon souffle de peur de l’éveiller. Mes artères palpitaient avec une telle force, que je les sentais siffler dans mes tempes, et mon front ruisselait de sueur comme si j’eusse remué une dalle de marbre. C’était en effet la Clarimonde telle que je l’avais vue à l’église lors de mon ordination ; elle était aussi charmante, et la mort chez elle semblait une coquetterie de plus. La pâleur de ses joues, le rose moins vif de ses lèvres, ses longs cils baissés et découpant leur frange brune sur cette blancheur, lui donnaient une expression de chasteté mélancolique et de souffrance pensive d’une puissance de séduction inexprimable ; ses longs cheveux dénoués, où se trouvaient encore mêlées quelques petites fleurs bleues, faisaient un oreiller à sa tête et protégeaient de leurs boucles la nudité de ses épaules ; ses belles mains, plus pures, plus diaphanes que des hosties, étaient croisées dans une attitude de pieux repos et de tacite prière, qui corrigeait ce qu’auraient pu avoir de trop séduisant, même dans la mort, l’exquise rondeur et le poli d’ivoire de ses bras nus dont on n’avait pas ôté les bracelets de perles. Je restai longtemps absorbé dans une muette contemplation, et, plus je la regardais, moins je pouvais croire que la vie avait pour toujours abandonné ce beau corps. Je ne sais si cela était une illusion ou un reflet de la lampe, mais on eût dit que le sang recommençait à circuler sous cette mate pâleur ; cependant elle était toujours de la plus parfaite immobilité. Je touchai légèrement son bras ; il était froid, mais pas plus froid pourtant que sa main le jour qu’elle avait effleuré la mienne sous le portail de l’église. Je repris ma position, penchant ma figure sur la sienne et laissant pleuvoir sur ses joues la tiède rosée de mes larmes. Ah ! quel sentiment amer de désespoir et d’impuissance ! quelle agonie que cette veille ! j’aurais voulu pouvoir ramasser ma vie en un monceau pour la lui donner et souffler sur sa dépouille glacée la flamme qui me dévorait. La nuit s’avançait, et, sentant approcher le moment de la séparation éternelle, je ne pus me refuser cette triste et suprême douceur de déposer un baiser sur les lèvres mortes de celle qui avait eu tout mon amour. Ô prodige ! un léger souffle se mêla à mon souffle, et la bouche de Clarimonde répondit à la pression de la mienne : ses yeux s’ouvrirent et reprirent un peu d’éclat, elle fit un soupir, et, décroisant ses bras, elle les passa derrière mon cou avec un air de ravissement ineffable. « Ah ! c’est toi, Romuald, dit-elle d’une voix languissante et douce comme les dernières vibrations d’une harpe ; que fais-tu donc ? Je t’ai attendu si longtemps, que je suis morte ; mais maintenant nous sommes fiancés, je pourrai te voir et aller chez toi. Adieu, Romuald, adieu ! je t’aime ; c’est tout ce que je voulais te dire, et je te rends la vie que tu as rappelée sur moi une minute avec ton baiser ; à bientôt. »
Sa tête retomba en arrière, mais elle m’entourait toujours de ses bras comme pour me retenir. Un tourbillon de vent furieux défonça la fenêtre et entra dans la chambre ; la dernière feuille de la rose blanche palpita quelque temps comme une aile a bout de la tige, puis elle se détacha et s’envola par la croisée ouverte, emportant avec elle l’âme de Clarimonde. La lampe s’éteignit et je tombai évanoui sur le sein de la belle morte.
Quand je revins à moi, j’étais couché sur mon lit, dans ma petite chambre du presbytère, et le vieux chien de l’ancien curé léchait ma main allongée hors de la couverture. Barbara s’agitait dans la chambre avec un tremblement sénile, ouvrant et fermant des tiroirs, ou remuant des poudres dans des verres. En me voyant ouvrir les yeux, la vieille poussa un cri de joie, le chien jappa et frétilla de la queue ; mais j’étais si faible, que je ne pus prononcer une seule parole ni faire aucun mouvement. J’ai su depuis que j’étais resté trois jours ainsi, ne donnant d’autre signe d’existence qu’une respiration presque insensible. Ces trois jours ne comptent pas dans ma vie, et je ne sais où mon esprit était allé pendant tout ce temps ; je n’en ai gardé aucun souvenir. Barbara m’a conté que le même homme au teint cuivré, qui m’était venu chercher pendant la nuit, m’avait ramené le matin dans une litière fermée et s’en était retourné aussitôt. Dès que je pus rappeler mes idées, je repassai en moi-même toutes les circonstances de cette nuit fatale. D’abord je pensai que j’avais été le jouet d’une illusion magique ; mais des circonstances réelles et palpables détruisirent bientôt cette supposition. Je ne pouvais croire que j’avais rêvé, puisque Barbara avait vu comme moi l’homme aux deux chevaux noirs et qu’elle en décrivait l’ajustement et la tournure avec exactitude. Cependant personne ne connaissait dans les environs un château auquel s’appliquât la description du château où j’avais retrouvé Clarimonde.
Un matin je vis entrer l’abbé Sérapion. Barbara lui avait mandé que j’étais malade, et il était accouru en toute hâte. Quoique cet empressement démontrât de l’affection et de l’intérêt pour ma personne, sa visite ne me fit pas le plaisir qu’elle m’aurait dû faire. L’abbé Sérapion avait dans le regard quelque chose de pénétrant et d’inquisiteur qui me gênait. Je me sentais embarrassé et coupable devant lui. Le premier il avait découvert mon trouble intérieur, et je lui en voulais de sa clairvoyance.
Tout en me demandant des nouvelles de ma santé d’un ton hypocritement mielleux, il fixait sur moi ses deux jaunes prunelles de lion et plongeait comme une sonde ses regards dans mon âme. Puis il me fit quelques questions sur la manière dont je dirigeais ma cure, si je m’y plaisais, à quoi je passais le temps que mon ministère me laissait libre, si j’avais fait quelques connaissances parmi les habitants du lieu, quelles étaient mes lectures favorites, et mille autres détails semblables. Je répondais à tout cela le plus brièvement possible, et lui-même sans attendre que j’eusse achevé, passait à autre chose. Cette conversation n’avait évidemment aucun rapport avec ce qu’il voulait dire. Puis, sans préparation aucune, et comme une nouvelle dont il se souvenait à l’instant et qu’il eût craint d’oublier ensuite, il me dit d’une voix claire et vibrante qui résonna à mon oreille comme les trompettes du jugement dernier :
« La grande courtisane Clarimonde est morte dernièrement, à la suite d’une orgie qui a duré huit jours et huit nuits. Ç’a été quelque chose d’infernalement splendide. On a renouvelé là les abominations des festins de Balthazar et de Cléopâtre. Dans quel siècle vivons-nous, bon Dieu ! Les convives étaient servis par des esclaves basanés parlant un langage inconnu, et qui m’ont tout l’air de vrais démons ; la livrée du moindre d’entre eux eût pu servir d’habit de gala à un empereur. Il a couru de tout temps sur cette Clarimonde de bien étranges histoires, et tous ses amants ont fini d’une manière misérable ou violente. On a dit que c’était une goule, un vampire femelle ; mais je crois que c’était Belzébuth en personne. »

Il se tut et m’observa plus attentivement que jamais, pour voir l’effet que ses paroles avaient produit sur moi. Je n’avais pu me défendre d’un mouvement en entendant nommer Clarimonde, et cette nouvelle de sa mort, outre la douleur qu’elle me causait par son étrange coïncidence avec la scène nocturne dont j’avais été témoin, me jeta dans un trouble et un effroi qui parurent sur ma figure, quoi que je fisse pour m’en rendre maître. Sérapion me jeta un coup d’œil inquiet et sévère ; puis il me dit : « Mon fils, je dois vous en avertir, vous avez le pied levé sur un abîme, prenez garde d’y tomber. Satan a la griffe longue, et les tombeaux ne sont pas toujours fidèles. La pierre de Clarimonde devrait être scellée d’un triple sceau ; car ce n’est pas, à ce qu’on dit, la première fois qu’elle est morte. Que Dieu veille sur vous, Romuald ! »
Après avoir dit ces mots, Sérapion regagna la porte à pas lents, et je ne le revis plus ; car il partit pour S*** presque aussitôt.
J’étais entièrement rétabli et j’avais repris mes fonctions habituelles. Le souvenir de Clarimonde et les paroles du vieil abbé étaient toujours présents à mon esprit ; cependant aucun événement extraordinaire n’était venu confirmer les prévisions funèbres de Sérapion, et je commençais à croire que ses craintes et mes terreurs étaient trop exagérées ; mais une nuit je fis un rêve. J’avais à peine bu les premières gorgées du sommeil, que j’entendis ouvrir les rideaux de mon lit et glisser les anneaux sur les tringles avec un bruit éclatant ; je me soulevai brusquement sur le coude, et je vis une ombre de femme qui se tenait debout devant moi. Je reconnus sur-le-champ Clarimonde. Elle portait à la main une petite lampe de la forme de celles qu’on met dans les tombeaux, dont la lueur donnait à ses doigts effilés une transparence rose qui se prolongeait par une dégradation insensible jusque dans la blancheur opaque et laiteuse de son bras nu. Elle avait pour tout vêtement le suaire de lin qui la recouvrait sur son lit de parade, dont elle retenait les plis sur sa poitrine, comme honteuse d’être si peu vêtue, mais sa petite main n’y suffisait pas, elle était si blanche, que la couleur de la draperie se confondait avec celle des chairs sous le pâle rayon de la lampe. Enveloppée de ce fin tissu qui trahissait tous les contours de son corps, elle ressemblait à une statue de marbre de baigneuse antique plutôt qu’à une femme douée de vie. Morte ou vivante, statue ou femme, ombre ou corps, sa beauté était toujours la même ; seulement l’éclat vert de ses prunelles était un peu amorti, et sa bouche, si vermeille autrefois, n’était plus teintée que d’un rose faible et tendre presque semblable à celui de ses joues. Les petites fleurs bleues que j’avais remarquées dans ses cheveux étaient tout à fait sèches et avaient presque perdu toutes leurs feuilles ; ce qui ne l’empêchait pas d’être charmante, si charmante que, malgré la singularité de l’aventure et la façon inexplicable dont elle était entrée dans la chambre, je n’eus pas un instant de frayeur.
Elle posa la lampe sur la table et s’assit sur le pied de mon lit, puis elle me dit en se penchant vers moi avec cette voix argentine et veloutée à la fois que je n’ai connue qu’à elle :
« Je me suis bien fait attendre, mon cher Romuald, et tu as dû croire que je t’avais oublié. Mais je viens de bien loin, et d’un endroit d’où personne n’est encore revenu : il n’y a ni lune ni soleil au pays d’où j’arrive ; ce n’est que de l’espace et de l’ombre ; ni chemin, ni sentier ; point de terre pour le pied, point d’air pour l’aile ; et pourtant me voici, car l’amour est plus fort que la mort, et il finira par la vaincre. Ah ! que de faces mornes et de choses terribles j’ai vues dans mon voyage ! Que de peine mon âme, rentrée dans ce monde par la puissance de la volonté, a eue pour retrouver son corps et s’y réinstaller ! Que d’efforts il m’a fallu faire avant de lever la dalle dont on m’avait couverte ! Tiens ! le dedans de mes pauvres mains en est tout meurtri. Baise-les pour les guérir, cher amour ! » Elle m’appliqua l’une après l’autre les paumes froides de ses mains sur la bouche je les baisai en effet plusieurs fois, et elle me regardait faire avec un sourire d’ineffable complaisance.
Je l’avoue à ma honte, j’avais totalement oublié les avis de l’abbé Sérapion et le caractère dont j’étais revêtu. J’étais tombé sans résistance et au premier assaut. Je n’avais pas même essayé de repousser le tentateur ; la fraîcheur de la peau de Clarimonde pénétrait la mienne, et je me sentais courir sur le corps de voluptueux frissons. La pauvre enfant ! malgré tout ce que j’en ai vu, j’ai peine à croire encore que ce fût un démon ; du moins elle n’en avait pas l’air, et jamais Satan n’a mieux caché ses griffes et ses cornes. Elle avait reployé ses talons sous elle et se tenait accroupie sur le bord de la couchette dans une position pleine de coquetterie nonchalante. De temps en temps elle passait sa petite main à travers mes cheveux et les roulait en boucles comme pour essayer à mon visage de nouvelles coiffures. Je me laissais faire avec la plus coupable complaisance, et elle accompagnait tout cela du plus charmant babil. Une chose remarquable, c’est que je n’éprouvais aucun étonnement d’une aventure aussi extraordinaire, et, avec cette facilité que l’on a dans la vision d’admettre comme fort simples les événements les plus bizarres, je ne voyais rien là que de parfaitement naturel.
« Je t’aimais bien longtemps avant de t’avoir vu, mon cher Romuald, et je te cherchais partout. Tu étais mon rêve, et je t’ai aperçu dans l’église au fatal moment ; j’ai dit tout de suite » C’est lui ! « Je te jetai un regard où je mis tout l’amour que j’avais eu, que j’avais et que je devais avoir pour toi ; un regard à damner un cardinal, à faire agenouiller un roi à mes pieds devant toute sa cour. Tu restas impassible et tu me préféras ton Dieu. »
« Ah ! que je suis jalouse de Dieu, que tu as aimé et que tu aimes encore plus que moi ! Malheureuse, malheureuse que je suis ! je n’aurai jamais ton cœur à moi toute seule, moi que tu as ressuscitée d’un baiser, Clarimonde la morte, qui force à cause de toi les portes du tombeau et qui vient te consacrer une vie qu’elle n’a reprise que pour te rendre heureux ! »
Toutes ces paroles étaient entrecoupées de caresses délirantes qui étourdirent mes sens et ma raison au point que je ne craignis point pour la consoler de proférer un effroyable blasphème, et de lui dire que je l’aimais autant que Dieu.
Ses prunelles se ravivèrent et brillèrent comme des chrysoprases. « Vrai ! bien vrai ! autant que Dieu ! dit-elle en m’enlaçant dans ses beaux bras. Puisque c’est ainsi, tu viendras avec moi, tu me suivras où je voudrai. Tu laisseras tes vilains habits noirs. Tu seras le plus fier et le plus envié des cavaliers, tu seras mon amant. Être l’amant avoué de Clarimonde, qui a refusé un pape, c’est beau, cela ! Ah ! la bonne vie bien heureuse, la belle existence dorée que nous mènerons ! Quand partons-nous, mon gentilhomme ?
— Demain ! demain ! m’écriai-je dans mon délire.
— Demain, soit ! reprit-elle. J’aurai le temps de changer de toilette, car celle-ci est un peu succincte et ne vaut rien pour le voyage. Il faut aussi que j’aille avertir mes gens qui me croient sérieusement morte et qui se désolent tant qu’ils peuvent. L’argent, les habits, les voitures, tout sera prêt ; je te viendrai prendre à cette heure-ci. Adieu, cher cœur. » Et elle effleura mon front du bout de ses lèvres. La lampe s’éteignit, les rideaux se refermèrent, et je ne vis plus rien ; un sommeil de plomb, un sommeil sans rêve s’appesantit sur moi et me tint engourdi jusqu’au lendemain matin. Je me réveillai plus tard que de coutume, et le souvenir de cette singulière vision m’agita toute la journée ; je finis par me persuader que c’était une pure vapeur de mon imagination échauffée. Cependant les sensations avaient été si vives, qu’il était difficile de croire qu’elles n’étaient pas réelles, et ce ne fut pas sans quelque appréhension de ce qui allait arriver que je me mis au lit, après avoir prié Dieu d’éloigner de moi les mauvaises pensées et de protéger la chasteté de mon sommeil.
Je m’endormis bientôt profondément, et mon rêve se continua. Les rideaux s’écartèrent, et je vis Clarimonde, non pas, comme la première fois, pâle dans son pâle suaire et les violettes de la mort sur les joues, mais gaie, leste et pimpante, avec un superbe habit de voyage en velours vert orné de ganses d’or et retroussé sur le côté pour laisser voir une jupe de satin. Ses cheveux blonds s’échappaient en grosses boucles de dessous un large chapeau de feutre noir chargé de plumes blanches capricieusement contournées ; elle tenait à la main une petite cravache terminée par un sifflet d’or. Elle m’en toucha légèrement et me dit : « Eh bien ! beau dormeur, est-ce ainsi que vous faites vos préparatifs ? Je comptais vous trouver debout. Levez-vous bien vite, nous n’avons pas de temps à perdre. » Je sautai à bas du lit.
« Allons, habillez-vous et partons, dit-elle en me montrant du doigt un petit paquet qu’elle avait apporté ; les chevaux s’ennuient et rongent leur frein à la porte. Nous devrions déjà être à dix lieues d’ici. »
Je m’habillai en hâte, et elle me tendait elle-même les pièces du vêtement, en riant aux éclats de ma gaucherie, et en m’indiquant leur usage quand je me trompais. Elle donna du tour à mes cheveux, et, quand ce fut fait, elle me tendit un petit miroir de poche en cristal de Venise, bordé d’un filigrane d’argent, et me dit : « Comment te trouves-tu ? veux-tu me prendre à ton service comme valet de chambre ? »
Je n’étais plus le même, et je ne me reconnus pas. Je ne me ressemblais pas plus qu’une statue achevée ne ressemble à un bloc de pierre. Mon ancienne figure avait l’air de n’être que l’ébauche grossière de celle que réfléchissait le miroir. J’étais beau, et ma vanité fut sensiblement chatouillée de cette métamorphose. Ces élégants habits, cette riche veste brodée, faisaient de moi un tout autre personnage, et j’admirais la puissance de quelques aunes d’étoffe taillées d’une certaine manière. L’esprit de mon costume me pénétrait la peau, et au bout de dix minutes j’étais passablement fat.
Je fis quelques tours par la chambre pour me donner de l’aisance. Clarimonde me regardait d’un air de complaisance maternelle et paraissait très contente de son œuvre. « Voilà bien assez d’enfantillage, en route, mon cher Romuald ! nous allons loin et nous n’arriverons pas. » Elle me prit la main et m’entraîna. Toutes les portes s’ouvraient devant elle aussitôt qu’elle les touchait, et nous passâmes devant le chien sans l’éveiller.
A la porte, nous trouvâmes Margheritone ; c’était l’écuyer qui m’avait déjà conduit ; il tenait en bride trois chevaux noirs comme les premiers, un pour moi, un pour lui, un pour Clarimonde. Il fallait que ces chevaux fussent des genets d’Espagne, nés de juments fécondées par le zéphyr ; car ils allaient aussi vite que le vent, et la lune, qui s’était levée à notre départ pour nous éclairer, roulait dans le ciel comme une roue détachée de son char ; nous la voyions à notre droite sauter d’arbre en arbre et s’essouffler pour courir après nous. Nous arrivâmes bientôt dans une plaine où, auprès d’un bouquet d’arbres, nous attendait une voiture attelée de quatre vigoureuses bêtes ; nous y montâmes, et les postillons leur firent prendre un galop insensé. J’avais un bras passé derrière la taille de Clarimonde et une de ses mains ployée dans la mienne ; elle appuyait sa tête à mon épaule, et je sentais sa gorge demi nue frôler mon bras. Jamais je n’avais éprouvé un bonheur aussi vif. J’avais oublié tout en ce moment-là, et je ne me souvenais pas plus d’avoir été prêtre que de ce que j’avais fait dans le sein de ma mère, tant était grande la fascination que l’esprit malin exerçait sur moi. A dater de cette nuit, ma nature s’est en quelque sorte dédoublée, et il y eut en moi deux hommes dont l’un ne connaissait pas l’autre. Tantôt je me croyais un prêtre qui rêvait chaque soir qu’il était gentilhomme, tantôt un gentilhomme qui rêvait qu’il était prêtre. Je ne pouvais plus distinguer le songe de la veille, et je ne savais pas où commençait la réalité et où finissait l’illusion. Le jeune seigneur fat et libertin se raillait du prêtre, le prêtre détestait les dissolutions du jeune seigneur. Deux spirales enchevêtrées l’une dans l’autre et confondues sans se toucher jamais représentent très bien cette vie bicéphale qui fut la mienne. Malgré l’étrangeté de cette position, je ne crois pas avoir un seul instant touché à la folie. J’ai toujours conservé très nettes les perceptions de mes deux existences. Seulement, il y avait un fait absurde que je ne pouvais m’expliquer : c’est que le sentiment du même moi existât dans deux hommes si différents. C’était une anomalie dont je ne me rendais pas compte, soit que je crusse être le curé du petit village de ***, ou _il signor Romualdo_, amant en titre de la Clarimonde.
Toujours est-il que j’étais ou du moins que je croyais être à Venise ; je n’ai pu encore bien démêler ce qu’il y avait d’illusion et de réalité dans cette bizarre aventure. Nous habitions un grand palais de marbre sur le Canaleio, plein de fresques et de statues, avec deux Titiens du meilleur temps dans la chambre à coucher de la Clarimonde, un palais digne d’un roi. Nous avions chacun notre gondole et nos barcarolles à notre livrée, notre chambre de musique et notre poète. Clarimonde entendait la vie d’une grande manière, et elle avait un peu de Cléopâtre dans sa nature. Quant à moi, je menais un train de fils de prince, et je faisais une poussière comme si j’eusse été de la famille de l’un des douze apôtres ou des quatre évangélistes de la sérénissime république ; je ne me serais pas détourné de mon chemin pour laisser passer le doge, et je ne crois pas que, depuis Satan qui tomba du ciel, personne ait été plus orgueilleux et plus insolent que moi. J’allais au Ridotto, et je jouais un jeu d’enfer. Je voyais la meilleure société du monde, des fils de famille ruinés, des femmes de théâtre, des escrocs, des parasites et des spadassins. Cependant, malgré la dissipation de cette vie, je restai fidèle à la Clarimonde. Je l’aimais éperdument. Elle eût réveillé la satiété même et fixé l’inconstance. Avoir Clarimonde, c’était avoir vingt maîtresses, c’était avoir toutes les femmes, tant elle était mobile, changeante et dissemblable d’elle-même ; un vrai caméléon ! Elle vous faisait commettre avec elle l’infidélité que vous eussiez commise avec d’autres, en prenant complètement le caractère, l’allure et le genre de beauté de la femme qui paraissait vous plaire. Elle me rendait mon amour au centuple, et c’est en vain que les jeunes patriciens et même les vieux du conseil des Dix lui firent les plus magnifiques propositions. Un Foscari alla même jusqu’à lui proposer de l’épouser ; elle refusa tout. Elle avait assez d’or ; elle ne voulait plus que de l’amour, un amour jeune, pur, éveillé par elle, et qui devait être le premier et le dernier. J’aurais été parfaitement heureux sans un maudit cauchemar qui revenait toutes les nuits, et où je me croyais un curé de village se macérant et faisant pénitence de mes excès du jour. Rassuré par l’habitude d’être avec elle, je ne songeais presque plus à la façon étrange dont j’avais fait connaissance avec Clarimonde. Cependant, ce qu’en avait dit l’abbé Sérapion me revenait quelquefois en mémoire et ne laissait pas que de me donner de l’inquiétude.
Depuis quelque temps la santé de Clarimonde n’était pas aussi bonne ; son teint s’amortissait de jour en jour. Les médecins qu’on fit venir n’entendaient rien à sa maladie, et ils ne savaient qu’y faire. Ils prescrivirent quelques remèdes insignifiants et ne revinrent plus. Cependant elle pâlissait a vue d’œil et devenait de plus en plus froide. Elle était presque aussi blanche et aussi morte que la fameuse nuit dans le château inconnu. Je me désolais de la voir ainsi lentement dépérir. Elle, touchée de ma douleur, me souriait doucement et tristement avec le sourire fatal des gens qui savent qu’ils vont mourir.
Un matin, j’etais assis auprès de son lit, et je déjeunais sur une petite table pour ne la pas quitter d’une minute. En coupant un fruit, je me fis par hasard au doigt une entaille assez profonde. Le sang partit aussitôt en filets pourpres, et quelques gouttes rejaillirent sur Clarimonde. Ses yeux s’éclairèrent, sa physionomie prit une expression de joie féroce et sauvage que je ne lui avais jamais vue. Elle sauta à bas du lit avec une agilité animale, une agilité de singe ou de chat, et se précipita sur ma blessure qu’elle se mit à sucer avec un air d’indicible volupté. Elle avalait le sang par petites gorgées, lentement et précieusement, comme un gourmet qui savoure un vin de Xérès ou de Syracuse ; elle clignait les yeux à demi, et la pupille de ses prunelles vertes était devenue oblongue au lieu de ronde. De temps à autre elle s’interrompait pour me baiser la main, puis elle recommençait à presser de ses lèvres les lèvres de la plaie pour en faire sortir encore quelques gouttes rouges. Quand elle vit que le sang ne venait plus, elle se releva l’œil humide et brillant, plus rose qu’une aurore de mai, la figure pleine, la main tiède et moite, enfin plus belle que jamais et dans un état parfait de santé.
« Je ne mourrai pas ! je ne mourrai pas ! dit-elle à moitié folle de joie et en se pendant à mon cou ; je pourrai t’aimer encore longtemps. Ma vie est dans la tienne, et tout ce qui est moi vient de toi. Quelques gouttes de ton riche et noble sang, plus précieux et plus efficace que tous les élixirs du monde, m’ont rendu l’existence. »
Cette scène me préoccupa longtemps et m’inspira d’étranges doutes à l’endroit de Clarimonde, et le soir même, lorsque le sommeil m’eut ramené à mon presbytère, je vis l’abbé Sérapion plus grave et plus soucieux que jamais. Il me regarda attentivement et me dit : « Non content de perdre votre âme, vous voulez aussi perdre votre corps. Infortuné jeune homme, dans quel piège êtes-vous tombé ! » Le ton dont il me dit ce peu de mots me frappa vivement ; mais, malgré sa vivacité, cette impression fut bientôt dissipée, et mille autres soins l’effacèrent de mon esprit. Cependant, un soir, je vis dans ma glace, dont elle n’avait pas calculé la perfide position, Clarimonde qui versait une poudre dans la coupe de vin épicé qu’elle avait coutume de préparer après le repas. Je pris la coupe, je feignis d’y porter mes lèvres, et je la posai sur quelque meuble comme pour l’achever plus tard à mon loisir, et, profitant d’un instant où la belle avait le dos tourné, j’en jetai le contenu sous la table ; après quoi je me retirai dans ma chambre et je me couchai, bien déterminé à ne pas dormir et à voir ce que tout cela deviendrait. Je n’attendis pas longtemps ; Clarimonde entra en robe de nuit, et, s’étant débarrassée de ses voiles, s’allongea dans le lit auprès de moi. Quand elle se fut bien assurée que je dormais, elle découvrit mon bras et tira une épingle d’or de sa tête ; puis elle se mit à murmurer à voix basse :
« Une goutte, rien qu’une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille !... Puisque tu m’aimes encore, il ne faut pas que je meure... Ah! pauvre amour ! Ton beau sang d’une couleur pourpre si éclatante, je vais le boire. Dors, mon seul bien ; dors, mon dieu, mon enfant ; je ne te ferai pas de mal, je ne prendrai de ta vie que ce qu’il faudra pour ne pas laisser éteindre la mienne. Si je ne t’aimais pas tant, je pourrais me résoudre à avoir d’autres amants dont je tarirais les veines ; mais depuis que je te connais, j’ai tout le monde en horreur... Ah ! le beau bras ! comme il est rond ! comme il est blanc ! Je n’oserai jamais piquer cette jolie veine bleue. » Et, tout en disant cela, elle pleurait, et je sentais pleuvoir ses larmes sur mon bras qu’elle tenait entre ses mains. Enfin elle se décida, me fit une petite piqûre avec son aiguille et se mit à pomper le sang qui en coulait. Quoiqu’elle en eût bu à peine quelques gouttes, la crainte de m’épuiser la prenant, elle m’entoura avec soin le bras d’une petite bandelette après avoir frotté la plaie d’un onguent qui la cicatrisa sur-le-champ.
Je ne pouvais plus avoir de doutes, l’abbé Sérapion avait raison. Cependant, malgré cette certitude, je ne pouvais m’empêcher d’aimer Clarimonde, et je lui aurais volontiers donné tout le sang dont elle avait besoin pour soutenir son existence factice. D’ailleurs, je n’avais pas grand’peur ; la femme me répondait du vampire, et ce que j’avais entendu et vu me rassurait complètement ; j’avais alors des veines plantureuses qui ne se seraient pas de sitôt épuisées, et je ne marchandais pas ma vie goutte à goutte. Je me serais ouvert le bras moi-même et je lui aurais dit : « Bois ! et que mon amour s infiltre dans ton corps avec mon sang ! » J’évitais de faire la moindre allusion au narcotique qu’elle m’avait versé et à la scène de l’aiguille, et nous vivions dans le plus parfait accord. Pourtant mes scrupules de prêtre me tourmentaient plus que jamais, et je ne savais quelle macération nouvelle inventer pour mater et mortifier ma chair. Quoique toutes ces visions fussent involontaires et que je n’y participasse en rien, je n’osais pas toucher le Christ avec des mains aussi impures et un esprit souillé par de pareilles débauches réelles ou rêvées. Pour éviter de tomber dans ces fatigantes hallucinations, j’essayais de m’empêcher de dormir, je tenais mes paupières ouvertes avec les doigts et je restais debout au long des murs, luttant contre le sommeil de toutes mes forces ; mais le sable de l’assoupissement me roulait bientôt dans les yeux, et, voyant que toute lutte était inutile, je laissais tomber les bras de découragement et de lassitude, et le courant me rentraînait vers les rives perfides. Sérapion me faisait les plus véhémentes exhortations, et me reprochait durement ma mollesse et mon peu de ferveur. Un jour que j’avais été plus agité qu’à l’ordinaire, il me dit : « Pour vous débarrasser de cette obsession, il n’y a qu’un moyen, et, quoiqu’il soit extrême, il le faut employer : aux grands maux les grands remèdes. Je sais où Clarimonde a été enterrée ; il faut que nous la déterrions et que vous voyiez dans quel état pitoyable est l’objet de votre amour ; vous ne serez plus tenté de perdre votre âme pour un cadavre immonde dévoré des vers et près de tomber en poudre ; cela vous fera assurément rentrer en vous-même. » Pour moi, j’étais si fatigué de cette double vie, que j’acceptai : voulant savoir, une fois pour toutes, qui du prêtre ou du gentilhomme était dupe d’une illusion, j’étais décidé à tuer au profit de l’un ou de l’autre un des deux hommes qui étaient en moi ou à les tuer tous deux, car une pareille vie ne pouvait durer. L’abbé Sérapion se munit d’une pioche, d’un levier et d’une lanterne, et à minuit nous nous dirigeâmes vers le cimetière de ***, dont il connaissait parfaitement le gisement et la disposition. Après avoir porté la lumière de la lanterne sourde sur les inscriptions de plusieurs tombeaux, nous arrivâmes enfin à une pierre à moitié cachée par les grandes herbes et dévorée de mousses et de plantes parasites, où nous déchiffrâmes ce commencement d’inscription :
Ici gît Clarimonde
Qui fut de son vivant
La plus belle du monde.
« C’est bien ici, » dit Sérapion, et, posant à terre sa lanterne, il glissa la pince dans l’interstice de la pierre et commença à la soulever. La pierre céda, et il se mit à l’ouvrage avec la pioche. Moi, je le regardais faire, plus noir et plus silencieux que la nuit elle-même ; quant à lui, courbé sur son œuvre funèbre, il ruisselait de sueur, il haletait, et son souffle pressé avait l’air d’un râle d’agonisant. C’était un spectacle étrange, et qui nous eût vus du dehors nous eût plutôt pris pour des profanateurs et des voleurs de linceuls, que pour des prêtres de Dieu. Le zèle de Sérapion avait quelque chose de dur et de sauvage qui le faisait ressembler à un démon plutôt qu’à un apôtre ou a un ange, et sa figure aux grands traits austères et profondément découpés par le reflet de la lanterne n’avait rien de très rassurant. Je me sentais perler sur les membres une sueur glaciale, et mes cheveux se redressaient douloureusement sur ma tête ; je regardais au fond de moi-même l’action du sévère Sérapion comme un abominable sacrilège, et j’aurais voulu que du flanc des sombres nuages qui roulaient pesamment au-dessus de nous sortît un triangle de feu qui le réduisît en poudre. Les hiboux perchés sur les cyprès, inquiétés par l’éclat de la lanterne, en venaient fouetter lourdement la vitre avec leurs ailes poussiéreuses, en jetant des gémissements plaintifs ; les renards glapissaient dans le lointain, et mille bruits sinistres se dégageaient du silence. Enfin la pioche de Sérapion heurta le cercueil dont les planches retentirent avec un bruit sourd et sonore, avec ce terrible bruit que rend le néant quand on y touche ; il en renversa le couvercle, et j’aperçus Clarimonde pâle comme un marbre, les mains jointes ; son blanc suaire ne faisait qu’un seul pli de sa tête à ses pieds. Une petite goutte rouge brillait comme une rose au coin de sa bouche décolorée. Sérapion, à cette vue, entra en fureur : « Ah ! te voilà, démon, courtisane impudique, buveuse de sang et d’or ! » et il aspergea d’eau bénite le corps et le cercueil sur lequel il traça la forme d’une croix avec son goupillon. La pauvre Clarimonde n’eut pas été plus tôt touchée par la sainte rosée que son beau corps tomba en poussière ; ce ne fut plus qu’un mélange affreusement informe de cendres et d’os à demi calcinés. « Voilà votre maîtresse, seigneur Romuald, dit l’inexorable prêtre en me montrant ces tristes dépouilles, serez-vous encore tenté d’aller vous promener au Lido et à Fusine avec votre beauté ? » Je baissai la tête ; une grande ruine venait de se faire au dedans de moi. Je retournai à mon presbytère, et le seigneur Romuald, amant de Clarimonde, se sépara du pauvre prêtre, à qui il avait tenu pendant si longtemps une si étrange compagnie. Seulement, la nuit suivante, je vis Clarimonde ; elle me dit, comme la première fois sous le portail de l’église : « Malheureux ! malheureux ! qu’as-tu fait ? Pourquoi as-tu écouté ce prêtre imbécile ? n’étais-tu pas heureux ? et que t’avais-je fait, pour violer ma pauvre tombe et mettre à nu les misères de mon néant ? Toute communication entre nos âmes et nos corps est rompue désormais. Adieu, tu me regretteras. » Elle se dissipa dans l’air comme une fumée, et je ne la revis plus.

Hélas ! elle a dit vrai : je l’ai regrettée plus d’une fois et je la regrette encore. La paix de mon âme a été bien chèrement achetée ; l’amour de Dieu n’était pas de trop pour remplacer le sien. Voilà, frère, l’histoire de ma jeunesse. Ne regardez jamais une femme, et marchez toujours les yeux fixés en terre, car, si chaste et si calme que vous soyez, il suffit d’une minute pour vous faire perdre l’éternité.
Varney the Vampire; or, the Feast of Blood
Midnight. — The hail-storm. — The dreadful visitor. — The Vampyre
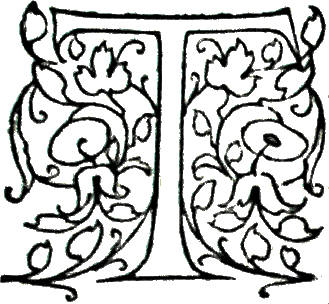 he solemn tones of an old cathedral clock have announced midnight — the air is thick and heavy — a strange, death like stillness pervades all nature. Like the ominous calm which precedes some more than usually terrific outbreak of the elements, they seem to have paused even in their ordinary fluctuations, to gather a terrific strength for the great effort. A faint peal of thunder now comes from far off. Like a signal gun for the battle of the winds to begin, it appeared to awaken them from their lethargy, and one awful, warring hurricane swept over a whole city, producing more devastation in the four or five minutes it lasted, than would a half century of ordinary phenomena.
he solemn tones of an old cathedral clock have announced midnight — the air is thick and heavy — a strange, death like stillness pervades all nature. Like the ominous calm which precedes some more than usually terrific outbreak of the elements, they seem to have paused even in their ordinary fluctuations, to gather a terrific strength for the great effort. A faint peal of thunder now comes from far off. Like a signal gun for the battle of the winds to begin, it appeared to awaken them from their lethargy, and one awful, warring hurricane swept over a whole city, producing more devastation in the four or five minutes it lasted, than would a half century of ordinary phenomena.
It was as if some giant had blown upon some toy town, and scattered many of the buildings before the hot blast of his terrific breath; for as suddenly as that blast of wind had come did it cease, and all was as still and calm as before.
Sleepers awakened, and thought that what they had heard must be the confused chimera of a dream. They trembled and turned to sleep again.
All is still — still as the very grave. Not a sound breaks the magic of repose. What is that — a strange pattering noise, as of a millionfairy feet? It is hail — yes, a hail-storm has burst over the city. Leaves are dashed from the trees, mingled with small boughs; windows that lie most opposed to the direct fury of the pelting particles of ice are broken, and the rapt repose that before was so remarkable in its intensity, is exchanged for a noise which, in its accumulation, drowns every cry of surprise or consternation which here and there arose from persons who found their houses invaded by the storm.
Now and then, too, there would come a sudden gust of wind that in its strength, as it blew laterally, would, for a moment, hold millions of the hailstones suspended in mid air, but it was only to dash them with redoubled force in some new direction, where more mischief was to be done.
Oh, how the storm raged! Hail — rain — wind. It was, in very truth, an awful night.
🞯 🞯 🞯 🞯 🞯
There was an antique chamber in an ancient house. Curious and quaint carvings adorn the walls, and the large chimneypiece is a curiosity of itself. The ceiling is low, and a large bay window, from roof to floor, looks to the west. The window is latticed, and filled with curiously painted glass and rich stained pieces, which send in a strange, yet beautiful light, when sun or moon shines into the apartment. There is but one portrait in that room, although the walls seem paneled for the express purpose of containing a series of pictures. That portrait is of a young man, with a pale face, a stately brow, and a strange expression about the eyes, which no one cared to look on twice.
There is a stately bed in that chamber, of carved walnut-wood is it made, rich in design and elaborate in execution; one of those works which owe their existence to the Elizabethan era. It is hung with heavy silken and damask furnishing; nodding feathers are at its corners — covered with dust are they, and they lend a funereal aspect to the room. The floor is of polished oak. God! how the hail dashes on the old bay window! Like an occasional discharge of mimic musketry, it comes clashing, beating, and cracking upon the small panes; but they resist it — their small size saves them; the wind, the hail, the rain, expend their fury in vain. The bed in that old chamber is occupied. A creature formed in all fashions of loveliness lies in a half sleep upon that ancient couch — a girl young and beautiful as a spring morning. Her long hair has escaped from its confinement and streams over the blackened coverings of the bedstead; she has been restless in her sleep, for the clothing of the bed is in much confusion. One arm is over her head, the other hangs nearly off the side of the bed near to which she lies. A neck and bosom that would have formed a study for the rarest sculptor that ever Providence gave genius to, were half disclosed. She moaned slightly in her sleep, and once or twice the lips moved as if in prayer — at least one might judge so, for the name of Him who suffered for all came once faintly from them.
She had endured much fatigue, and the storm dose not awaken her; but it can disturb the slumbers it does not possess the power to destroy entirely. The turmoil of the elements wakes the senses, although it cannot entirely break the repose they have lapsed into. Oh, what a world of witchery was in that mouth, slightly parted, and exhibiting within the pearly teeth that glistened even in the faint light that came from that bay window. How sweetly the long silken eyelashes lay upon the cheek. Now she moves, and one shoulder is entirely visible — whiter, fairer than the spotless clothing of the bed on which she lies, is the smooth skin of that fair creature, just budding into womanhood, and in that transition state which presents to us all the charms of the girl — almost of the child, with the more matured beauty and gentleness of advancing years.
Was that lightning? Yes — an awful, vivid, terrifying flash — then a roaring peal of thunder, as if a thousand mountains were rolling one over the other in the blue vault of Heaven! Who sleeps now in that ancient city? Not one living soul. The dread trumpet of eternity could not more effectually have awakened any one. The hail continues. The wind continues. The uproar of the elements seems at its height. Now she awakens — that beautiful girl on the antique bed; she opens those eyes of celestial blue, and a faint cry of alarm bursts from her lips. At least it is a cry which, amid the noise and turmoil without, sounds but faint and weak. She sits upon the bed and presses her hands upon her eyes. Heavens! what a wild torrent of wind, and rain, and hail! The thunder likewise seems intent upon awakening sufficient echoes to last until the next flash of forked lightning should again produce the wild concussion of the air. She murmurs a prayer — a prayer for those she loves best; the names of those dear to her gentle heart come from her lips; she weeps and prays; she thinks then of what devastation the storm must surely produce, and to the great God of Heaven she prays for all living things. Another flash — a wild, blue, bewildering flash of lightning streams across that bay window, for an instant bringing out every colour in it with terrible distinctness. A shriek bursts from the lips of the young girl, and then, with eyes fixed upon that window, which, in another moment, is all darkness, and with such an expression of terror upon her face as it had never before known, she trembled, and the perspiration of intense fear stood upon her brow.
“What — what was it?" she gasped; "real or delusion? Oh, God, what was it? A figure tall and gaunt, endeavouring from the outside to unclasp the window. I saw it. That flash of lightning revealed it to me. It stood the whole length of the window.”
There was a lull of the wind. The hail was not falling so thickly — moreover, it now fell, what there was of it, straight, and yet a strange clattering sound came upon the glass of that long window. It could not be a delusion — she is awake, and she hears it. What can produce it? Another flash of lightning — another shriek — there could be now no delusion.
A tall figure is standing on the ledge immediately outside the long window. It is its finger-nails upon the glass that produces thesound so like the hail, now that the hail has ceased. Intense fear paralysed the limbs of the beautiful girl. That one shriek is all she can utter — with hand clasped, a face of marble, a heart beating so wildly in her bosom, that each moment it seems as if it would break its confines, eyes distended and fixed upon the window, she waits, froze with horror. The pattering and clattering of the nails continue. No word is spoken, and now she fancies she can trace the darker form of that figure against the window, and she can see the long arms moving to and fro, feeling for some mode of entrance. What strange light is that which now gradually creeps up into the air? red and terrible — brighter and brighter it grows. The lightning has set fire to a mill, and the reflection of the rapidly consuming building falls upon that long window. There can be no mistake. The figure is there, still feeling for an entrance, and clattering against the glass with its long nails, that appear as if the growth of many years had been untouched. She tries to scream again but a choking sensation comes over her, and she cannot. It is too dreadful — she tries to move — each limb seems weighted down by tons of lead — she can but in a hoarse faint whisper cry, --
“Help — help — help — help!”
And that one word she repeats like a person in a dream. The red glare of the fire continues. It throws up the tall gaunt figure in hideous relief against the long window. It shows, too, upon the one portrait that is in the chamber, and the portrait appears to fix its eyes upon the attempting intruder, while the flickering light from the fire makes it look fearfully lifelike. A small pane of glass is broken, and the form from without introduces a long gaunt hand, which seems utterly destitute of flesh. The fastening is removed, and one-half of the window, which opens like folding doors, is swung wide open upon its hinges.
And yet now she could not scream — she could not move. “Help! — help! — help!” was all she could say. But, oh, that look of terror that sat upon her face, it was dreadful — a look to haunt the memory for a life-time — a look to obtrude itself upon the happiest moments, and turn them to bitterness.
The figure turns half round, and the light falls upon its face. It is perfectly white — perfectly bloodless. The eyes look like polished tin; the lips are drawn back, and the principal feature next to those dreadful eyes is the teeth — the fearful looking teeth — projecting like those of some wild animal, hideously, glaringly white, and fang-like. It approaches the bed with a strange, gliding movement. It clashes together the long nails that literally appear to hang from the finger ends. No sound comes from its lips. Is she going mad — that young and beautiful girl exposed to so much terror? she has drawn up all her limbs; she cannot even now say help. The power of articulation is gone, but the power of movement has returned to her; she can draw herself slowly along to the other side of the bed from that towards which the hideous appearance is coming.
But her eyes are fascinated. The glance of a serpent could not have produced a greater effect upon her than did the fixed gaze of those awful, metallic-looking eyes that were bent down on her face. Crouching down so that the gigantic height was lost, and the horrible, protruding white face was the most prominent object, came on the figure. What was it? — what did it want there? — what made it look so hideous — so unlike an inhabitant of the earth, and yet be on it?
Now she has got to the verge of the bed, and the figure pauses. It seemed as if when it paused she lost the power to proceed. The clothing of the bed was now clutched in her hands with unconscious power. She drew her breath short and thick. Her bosom heaves, and her limbs tremble, yet she cannot withdraw her eyes from that marble-looking face. He holds her with his glittering eye. The storm has ceased — all is still. The winds are hushed; the church clock proclaims the hour of one: a hissing sound comes from the throat of the hideous being, and he raises his long, gaunt arms — the lips move. He advances. The girl places one small foot on to the floor. She is unconsciously dragging the clothing with her. The door of the room is in that direction — can she reach it? Has she power to walk? — can she withdraw her eyes from the face of the intruder, and so break the hideous charm? God of Heaven! is it real, or some dream so like reality as to nearly overturn judgment forever?
The figure has paused again, and half on the bed and half out of it that young girl lies trembling. Her long hair streams across the entire width of the bed. As she has slowly moved along she has left it streaming across the pillows. The pause lasted about a minute — oh, what an age of agony. That minute was, indeed, enough for madness to do its full work in.
With a sudden rush that could not be foreseen — with a strange howling cry that was enough to awaken terror in every breast, the figure seized the long tresses of her hair, and twining them round his bony hands he held her to the bed. Then she screamed — Heaven granted her then power to scream. Shriek followed shriek in rapid succession. The bed-clothes fell in a heap by the side of the bed — she was dragged by her long silken hair completely on to it again. Her beautifully rounded limbs quivered with the agony of her soul. The glassy, horrible eyes of the figure ran over that angelic form with a hideous satisfaction — horrible profanation. He drags her head to the bed's edge. He forces it back by the long hair still entwined in his grasp. With a plunge he seizes her neck in his fang-like teeth — a gush of blood, and a hideous sucking noise follows. The girl has swooned, and the vampyre is at his hideous repast!
[...]
The total destruction of Varney the vampyre, and conclusion
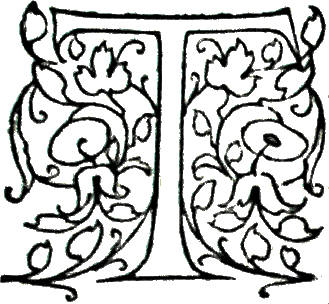 he manuscript which the clergyman had read with so much interest, here abruptly terminated. He was left to conclude that Varney after that had been resuscitated; and he was more perplexed than ever to come to any opinion concerning the truth of the narration which he had now concluded.
he manuscript which the clergyman had read with so much interest, here abruptly terminated. He was left to conclude that Varney after that had been resuscitated; and he was more perplexed than ever to come to any opinion concerning the truth of the narration which he had now concluded.
It was one week after he had finished the perusal of Varney’s papers that the clergyman read in an English newspaper the following statement.
“We extract from the Algemeine Zeitung the following most curious story, the accuracy of which of course we cannot vouch for, but still there is a sufficient air of probability about it to induce us to present it to our readers.
“Late in the evening, about four days since, a tall and melancholy-looking stranger arrived, and put up at one of the principal hotels at Naples. He was a most peculiar looking man, and considered by the persons of the establishment as about the ugliest guest they had ever had within the walls of their place.
“In a short time he summoned the landlord, and the following conversation ensued between him and the strange guest.
“‘I want,’ said the stranger, ‘to see all the curiosities of Naples, and among the rest Mount Vesuvius. Is there any difficulty?’
“‘None,’ replied the landlord, ‘with a proper guide.’
“A guide was soon secured, who set out with the adventurous Englishman to make the ascent of the burning mountain.
“They went on then until the guide did not think it quite prudent to go any further, as there was a great fissure in the side of the mountain, out of which a stream of lava was slowly issuing and speading itself in rather an alarming manner.
“The ugly Englishman, however, pointed to a secure mode of getting higher still, and they proceeded until they were very near the edge of the crater itself. The stranger then took his purse from his pocket and flung it to the guide saying,
“‘You can keep that for your pains, and for coming into some danger with me. But the fact was, that I wanted a witness to an act which I have set my mind upon performing.’
“The guide says that these words were spoken with so much calmness, that he verily believed the act mentioned as about to be done was some scientific experiment of which he knew that the English were very fond, and he replied,
“‘Sir, I am only too proud to serve so generous and so distinguished a gentleman. In what way can I be useful?’
“‘You will make what haste you can,’ said the stranger, ‘from the mountain, inasmuch as it is covered with sulphurous vapours, inimical to human life, and when you reach the city you will cause to be published an account of my proceedings, and what I say. You will say that you accompanied Varney the Vampyre to the crater of Mount Vesuvius, and that, tired and disgusted with a life of horror, he flung himself in to prevent the possibility of a reanimation of his remains.’
“Before then the guide could utter anything but a shriek, Varney took one tremendous leap, and disappeared into the burning mouth of the mountain.”
Charles Nodier: Facéties sur les vampires
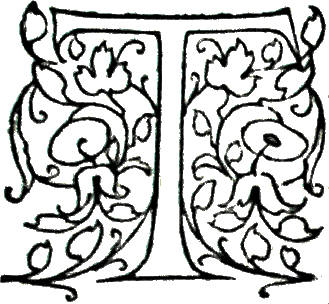 andis que les vampires faisaient bonne chère en Autriche, en Lorraine, en Moravie, en Pologne, on n’entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J’avoue, dit Voltaire, que, dans les deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d’affaires, qui sucèrent en plein jour le sang du peuple ; mais ils n’étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables.
andis que les vampires faisaient bonne chère en Autriche, en Lorraine, en Moravie, en Pologne, on n’entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J’avoue, dit Voltaire, que, dans les deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d’affaires, qui sucèrent en plein jour le sang du peuple ; mais ils n’étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables.
– C’est une chose véritablement curieuse que les procès-verbaux qui concernent les vampires. Calmet rapporte qu’en Hongrie, deux officiers délégués par l’empereur Charles VI, assistés du bailli du lieu et du bourreau, allèrent faire enquête d’un vampire mort depuis six semaines, qui suçait tout le voisinage. On le trouva dans sa bière frais, gaillard, les yeux ouverts, et 175demandant à manger. Le bailli rendit sa sentence. Le bourreau arracha le cœur au vampire et le brûla ; après quoi le vampire ne mangea plus. Qu’on ose douter après cela des morts ressuscités dont nos anciennes légendes sont remplies ! (Dictionnaire philosophique.)
– Dans le vaudeville des Variétés, les trois Vampires se font connaître de cette sorte :
Le vampire Ledoux. « Un instant !... Je suis connu, je me nomme Ledoux, fils de M. Grippart Ledoux, huissier de Pantin... Messieurs. »
Le vampire Larose. « Moi je m’appelle Larose, fils de Pierre Taxant Larose, percepteur des contributions de Sceaux... Messieurs ; et honnête homme, si j’ose m’exprimer ainsi. »
Le vampire Lasonde. « Et moi, je suis Lasonde, commis à la barrière des Bons-Hommes... Messieurs. »
M. Gobetoutx. « Puisque votre père est huissier, que le vôtre est percepteur des contributions, et que monsieur est commis à la barrière..., je ne m’étais pas tout à fait trompé en vous prenant pour des vampires. Vous nous sucez bien un peu...
– Quand les vents glacés du dernier hiver eurent perdu les oliviers de la Provence, un mauvais plaisant dit : « Les vents de l’année passée étaient bien mauvais, mais ceux de cette année sont encore des vents pires... »
– Le fameux marquis d’Argens témoigna, dans ses Lettres juives, quelque crédulité pour les histoires de vampires. Il faut voir, dit Voltaire, comme les Jésuites de Trévoux en triomphèrent : « Voilà donc, disaient-ils, ce fameux incrédule qui a osé jeter des doutes sur l’apparition de l’ange à la Sainte-Vierge, sur l’étoile qui conduisit les mages, sur la guérison des possédés, sur la submersion de deux mille cochons dans un lac, sur une éclipse de soleil en pleine lune, sur la résurrection des morts qui se promenèrent dans Jérusalem : son cœur s’est amolli, son esprit s’est éclairé ; il croit aux vampires...
– Il était reconnu que les vampires buvaient et mangeaient. La difficulté était de savoir si c’était l’âme ou le corps du mort qui mangeait. Il fut décidé que c’était l’une et l’autre. Les mets délicats et peu substantiels, comme les meringues, la crème fouettée et les fruits fondants, étaient pour l’âme ; les rosbif étaient pour le corps. (Dictionnaire philosophique).
– Le résultat de ceci est qu’une grande partie de l’Europe a été infestée de vampires, pendant cinq ou six ans, et qu’il n’y en a plus ; que nous avons eu des convulsionnaires en France, pendant plus de vingt ans, et qu’il n’y en a plus ; que nous avons eu des possédés pendant dix sept cents ans, et qu’il n’y en a plus ; qu’on a toujours ressuscité des morts depuis Hyppolite, et qu’on n’en ressuscite plus. (Même ouvrage.)
Conclusion. – Parce qu’on a vu dans ce volume quelques histoires qui portent en apparence un certain caractère de vérité, il ne faut pas pour cela les croire. On n’a lu généralement que des contes, ou des aventures qui ne sont nullement authentiques. Doit-on croire une personne qui a vu seule des choses surnaturelles ? Et dans toutes apparitions, il n’y a jamais de témoins imposants.
Il est vrai qu’on a déterré des morts dont le corps était encore frais. Cet accident était causé par la nature du terrain où ils étaient inhumés ou bien par des maladies ; la peur et l’imagination troublée en ont fait des vampires.
Mais comme il est reconnu et démontré que les morts ne peuvent revenir, et qu’il n’y a jamais eu de revenants, à plus forte raison, doit-on être assuré qu’il n’y a ni vampires, ni spectres, qui aient le pouvoir de nuire.
Remarquons en finissant que les personnes d’un esprit un peu solide n’ont jamais rien vu de cette sorte, que les apparitions n’ont effrayé que des villageois ignorants, des esprits faibles et superstitieux. – Pourquoi Dieu, qui est clément et juste prendrait-il plaisir à nous épouvanter, pour nous rendre plus misérables ?...